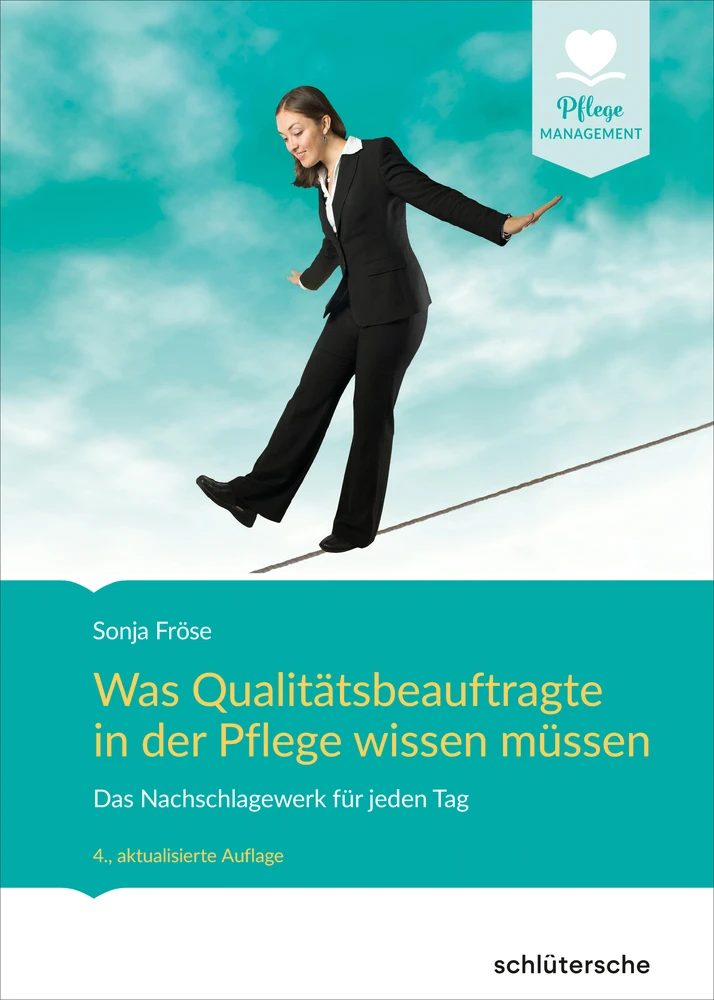Was Qualitätsbeauftragte in der Pflege wissen müssen
Das Nachschlagewerk für jeden Tag
Zusammenfassung
Ein- und Aufsteiger im Qualitätsmanagement profitieren von der aktuellen 4. Auflage. Denn: Gute Qualität verlangt ein solides Fundament an Wissen und Know-how.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 4. Auflage
Erfreulicherweise haben sich in den Jahren seit der Erstveröffentlichung dieses Fachbuchs der Umgang mit dem Qualitätsmanagement und die Einstellung dazu enorm verändert und weiterentwickelt. Dies macht zum einen eine Aktualisierung notwendig, spiegelt den PDCA-Zyklus wider und gibt mir zum anderen die Möglichkeit, neue interessante Themen einzufügen.
Im Rückblick ist eine deutliche Professionalisierung im Bereich des Qualitätsmanagements festzustellen; dass »Qualität nicht mal eben so nebenbei« geht, ist mittlerweile allen klar: Pflegedienstleitungen, Geschäftsführer*innen, Kolleg*innen, Prüfinstanzen und nicht zuletzt auch Patient*innen, Bewohner*innen, Gästen und Angehörigen.
Seit vielen Jahren sind die Auswirkungen des zunehmenden Fachpersonalmangels und der Überbelastung des Pflegepersonals allgegenwärtig, was die Bedeutung des Qualitätsmanagements besonders stärkt: Nur planvolle und geregelte Abläufe vermeiden Fehler und gewährleisten eine kontinuierlich gleichbleibende Güte bei der Durchführung von Pflegemaßnahmen.
Zu den zentralen Themen des Qualitätsmanagements sind die Umsetzung der Transparenzkriterien bzw. Qualitätsprüfung und die Maßnahmen der Personalentwicklung geworden, ebenso wie die Darstellung von Patientenberatungen hinsichtlich individueller Risiken und die sozialen Betreuungen durch die Betreuungskräfte.
Mittlerweile gilt, trotz Personalknappheit nicht auf Qualitätsansprüche zu verzichten oder diese herunterzuschrauben. Wichtiger denn je ist hier Teamarbeit. Sie sind als Qualitätsbeauftragte*r nicht allein für die Qualität zuständig, sondern alle Beteiligten!
Beim Lesen dieser aktualisierten Auflage werden Sie sicher feststellen, welchen wichtigen und zentralen Stellenwert Ihre Position als Qualitätsbeauftragte*r innerhalb eines Pflegeunternehmens einnimmt – ich hoffe, Sie fühlen sich für diese herausfordernde Arbeit dauerhaft motiviert und kraftvoll!
| Berlin, im April 2021 | Sonja Fröse |
Das Wort Qualität ist in aller Munde und scheinbar glauben wir alle, etwas von Qualität zu verstehen, denn jeder erwartet schließlich Qualität – auch in der Pflege. Wir möchten qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Aber wo fängt Qualität an und wie viel Qualität ist zu welchem Preis zu bekommen? Hat die Qualität Grenzen?
Bereits Florence Nightingale veröffentlichte 1860 in ihren »Bemerkungen zur Krankenpflege« qualitätsrelevante Überlegungen, Maßnahmen und letztlich auch Erfahrungen. Ihre Vorstellungen von qualitätsbezogenem Arbeiten machten nicht mal vor der Architektur des Krankenhauses halt.
Die deutsche Krankenschwester Hilde Steppe definierte Pflegequalität als individuellen »Anteil der krankenpflegerischen Versorgung; also wie wird der Patient behandelt, beraten, informiert, versorgt.«1 Demnach ist Pflegequalität kein statischer Wert, sondern bezieht sich immer auf die Bedürfnisse des Patienten, die Zielsetzung des Trägers und die der Pflege gegeben Möglichkeiten.
In Berlin sitzt seit 1917 das »Deutsche Institut für Normung e.V.« Neben vielen anderen Aufgaben werden dort Normen und Standards erarbeitet, die international Geltung haben. Zu diesen Normen gehören auch die DIN EN ISO 9001, die häufig in der Pflege (Dienstleistungssektor) als Qualitätsmanagementsystem genutzt wird.
Etwas einfacher hat es Avedis Donabedian ausgedrückt. Donabedian war Professor für Public Health an der Universität von Michigan und Begründer der Qualitätsforschung im Gesundheitswesen. Seine Definition gleicht im Prinzip derjenigen der DIN EN ISO, lässt sich aber etwas einfacher verstehen: Pflegequalität »ist der Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen des Gesundheitswesens und der wirklich geleisteten Pflege.«2
Eine weitere, bislang aktuelle Definition stammt vom 2009 gegründeten Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP):
Definition Qualität in der Pflege
»Gute Qualität in der Pflege bedeutet, dass die Bedarfe und Bedürfnisse des pflegebedürftigen Menschen im Mittelpunkt der pflegerischen Versorgung stehen.
Bei der Ausgestaltung des Pflegeprozesses sollen das Lebensumfeld und die Gewohnheiten des pflegebedürftigen Menschen sowie die verfügbaren Ressourcen berücksichtigt werden.«*
Dienstleistungsqualität geht einher mit der Übereinstimmung der Qualitätsdefinition des Kunden, des Mitarbeiters und der Organisation/des Unternehmens.
Tab. 1: Qualitätsdefinitionen, Definition von Pflegequalität

Mit der Qualität Ihrer Leistungen können Sie sich von anderen Anbietern unterscheiden. Daher sollten Sie sowohl innerhalb Ihrer Pflegeeinrichtung, aber auch nach außen hin transparent machen, was Ihre Vorstellungen von Qualität sind und was Sie tun, um diese zu erreichen. Qualität sollte in allen Bereichen, die mit der Leistungserbringung zu tun haben, definiert, kontrolliert und durchgeführt werden. Das bedeutet, dass Sie in der Pflege z. B. auch die Leistungen von Fremdfirmen bewerten und ggf. Konsequenzen ziehen, indem Sie den Dienstleister wechseln, wenn die Qualität nicht stimmt.
Die Qualitätsdefinition
Definieren Sie gemeinsam mit der Pflegedienstleitung und ggf. den Mitgliedern des Qualitätszirkels, wie Ihre Qualität aussehen soll. Die folgenden Fragen können bei dieser persönlichen Qualitätsdefinition weiterhelfen:
• Wie viele Fortbildungsstunden soll jeder Kollege jährlich bekommen?
• Wie hoch soll die Fachpersonalquote sein?
• Wie viel Zeit wird den Kolleg*innen z. B. für eine strukturierte Informationssammlung (SIS®) eingeräumt oder bezahlt?
• Was tun Sie, um Ihre Kolleg*innen zu fördern und zu motivieren?
• Welche Fortbildungsthemen sind Ihnen wichtig?
• Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz?
• Bieten Sie zusätzliche Leistungen an? Wenn ja, welche?
• Welchen Service bieten Sie Ihren Klient*innen?
• Wo liegen Ihre Schwerpunkte?
• Holen Sie sich bei Bedarf externe Berater*innen?
• Wie gestalten Sie die interne Kommunikation?
• Mit welchem Umweltbewusstsein arbeiten Sie?
• Wie sichern Sie, dass Informationen weitergegeben werden?
• Wie häufig möchten Sie Pflegevisiten durchführen?
• Welche Priorität haben Kunden- und Kollegenzufriedenheit?
• Wie können Sie Ihre Ziele erreichen und was tun Sie dafür?
• Wie gehen Sie mit Fehlern um?
• Wo unterscheidet sich Ihr Anspruch von den Mindestanforderungen?
Formulieren Sie strategische Unternehmensziele nach dem SMART-Prinzip. Das SMART-Prinzip wird zur genauen Formulierung von Zielen angewendet und ist die Abkürzung für:
• Spezifisch
• Messbar
• Anspruchsvoll/Attraktiv
• Realistisch
• Terminiert
1.1Was ist ein Qualitätsmanagementsystem?
Während Qualität ein Zustand ist, ist Qualitätsmanagement ein Prozess. Es gilt also nicht nur einen Zustand der Qualität (einmalig) zu erreichen, sondern diesen zu halten und zu verbessern!
Nach W. E. Deming kann man ein Qualitätsmanagementsystem folgendermaßen beschreiben: Qualitätsmanagement bedeutet, dass man Qualität systematisch, kontinuierlich und konsequent definiert, kontrolliert, anpasst und umsetzt.

Qualität ist ein Prozess
Der bekannteste Prozess in der Pflege ist der PDCA-Zyklus, der auch im Qualitätsmanagement angewendet wird.
Gewissenhaft ausgeführt ist ein Qualitätsmanagementsystem eine umfangreiche und schwierige Aufgabe, die Zeit, Geduld, Fleiß, Kreativität, teilweise Mut und letztlich auch Geld kostet. Es ist ein ewiger Kreislauf.
Die Qualität einer Einrichtung oder eines ambulanten Dienstes wird dabei auf verschiedenen Qualitätsebenen angesiedelt:
1. Die Strukturqualität beschreibt Bedingungen wie räumliche Gegebenheiten, sachliche und personelle Ausstattung, die erfüllt werden bzw. vorhanden sein müssen. Hierzu gehören Computer und Laptops mit entsprechender Software, ein geeigneter Arbeitsplatz zur Nutzung, notwendige andere Gerätschaften wie beispielsweise eine Sitzwaage oder notwendige Hilfsmittel für rückenschonendes Arbeiten.
2. Die Prozessqualität beschreibt die praktische Vorgehensweise, also den fachlich korrekten Ablauf von Pflege, Versorgung und Betreuung unter der Maßgabe der lückenlosen Planung und Dokumentation.
3. Die Ergebnisqualität beschreibt das zu erreichende Ziel: Sind alle Maßnahmen hinsichtlich Pflege und Betreuung auch wirksam? Decken sich Soll- und Ist-Zustand?
Wenn ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt wird, müssen Qualitätsziele festgelegt werden, so wie man eine Reise plant und sich das Ziel aussucht. Dabei ist nicht nur das Ziel selbst wichtig, sondern auch der Weg dorthin.
Qualitätsziele müssen den Mitarbeiter*innen bekannt gemacht werden, nur so können sie gemeinsam erreicht werden. Qualität ist nicht die Leistung eines einzelnen, sondern aller Beteiligten.
Im Prozess der stetigen Qualitätsverbesserung kann diese entweder durch eine dauerhaft-stetige oder durch spontane, deutliche Verbesserung erreicht werden.
Die Kolleg*innen in die Erarbeitung einbeziehen zu wollen, ist ein häufig angestrebtes Ziel. Nicht jeder hat jedoch den Wunsch, sich neben der praktischen Arbeit mit der Theorie zu befassen. Vorgegebene, aber nachvollziehbare Ziele sind daher nicht falsch!
Um die Anforderungen von möglichst allen Beteiligten zu erfüllen, ist ein Qualitätsmanagementsystem sinnvoll. Dieser Prozess des Auswählens und Aufstellens von Kriterien, deren Überprüfung, der Vergleich zwischen Plan- und Ist-Zustand umfasst ein Qualitätsmanagementsystem. Das bedeutet, dass ein von Ihnen umgesetztes Qualitätsmanagementsystem, das die gesetzlichen Forderungen erfüllt, nicht ein vorgegebenes Qualitätsmanagementsystem wie z. B. DIN EN ISO 9001:2015, KTQ® oder TQM sein muss. Die Hauptsache ist, Ihre Einrichtung setzt Qualitätsmaßnahmen geplant um, entwickelt diese weiter und wendet sie auch an. Der Nachteil bei einem »eigenen Qualitätsmanagementsystem« ist genau dieses Fehlen einer verbindlichen Richtschnur. Es macht viel mehr Arbeit (kostet viel mehr Energie, Zeit und Kraft) sich die Reiseroute selbst auszudenken, als eine fertige zu nutzen. Insofern sollten Sie ein vorgegebenes Qualitätsmanagementsystem vorziehen, das Sie für Ihre Pflegeeinrichtung individualisieren.
1.1.1DIN EN ISO 9001
Das Qualitätsmanagementsystems der DIN EN ISO 9001 ist als Begriff weit verbreitet. Ursprünglich kommt es aus der Industrie. Grundlage ist der prozessorientierte Ansatz, der über den PDCA-Zyklus hinausgeht. Einzelne Prozesse werden definiert und im Ablauf sowie beteiligte Schnittstellen beschrieben. So können Schwachstellen, Lücken oder mögliche Fehlerquellen gefunden und beseitigt werden.
Die DIN EN ISO 9001 kann als das grobe Gerüst bezeichnet werden, die als Grundlage für einzelne und individuelle Qualitätsmanagementsysteme genutzt wird.
Die acht Grundsätze des Qualitätsmanagements nach der DIN EN ISO 9001 lauten:
1. Kundenorientierung
2. Führung
3. Einbeziehung der Mitarbeitenden
4. Prozessorientierung
5. Systemorientiertes Management
6. Ständige Verbesserung (kontinuierliche Verbesserung KVP)
7. Sachliche Entscheidungsfindung
8. Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen
1.1.2EFQM
Die European Foundation for Quality Management ist eine gemeinnützige Organisation und wurde 1998 in Brüssel gegründet und kann daher als europäisches Qualitätsmanagementsystem bezeichnet werden. In Deutschland ist die DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V.) der Partner der EFQM. Es werden regelmäßig Schulungen, Webinare und Weiterbildungen angeboten. 2020 wurde ein komplett überarbeitetes neues EFQM Modell veröffentlicht. Nach dessen Kriterien wird einmal jährlich der Ludwig-Ehrhardt-Preis verliehen um den Titel »Excellence made in Germany« auszuzeichnen. Zurzeit sind insgesamt ca. 6.500 Firmen und Personen Mitglieder, es werden 100 Mitarbeiter*innen beschäftigt.3 Seit 2019 hat die DQP ihren Fokus auf den Bereich Pflege verstärkt.4
1.1.3Total Quality Management (TQM)
Das TQM bezeichnet den Grundgedanken an ein QM-System, das alle Prozesse und Bereiche eines Unternehmens betrifft. Es ist kein eigenständiges Qualitätsmanagementsystem.5 Auch hier ist der Prozess ein wichtiger Gedanke und schließt sowohl Produkte als auch Dienstleistungen ein. Nur gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen durch aktives Handeln ist Qualität erreichbar und orientiert sich an den Kunden.
1.1.4Der PDCA-Zyklus (Demingkreis)
Als Demingkreis oder auch Demingrad wird der nach dem amerikanischen Ingenieur, Statistiker und Author Dr. William Edwards Deming (1900–1993) PDCA-Zyklus benannt. Deming wurde durch seine Arbeit in den 1950er Jahren im Zusammenhang mit führenden Industriemanagern der Autoindustrie in Japan bekannt und half angeblich bei enorm bei dem wirtschaftlichen Erfolg Japans nach dem zweiten Weltkrieg.6
Die Anfangsbuchstaben stehen für:
| Plan | planen |
| Do | tun |
| Check | kontrollieren/überprüfen |
| Act | handeln |

Abb. 2: Der PDCA-Zyklus.
1.2Warum überhaupt ein Qualitätsmanagementsystem?
Seit 1995 verlangt der Gesetzgeber im Rahmen des XI. Sozialgesetzbuches, dass alle Pflegeeinrichtungen ein Qualitätsmanagementsystem einführen und umsetzen müssen. Gerade wenn es um die Sicherheit und Versorgung von pflege- und hilfebedürftigen Menschen geht, möchte jeder bestmögliche Leistungen von allen Beteiligten. Allen voran der Klient selbst. Dieser ist aber vermutlich sowohl im Augenblick der Hilfeannahme als auch langfristig nicht in der Lage, diese objektiv zu bewerten und zu analysieren. Gerade in heutigen Zeiten von Personalmangel wird immer wieder über die Möglichkeiten einer »gefährlichen Pflege« gesprochen, die dem Qualitätsstufenmodell nach Fiechter und Meier7 von 1981 zugrunde liegt. Es hat nichts von seiner Aktualität verloren.

Abb. 3: Vier-Stufen-Modell der Qualität nach Fiechter und Meier.
Weiter möchten die Angehörigen und Verantwortlichen, z. B. Rechtsbetreuer*innen, Ärzt*innen »bestmögliche Pflege«, wenn diese aus der Hand gegeben werden und durch stationäre, ambulante und/oder teilstationäre Einrichtungen erbracht wird. Auch die Kostenträger möchten »bestmögliche Pflege«, schließlich bezahlen sie diese (mit den Geldern ihrer Versicherten bzw. den Steuergeldern).
Sie als Pflegeunternehmen dringen in die Privat- und Intimsphäre des Angehörigen und ggf. in die gesamte Familienstruktur ein. Nicht zuletzt möchten auch Sie als Pflegeunternehmen bzw. Pflegekraft und Qualitätsbeauftragte*r »bestmögliche Pflege«. Diese beiden Welten und Ausgangspunkte gilt es nun zu verbinden. Sie möchten täglich guten Gewissens in den Spiegel sehen können und Ihr Wissen und Ihre Kompetenz in der Praxis anwenden.
Da jeder unter »bestmöglicher Pflege« etwas anderes versteht, wird mit Hilfe einer Systematik die geplante und erbrachte Dienstleistung überprüft, für die es feste Kriterien gibt.
»Ein Kriterium stellt den zu bewertenden Sachverhalt bei der Selbst- und Fremdbewertung dar. Kriterien bilden den Maßstab, der es gestattet, zwischen den Strukturen, Prozessen und Ergebnissen im Krankenhaus zu unterscheiden. Das Kriterium besteht aus einem eingängig formulierten Satz, der die Inhalte des Kriteriums schlaglichtartig zusammenfasst (Kriterium-Schlagzeile), und Erläuterungen, die unterhalb der Kriteriumsebene als Fragen formuliert sind.«8
Abgesehen von der gesetzlichen Pflicht zum Qualitätsmanagement sollte auch die Geschäftsführung bzw. -leitung einer Pflegeeinrichtung Interesse an einem funktionierenden Qualitätsmanagement haben und Sie daher entsprechend unterstützen. Die positiven Auswirkungen eines funktionierenden und gelebten Qualitätsmanagements rechtfertigen den Geld- und Zeitaufwand:
• Transparenz und Verständlichkeit durch systematische und nachvollziehbare Vorgehensweisen,
• Frühzeitige und systematische Fehler-/Problemerkennung und -vermeidung,
• Verhinderung von Fehlerwiederholung,
• Reduzierung von Personal- und Kostenverschwendung,
• Steigerung der Kundenzufriedenheit,
• Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsatmosphäre.
Tab. 2: Bestmögliche Pflege und ihre Bedingungen

Bedenken Sie, dass der Erhalt eines Qualitätsniveaus ebenfalls ein erstrebenswertes Ziel ist. Es geht nicht immer um Verbesserung, sondern auch um Erhalt des Erreichten. Wie beim Jonglieren müssen alle Bälle in der Luft bleiben und das Konzentrieren auf nur einen Ball führt wahrscheinlich dazu, dass die Anderen fallen.
1.3Wie wird man Qualitätsbeauftragte*r?
Häufig werden Kolleg*innen, die durch gute Arbeit und viel Engagement positiv aufgefallen sind, zum/zur Qualitätsbeauftragten ernannt. Oder Sie haben selbst im Rahmen von Karrieremöglichkeiten die entsprechende Weiterbildung gefunden und interessieren sich für das Thema. Im Zusammenhang mit externen Stellenausschreibungen wird häufiger gezielt nach Qualitätsbeauftragten in der Pflege gesucht. Darin werden dann die Aufgaben der Qualitätsbeauftragten zusammengefasst, entsprechende Fort- und Weiterbildungen und eventuell bereits Berufserfahrung in diesem Bereich erwartet oder können vor Aufnahme der Tätigkeit verhandelt werden.
Mit Erreichen einer (meist) zweijährigen Berufserfahrung kann normalerweise die Weiterbildung zur/zum Qualitätsbeauftragten besucht werden. Mittlerweile werden aber auch die Monate der berufsbegleitenden Weiterbildung zur Berufserfahrung dazugezählt. Bei der Suche nach der bestmöglichen Weiterbildung fällt jedoch auf, dass es keine einheitlichen Weiterbildungen im Bereich des Qualitätsmanagements gibt. Häufig finden sich ca. 200-stündige Weiterbildungen, die Inhalte unterscheiden sich jedoch. Basisinhalte der Weiterbildungen sind Kennenlernen von Qualitätsmanagementsystem und rechtlichen Grundlagen, Überwachung und Überprüfungsmaßnahmen, Erstellen und Lesen von Statistiken, Auswertung von Daten, Kommunikations-, Präsentations- und Moderationsfähigkeiten sowie Kenntnisse zum Projektmanagement und Abfragemethoden.
Arbeits(zeit)modelle
In kleinen Unternehmen kann die Doppelbesetzung einzelner Positionen notwendig sein. Dies kann solange aus wirtschaftlichen und/oder personellen Gründen sein, bis die Stellen einen entsprechenden Umfang notwendig machen, um eine ganze Stelle auszufüllen (Hier möchte ich gerne auf die Möglichkeit der Arbeitsplatzteilung, das sogenannte »job sharing«, als Arbeitszeitmodell hinweisen) oder ist entsprechend dauerhaft nur auf einen gewissen Stundensatz begrenzt.

QM als familienfreundliche Position in der Leitungsebene
Qualitätsmanagement ist aufgrund der Flexibilität in Bezug auf den Arbeitsplatz vor Ort und am Schreibtisch sowie zeitlicher Einteilung gut vereinbar mit Familie und Beruf.
Möglich wäre auch, dass Sie täglich die Hälfte Ihrer Arbeitszeit für allgemeine Leitungsfunktionen bzw. Pflege nutzen und die andere Hälfte für das Qualitätsmanagement. Meiner Erfahrung nach haben sich regelmäßige ganze Tage am besten bewährt. Zwei zusammenhängende Tage sind noch besser. Sie verbringen einen Tag vor Ort bei Pflegevisiten oder mit Kolleg*innen und den anderen Tag werten Sie das Gesehene aus. Wie schon erwähnt, haben große Pflegeeinrichtungen für jedes Haus/ Einheit einen eigenen (fachspezifische) Qualitätsbeauftragten und übergeordnete Qualitätsmanager*innen, die die Aufgaben der einzelnen QMB zentral koordinieren, überwachen und ggf. steuern. Wenn Sie langfristig mit dem Arbeitspensum oder der gewährten Stundenanzahl für das Qualitätsmanagement nicht zurechtkommen, ist es an der Zeit und an Ihnen, das entsprechend zu kommunizieren. Doppelfunktionen, wie beispielsweise stellvertretende Pflegedienstleitung und QB oder Praxisanleiter/ QB oder Hygienebeauftrage/QB bieten sich gut an.
Bei Doppelfunktionen sehen Kritiker Schwierigkeiten, jeder Position gerecht zu werden. Es gäbe Aufgaben, die sich nicht miteinander in Einklang bringen lassen könnten, z. B. die entstehenden Kosten für das Qualitätsmanagement und der Zwang zu Kosteneinsparungen. Da ein Qualitätsmanagementsystem notwendig ist, ist die Frage der Kosten obligatorisch und vermutlich auch schwer messbar.
Bei großen Pflegeeinrichtungen reicht ein Qualitätsbeauftragter nicht aus und es gibt ein Team von mehreren QB’s. Je nach Größe des Unternehmens und nach Stelleninhalt gibt es für einzelne Teilbereiche regionale oder teambezogene QB’s (zentrales und dezentrales Qualitätsmanagement).
1.4Welche Karrieremöglichkeiten im Bereich des Qualitätsmanagements gibt es?
»Viele Herausforderungen erfordern neue Wege. Viele Herausforderungen erfordern gemeinsame Wege. Viele Herausforderungen erfordern kurze Wege. Viele Herausforderungen scheitern an Umwegen«, schreibt Steffen Seipp9.
Die Stelle des Qualitätsbeauftragten kann der erste Schritt auf der Karriereleiter sein. Da nicht explizit beschrieben ist, welche Qualifikation zur Benennung zum Qualitätsbeauftragten notwendig ist, können Sie auch ohne Berufserfahrung die Stelle besetzen. Die Vorgaben kommen meist von der Pflegeeinrichtung selbst. Unbestritten ist jedoch eine gewisse Berufserfahrung von Vorteil.
Sowohl Altenpfleger*innen als auch Gesundheits- und Krankenpfleger*innen sollten während der QM-Weiterbildung Praktika in den verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens absolvieren. Dies ist jedoch keine Pflicht und wird zurzeit auch nicht von den Anbietern der Weiterbildung gefordert. Ein Praktikum kann jedoch helfen
• erste Praxiserfahrung zu gewinnen,
• praxisnah und direkt nachzufragen,
• neue Strukturen kennenzulernen,
• bestehende Erfahrungen zu festigen oder zu revidieren und
• neue Eindrücke und Sichtweisen zu erleben.
Der Einsatz in Tagespflegeeinrichtungen, Arztpraxen, im Hospiz, in der Kurzzeitpflege und in der ambulanten Pflege steigert das Verständnis für andere Berufsgruppen und verbessert so die spätere Zusammenarbeit erheblich. Auch bei den Themen Pflegeberatung10 und Entlassungsmanagement ist es meiner Meinung nach von Vorteil, wenn ein Qualitätsbeauftragter in verschiedene Pflegeeinrichtungen »hineingeschnuppert« hat. So können Sie später Klient*innen und Kolleg*innen Vorteile oder Nutzen unterschiedlicher Pflegeeinrichtungen und deren ergänzende Leistungen für die Betroffenen besser erklären.
Ein weiterer Vorteil von Praktika sind die Kontakte, die Sie dort mit Kolleg*innen knüpfen können. Diese sollten Sie bei einem Tag der offenen Tür oder durch Telefon- und E-Mailkontakte regelmäßig pflegen ( Kap. 7). Unabhängig von der Qualitätsausbildung sollte sich jede Pflegekraft regelmäßig fort- und weiterbilden. Es gibt unzählige Themenbereiche, um eigene Stärken und Interessen zu fördern und beruflich einzusetzen. Das können Methodenkompetenzen wie Storytelling oder Sketchnotes sein, aber auch praktische und pflegebezogene Themen wie Aromatherapie oder »Märchen bei Demenz«. Suchen Sie sich nach Ihren eigenen Interessen und entsprechend nach dem Pflegeleitbild Fortbildungen aus, um das neue Wissen an die Kolleg*innen weitergeben zu können.
Kap. 7). Unabhängig von der Qualitätsausbildung sollte sich jede Pflegekraft regelmäßig fort- und weiterbilden. Es gibt unzählige Themenbereiche, um eigene Stärken und Interessen zu fördern und beruflich einzusetzen. Das können Methodenkompetenzen wie Storytelling oder Sketchnotes sein, aber auch praktische und pflegebezogene Themen wie Aromatherapie oder »Märchen bei Demenz«. Suchen Sie sich nach Ihren eigenen Interessen und entsprechend nach dem Pflegeleitbild Fortbildungen aus, um das neue Wissen an die Kolleg*innen weitergeben zu können.
Im Qualitätsmanagement sind systematische aufeinander aufbauende Weiterbildungselemente möglich: Die Weiterbildung zum Auditor (geschützte Bezeichnung) unterteilt sich in mehrere Bereiche, die aufeinander aufbauen. In der Weiterbildung zum Systemauditor sind die Titel bzw. Bezeichnungen mit dem Besuch und Bestehen der einzelnen Unterrichtsmodule verknüpft. Hier sind auch bestimmte Voraussetzungen (vgl. DIN EN ISO 2011) zu erfüllen, z. B. praktische QM-Erfahrung, Erfahrung in der Durchführung von Audits, Darstellung von Schlüsselprozessen usw.:
• QM-Beauftragte*r: Sie haben praktische Erfahrungen im Qualitätsmanagement, können QM-Systeme individuell anpassen und ständig verbessern. Außerdem verfügen sie über Kenntnisse und Basiswissen zu den Methoden des modernen Qualitätsmanagements, den Grundsätzen der Qualitätsverbesserungen und des Qualitätsmanagements.
• QM-Manager*innen: Über das Grundwissen der QM-Beauftragten hinaus kennen diese die entsprechenden Normen der DIN EN ISO 9001 und andere QM-Modelle. Sie können Strategien zur Qualitätsverbesserung gezielt umsetzen und Methoden und Vorgehensweisen zur Bewertung von QM-Systemen anwenden.
• Interne Auditor*innen: Aufbauend auf den vorherigen Ausbildungsinhalten können Sie in Ihrem Arbeitsbereich Audits planen, durchführen, dokumentieren und auf dieser Basis Verbesserungen einleiten und die Leitungsmitarbeiter*innen unterstützen.
• Systemauditor*innen: Sie können neben internen auch externe QM-Systeme, also von anderen Organisationen, bewerten bzw. auditieren.

Abb. 5: Weiterbildungsmöglichkeiten für Qualitätsbeauftragte.
Ein Studium mit Abschluss als Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Qualitätsmanagement ist ebenfalls möglich und wird häufig als Fernstudium angeboten.

Qualitätsbeauftragte*r oder Pflegedienstleitung? Diese Frage kann sich vor der entsprechenden Weiterbildung stellen und ist berechtigt. Dennoch sind die täglichen Aufgaben beider Stellen sehr verschieden. Beide Stellen tragen hohe Verantwortung und arbeiten eng mit den Mitarbeiter*innen zusammen, dennoch bleibt die endgültige Verantwortung bei der Pflegedienstleitung.
1.5Muster-Stellenbeschreibung eines Qualitätsbeauftragten

Stellenbeschreibung für den Qualitätsbeauftragten
Name und Logo
Adresse der Pflegeeinrichtung
Arbeitsbereich: Ambulanter (Kinder-)Pflegedienst/Tagespflege/Kurzzeitpflege/Senioren-/Pflegeheim/Hospiz
Stelleninhaber*in:
Arbeitszeit: xx Std./Woche oder siehe Arbeitsvertrag vom __________, davon anteilig ______% als Qualitätsbeauftragte
Vertretung: Pflegedienstleitung und/oder _____________________
Fachliche und persönliche Voraussetzungen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Pflegefachkraft (Gesundheits- und Krankenpfleger*in, Kinderkrankenschwester, Altenpfleger*in)
• Mindestens Jahre Berufserfahrung in der Kranken- oder Altenpflege, davon mindestens Jahre/Monate in der ambulanten/stationären Pflege
• Anerkannte Weiterbildung als Qualitätsbeauftragte*r
• Fundierte Kenntnisse in der Bedienung von Computern und pflegerelevanter Software, z. B.
• Weiterbildung in Moderations- und Präsentationstechniken
• Gültiger Führerschein Klasse B
• Motivation zur ständigen Fort- und Weiterbildung
Ziele der Stelle:
• Der/Die Qualitätsbeauftragte wirkt hauptsächlich daran mit, ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem zu installieren, umzusetzen und weiter zu entwickeln.
• Der/Die Qualitätsbeauftragte steht Klient*innen, Angehörigen, Mitarbeiter*innen und externen Partnern beratend zur Seite.
• Der/Die Qualitätsbeauftragte unterstützt die Pflegedienstleitung in der Umsetzung von Verfahren und gesetzlichen Änderungen und Neuerungen.
• Qualitätskonzept und Standards für die Einrichtung (einschließlich Führung und Evaluation des QM-Handbuchs) aufbauen und ausbauen
• Qualitätsbezogene Aufgaben erstellen, koordinieren, genehmigen und – soweit möglich – entscheiden
• Auswertung von Fehlermeldungen, Beschwerden und Kunden-Feedback
• Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Qualitätsproblemen (Soll-/Ist-Analyse) vornehmen (Risikomanagement)
• Überprüfung der Pflegedokumentation im Rahmen von Dokumentationsvisiten
• Durchführung, Teilnahme oder Begleitung/Weitergabe von Pflegevisiten, Fallbesprechungen, Kunden- und Mitarbeiterbefragungen und entsprechende Auswertungen
• Durchführung/Teilnahme von internen Qualitätsprüfungen
• Mitarbeit bei einrichtungsbezogenen Prüfungen, pflegewissenschaftlichen Modellprojekten
• Teilnahme und Mitarbeit an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen wie verbandsinterne Arbeitsgemeinschaften
• Organisation, Initiation und ggf. Moderation von Qualitätszirkeln, internen Fortbildungsveranstaltungen etc.
• Erstellung eines jährlichen Fort- und Weiterbildungsplans (Einladung von Dozent*innen, Teilnehmerplanung, inkl. Budgetverwaltung)
• Informationsweitergabe des Qualitätsstandes an die Pflegedienstleitung (z. B. Jahresbericht)
• Erstellung von qualitätsrelevanten Konzepten, Arbeitspapieren, Richtlinien und Standards
• Beratung, Anschaffung, Verwaltung von Fachliteratur und Hilfsmitteln
• Teilnahme an Angehörigenabenden, Info- und Werbeveranstaltungen, inklusive Zuarbeit an der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Homepage, Newsletter)
Sonstiges:
Die Stellenbeschreibung der Pflegefachkraft ist weiterhin gültig.
Weitere Aufgaben können jederzeit der Stellenbeschreibung zugefügt werden, bedürfen aber der Schriftform.
| Musterstadt, den | Musterstadt, den |
| __________________________ | __________________________ |
| Unterschrift d. Arbeitgebers | Unterschrift d. Arbeitnehmers |
1.6Welche Qualitäts-Zertifizierungen gibt es?
Ob beim Kauf eines Elektrogeräts, bei Lebensmitteln oder Kosmetika – das Vorhandensein eines »Stiftung Warentest«-Logos, eines blauen Engels, mehrerer goldener Sterne oder ähnlichem lässt uns glauben, ein »gutes« (Qualitäts-)Produkt in Händen zu halten. Ähnlich verhält es sich mittlerweile auch bei Pflegeeinrichtungen.
In der Vergangenheit haben sich diverse Zertifizierungsverfahren für Pflegeeinrichtungen entwickelt. Gerade in den Jahren der Einführung des Qualitätsmanagements in der Pflege war ein enormer Bedarf an Unterstützung zur Implementierung und Durchführung notwendig. Entsprechende Anbieter versprachen Hilfe und Klarheit. Eine Zertifizierung ist nicht einem Qualitätsmanagementsystem gleichzusetzen, sondern überprüft das vorhandene QM-System. Eine Zertifzierung ist also erst nach der Einführung und Arbeit mit dem entsprechenden QM-System sinnvoll.
Eine Zertifizierung ist im Gegensatz zum Vorhandensein eines Qualitätsmanagementsystem nicht gesetzlich vorgeschrieben. Mit einer bestandenen Zertifizierung geht jedoch einher, dass die entsprechenden Prüfkriterien der jeweiligen Zertifizierung erfüllt worden sind. Deshalb streben viele Pflege- und Gesundheitseinrichtungen danach. Außerdem ist es im Sinne des PDCA-Zyklus ein gutes Mittel zur Überprüfung. Dabei sollten Sie jedoch bedenken, dass Sie langfristig für den Erhalt einer Qualitätszertifizierung Zeit und Geld investieren müssen. Bei der Auswahl für eine Zertifizierung gilt es viele Faktoren abzuwägen.
• Ist das Zertifizierungsverfahren bekannt?
• Ist der Anbieter schon langfristig am Markt bestehend?
• Passt der Anbieter zu Ihrem Unternehmen?
• Welche Anforderungen werden gestellt?
• Welche Prüfintervalle gibt es?
• Welche Unterstützung wird Ihnen geboten?
Meist werden die Pflegeeinrichtungen im Zeitraum von zwei bis vier Jahren erneut geprüft, um das entsprechende Zertifikat weiter tragen zu dürfen. Die Zertifizierungsanbieter haben eigene »Prüfkataloge« und Anforderungen an die jeweilige Pflegeeinrichtung. Vielfach werden diese mit den gesetzlichen Anforderungen übereinstimmen, aber es können durchaus auch andere bzw. mehr oder strengere Kriterien sein. Den meisten Klient*innen, Angehörigen und Pflegekräften sind die Voraussetzungen zum Erhalt solcher Zertifizierungen völlig unbekannt. Woher auch? Es sind komplexe und meist sehr detaillierte Fragen-, Prüf- bzw. Zertifizierungskataloge.
In Deutschland gibt es nach meinen Recherchen bislang nur zwei pflegewissenschaftliche Untersuchungen mit Vergleichen zu den verschiedenen Möglichkeiten zur Zertifizierung von Pflegeeinrichtungen. Eine davon ist die 2004 veröffentliche Studie des WIdO (Wissenschaftliches Institut der AOK). Darin wurden 14 Qualitätssiegel miteinander verglichen.11
Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) führte 2018 einen Vergleich einzelner Siegel und Zertifikate in der Langzeitpflege durch und stellte eine Unübersichtlichkeit auf diesem Markt fest.12 So wurde kritisiert, dass es zum damaligen Zeitpunkt ca. 20 verschiedene gebräuchliche Siegel und Zertifikate für Pflegeeinrichtungen gäbe. Diese Übersicht ist seit 12/2019 nicht mehr vorhanden.13
Deutschlandweit gibt es Zertifizierungen des vorhandenen Qualitätsmanagements durch regionale Stellen des TüV (z. B. TüVNord, TüVSued) oder anderer Anbieter, so etwa der Diakonie. Das Diakonie-Siegel Pflege wurde 1999 entwickelt. Basis war die DIN EN ISO 9001 sowie diakonische Qualitätskriterien. Es ist für stationäre, teilstationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen geeignet. Hinter dem Siegel steht das Diakonische Institut für Qualitätsmanagement und Forschung. Es entwickelt die Qualitätsmanagementsysteme aufgrund des diakonischen Grundgedankens und des Total Quality Managements für soziale Einrichtungen. Es berät und bietet Fortbildungen an.
Im Februar 2021 erschien die 4. vollständig überarbeitete Version des Bundesrahmenhandbuchs (BRH) Diakonie-Siegel Pflege, die auch neue Kernprozesse und Themen behandelt wie »Schutz vor Gewalt«.14 Darüber hinaus gibt es weitere Diakonie-Siegel für andere Einrichtungen, z. B. Beratung und Rehabilitation.
Die Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ) wurde 1997 als Projekt gestartet und 2001 zur KTQ GmbH umgewandelt. Gegenwärtig werden anhand verschiedener Kataloge (Krankenhaus, Rehabilitation, Praxen, Pflegeeinrichtungen/ Hospize/Alternative Wohnformen), die die Bewerber*innen in einer Eigenbewertung vorab bestellen können, die Zertifizierungen durchgeführt. Dabei wird das Hauptaugenmerk immer auf die Bereiche
• Patientenorientierung,
• Mitarbeiterorientierung,
• Sicherheit,
• Kommunikations- und Informationswesen,
• Unternehmensführung und
• Qualitäts- und klinisches Risikomanagement
gelegt. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich zur Zertifizierung anzumelden und durch einen KTQ-Visitor fremdbewertet zu werden. »Die KTQ GmbH bietet fünf Zertifizierungsverfahren für Einrichtungen im Gesundheitswesen und verschiedene Zertifizierungsvarianten an. … Alle Verfahren basieren auf dem KTQ-Modell und beinhalten die sechs Kategorien Patientenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Sicherheit, Informations- und Kommunikationswesen, Führung sowie Qualitätsmanagement.«15
1.7Gesetzliche Qualitätsprüfungen des MD
Als Zeichen von geprüfter Pflegequalität wurden jahrelang die sogenannten Pflege-Noten vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) vergeben. Einrichtungen der Pflege wurden jährlich bzw. nach Anlass geprüft. Grundlage sind jeweils die aktuellen Begutachtungsrichtlinien. Seit dem 1. November 2019 wurde das Verfahren umgestellt, die Pflegenoten sind seither Vergangenheit, Qualitätsindikatoren sind nun das Gebot der Stunde. »Der zentrale Fokus der neuen Prüfung liegt auf der bewohnerbezogenen Versorgungsqualität in allen Lebensbereichen. Zukünftig werden umfassende Qualitätsaspekte bewertet und bei der Feststellung von Qualitätsdefiziten wird zwischen Prozess- und Ergebnisdefiziten unterschieden«, schreibt Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des MDS.16 2020 bzw. 2021 erschienen die neuen Richtlinien für die teilstationäre bzw. ambulante Pflege.

Info
Durch das am 1.Januar 2021 in Kraft getretene MDK-Reformgesetz ändern MDS und MDK ihren Namen:
• Aus »Medizinische Dienste der Krankenversicherung« (MDK) wird der MD, getrennt von den Krankenkassen.
• Der »Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen« (MDS) benennt sich entsprechend um, in »Medizinischer Dienst Bund« (MDB). »Der MD Bund erlässt zukünftig die Richtlinien für die Tätigkeit der MD. In den Verwaltungsräten der MD werden künftig auch Vertreterinnen und Vertreter der Patientinnen und Patienten, der Pflegebedürftigen, der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Ärzteschaft und der Pflegeberufe vertreten sein.«*
* https://www.bundesgesundheitsministerium.de/mdk-reformgesetz.html
_________________________
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Pflegequalit%C3%A4t
2 Korecic J (1999): Pflegestandards Altenpflege. Springer, Berlin, S. 29
3 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Qualität (o.J.): Qualität vereint – zusammen sind wir ein starkes Netzwerk. https://info.dgq.de/acton/media/23495/mitgliedschaft
4 Vgl. www.dgp.de
5 Vgl. www.tqm.com
6 Vgl. Aguayo R (1991): Dr. Deming: The American who taught the Japanese about Quality. Touchstone. New York
7 Vgl. Thieme (2020): I care. Thieme, Stuttgart
8 Vgl. KTQ (2015): KTQ-Manual, KTQ-Katalog Krankenhaus. https://www.ktq.de/index.php?id=851
9 https://www.aphorismen.de/zitat/114038
10 Vgl. Fröse S (2018): Was Sie über Pflegeberatung wissen sollten. Schlütersche, Hannover
11 Vgl. Gerse B, Schwinger A (2004): Qualitätssiegel und Zertifikate für Pflegeeinrichtungen. GGW4/2004. https://www.wido.de/news-events/archiv-alt/detail/news/pflegequalitaetssiegel-nicht-ueberbewerten-neue-wido-studie-sorgt-fuer-transparenz/
12 Vgl. https://www.zqp.de/pflege-bei-qualitaetssiegeln-und-zertifikaten-den-durchblick-behalten/
13 Ebd.
14 https://www.diakonie-wissen.de/web/dqe/home/-/asset_publisher/7eDqzsaIw1iq/document/id/1399185?inheritRedirect=false
15 https://ktq.de/index.php?id=270
16 MDS & MDK (2019): Die neuen Qualitätsprüfungen in der vollstationären Pflege. Essen. mds-ev.de#
Die Pflegeversicherung wurde zum 1. Januar 1995 als fünfte Säule der Sozialversicherung in Deutschland eingeführt. Sie ist eine Pflichtversicherung. Gesetzlich Versicherte sind durch die Krankenkasse versichert. Privatversicherte müssen eine private Pflegeversicherung abschließen.17

Abb. 6: Die fünf Säulen der Sozialversicherung in Deutschland.
Zum 1. Januar 2002 trat das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz (PQSG) in Kraft, welches Qualitätssicherung und -prüfung sowie die Einführung eines Qualitätsmanagements vorschrieb. Es wurden Vorgaben zur Personalausstattung und Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen benannt. Der Anspruch auf Beratung wurde der Verbraucherschutz gestärkt.
In den letzten Jahren wurden viele neue Pflegereformen und Anpassungen verabschiedet und es werden in Zukunft sicherlich noch weitere kommen. Häufig wurden Reformen dringend erwartet und gefordert, beispielsweise zur Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Der demografische Wandel, der dauerhafte Personal- und Fachkräftemangel, fortschreitende Digitalisierung, Ressourcenschonung und die sich immer verändernden Gegebenheiten machen ständige Anpassungen notwendig. Gesetzliche Anforderungen an die Pflegequalität und an das Qualitätsmanagement sind in zahlreichen Paragrafen festgehalten. Detaillierte Anforderungen finden sich meist in Richtlinien, Expertenstandards, wissenschaftlichen Studien usw. Um diese Anforderungen umsetzen zu können, benötigen Sie genaue Kenntnisse und einen Überblick.

Abb. 7: Entwicklung der Pflegeversicherung in Deutschland.
Als die ersten nationalen Expertenstandards für die Pflege eingeführt wurden, hatten sich z. B. bestimmte Pflegeeinrichtungen schon damit befasst und konnten diese schnell einführen und umsetzen. Andere Pflegeeinrichtungen hörten erst Jahre später erstmals davon und hinkten mit der Anpassung und Umsetzung hinterher. Woher bekommen Sie zeitnah Informationen über Veränderungen und Neuigkeiten? Abonnieren Sie aktuelle Informationen über (E-Mail-)Newsletter, z. B.
• Bundesgesundheitsministerium, Ministerium für Wirtschaft und anderen offiziellen Behörden wie dem Robert-Koch-Institut (RKI),
• Berufsverbände, wie Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), Deutscher Berufsverband für Altenpflege (DBVA), Deutscher Pflegeverband (DPV), Berufsverband für Heil- und Pflegeberufe (BHP),
• Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (BGW),
• (Bundes- und Landes-) Arbeitsgemeinschaften, z. B. Bundesarbeitsgemeinschaft für Hauskrankenpflege e. V.,
• Aus- und Fortbildungsstätten und Hochschulen,
• Anbieter Ihres Pflegedokumentationssystems oder Ihrer Software,
• Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP),
• (Pflege-)Fachzeitschriften und Fachverlage,
• lokale Pflegestützpunkten und Angehörigenverbänden.
Tipp
Hören statt Lesen: Zwischenzeitlich gibt es zu unzähligen Themen Podcasts, darunter auch pflegerische Themen oder Qualitäts- und Zeitmanagement. Zu hören sind (Pflege-) Experten und Sachverständige, die zu einzelnen Teilbereichen informieren.
2.1Welche qualitätsrelevanten Gesetze gibt es in Deutschland für die Pflege?
Nachstehend ( Tab. 3) sind einige Paragrafen des Sozialgesetzbuches und weitere gesetzliche Grundlagen der Qualitätsarbeit für die Pflege aufgelistet. Allerdings können nicht alle geltenden Gesetze hier benannt werden, da diese sich in unterschiedlichen Gesetzesbüchern befinden, dahin verweisen bzw. auf weitere geltene Leit- und Richtlinien sowie Standards.
Tab. 3) sind einige Paragrafen des Sozialgesetzbuches und weitere gesetzliche Grundlagen der Qualitätsarbeit für die Pflege aufgelistet. Allerdings können nicht alle geltenden Gesetze hier benannt werden, da diese sich in unterschiedlichen Gesetzesbüchern befinden, dahin verweisen bzw. auf weitere geltene Leit- und Richtlinien sowie Standards.

Fehlende Zusammenfassung aller Vorgaben
Aufgrund der vielen verschiedenen Quellen qualitätsrelevanter Grundlagen ist eine komplette Zusammenfassung nicht möglich. Die Gefahr von Inaktualität ist einfach zu groß.
Den genauen Gesetzestext der einzelnen Paragrafen können Sie entsprechend nachlesen. Generell gilt, dass Sie die Grundlagen Ihrer täglichen Arbeit möglichst als Primärquelle kennen sollten – also: Wo steht es geschrieben? Was genau steht dort?
Entsprechend Ihrer Einrichtung im Gesundheitswesen besteht übergeordnet eine Einteilung in
• ambulante Einrichtung, z. B. Arztpraxen, medizinische Versorgungszentren, Apotheken,
• teilstationäre Einrichtung, z. B. Tages- und Nachtpflege, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen,
• stationäre Einrichtung, z. B. Hospiz, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser.
Tab. 3: Überblick qualitätsrelevanter Gesetze
| Pflegeversicherung – Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI) | |
|---|---|
| Paragraf | Titel |
| § 11 | Rechte und Pflichten der Pflegeeinrichtungen |
| § 71 | Pflegeeinrichtungen |
| § 75 | Rahmenverträge, Bundesempfehlungen und -vereinbarungen über die pflegerische Versorgung |
| § 112 | Qualitätsverantwortung |
| § 112 a | Übergangsregelungen zur Qualitätssicherung bei Betreuungsdiensten |
| §113 | Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität |
| § 113 a | Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege |
| §113 b | Schiedsstelle Qualitätssicherung |
| § 114 | Qualitätsprüfungen |
| § 114 a | Durchführung der Qualitätsprüfungen |
| § 115 | Ergebnisse von Qualitätsprüfungen |
| § 116 | Kostenregelungen |
| §117 | Zusammenarbeit mit den nach heimrechtlichen Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden |
| § 118 | Beteiligung von Interessenvertretungen, Verordnungsermächtigung |
Weitere Länder- und Bundesgesetze
Für alle Einrichtungen im Gesundheitswesen gilt die Verpflichtung eines Qualitätsmanagementsystems. Demzufolge können weitere gesetzliche Grundlagen beispielsweise aus dem Fünften Sozialgesetzbuch (Gesetzliche Krankenversicherung) § 135 a SGB V »Verpflichtung der Leistungserbringung zur Qualitätssicherung« oder des Heimgesetzes (HeimG) für Ihre Einrichtung zutreffen.
Im stationären Pflegebereich ist das Heimgesetz seit der 2006 Föderalismusreform in Deutschland Ländersache und zwischenzeitlich haben alle Bundesländer ein einsprechendes Heimgesetz. Diese tragen allerdings verschiedene Namen, z. B. »Selbstbestimmungsstärkungsgesetz« (Schleswig-Holstein) oder »Wohnteilhabegesetz« (Berlin). Bundeseinheitlich ist allerdings das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz WBVG gültig.
Bei Unklarheiten fragen Sie Ihre Pflegedienstleitung – ihr obliegt die Verantwortung. Sollten darüber hinaus noch individuelle Vereinbarungen Ihres Unternehmens mit Kostenträgern, Kooperationspartnern, öffentlichen Behörden oder anderweitige interne Vorgaben bestehen, die qualitätsmanagementrelevant sind, erfragen Sie dies ebenfalls bei Ihrer Pflegedienstleitung oder dem Träger. Aufgrund von Gesetzesänderungen und -neuerungen in den vergangenen und zukünftigen Jahren ist es überlegenswert, in welchen Abständen gedruckte Gesetzesbücher angeschafft werden sollen ( Kap. 4.7). Sie können das gedruckte Werk jeweils nutzen, um Hinweise hineinzuschreiben, Markierungen vorzunehmen und aktiv mit dem Buch zu arbeiten. Wer mit dem Computer nicht so firm ist, wird dadurch sicherlich Vorteile erkennen.
Kap. 4.7). Sie können das gedruckte Werk jeweils nutzen, um Hinweise hineinzuschreiben, Markierungen vorzunehmen und aktiv mit dem Buch zu arbeiten. Wer mit dem Computer nicht so firm ist, wird dadurch sicherlich Vorteile erkennen.
Alternativ können Sie sich die einzelnen Paragrafen ausdrucken und als Loseblatt-Sammlung in einem Ordner verwahren und bei entsprechenden Änderungen austauschen. Dies kann auch praktisch und praktikabel sein, weil Sie dann die Schriftgröße bzw. beim Druck die Seitenanpassung einstellen können, was das Lesen erleichtert und Platz für eigene Bemerkungen bietet.
Andererseits ist so ein Gesetzbuch schnell gekauft (bedenken Sie die Zeit des Ausdrucks, Lochens und Abheftens) und kostet nicht die Welt. Noch mal schnell nachschlagen, alles zusammen haben, dabei über andere interessante Texte stoßen. Was wäre ich für eine Autorin, wenn ich Ihnen von einem Buch abraten würde?! Häufig bilden sich Arbeitskreise oder -gruppen, die die entsprechenden Gesetzestexte und Expertenstandards verständlich und praxisnah aufbereiten. Dabei werden solche Fragen gestellt wie
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842691094
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Oktober)
- Schlagworte
- Altenpflege Pflegekräfte Qualitätsbeauftragte Qualitätsmanagement Qualitätssicherung