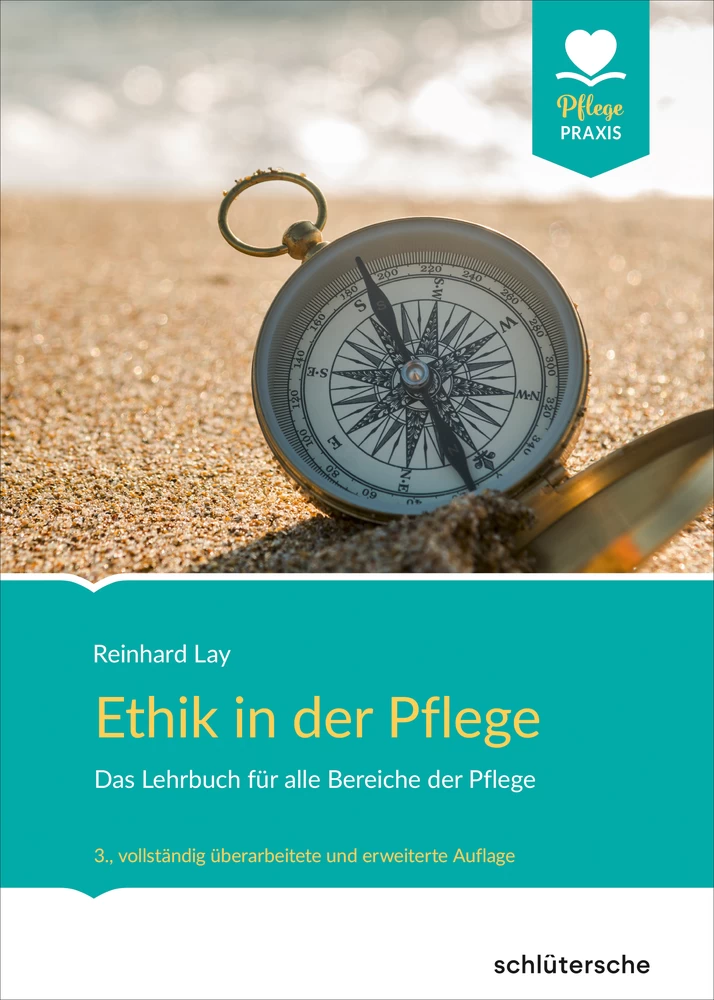Zusammenfassung
Eine ideale Arbeitsgrundlage für Praktiker, Studierende und Lehrende.
Eine unverzichtbare Lektüre für verantwortungsbewusste Pflegepraktiker.
Konflikte nehmen im Pflegealltag immer mehr Raum ein. Wie sollen Pflegende in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine gute Arbeit leisten? Was ist gute Pflege? Welche Qualität von Pflege ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen noch zu verantworten? Wo werden Grenzen verletzt?
Diese und viele andere spannende Fragen beantwortet das komplett überarbeitete und aktualisierte Standardwerk.
Pressestimmen zur 1. Auflage:
„Es ist das große Verdienst des Autors, dass er die Ethik in der Pflege gleich von allen vier relevanten Seiten angeht. Und so umfassend und systematisch deutlich macht, dass moralische Fragen in allen Bereichen eine zentrale Rolle spielen – in der Pflegepraxis wie der Pflegewissenschaft, im Pflegemanagement wie in der Pflegepädagogik. Das Buch wird hoffentlich Arbeitsgrundlage für all diejenigen sein, die Akteure in einem dieser Felder sind und dies mit erhobenem Kopf und klaren Vorstellungen von einem menschenwürdigen Leben bleiben wollen.“ Altenpflege
„Das Buch ist sehr zu empfehlen und eine fundierte Grundlage, ein wichtiges Lehrbuch für den Ethikunterricht in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.“ PsychPflege
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort zur 3., vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage
- Vorwort zur 2., aktualisierten Auflage
- Vorwort zur 1. Auflage
- 1 Zum Start
- 2 Allgemeine Ethik
- 2.1 Begriffsklärungen
- 2.1.1 Was ist Moral?
- 2.1.2 Die wichtigste Orientierung
- 2.1.3 Was ist moralische Kompetenz?
- 2.1.4 Was wertvoll ist, gut oder schlecht
- 2.1.5 Wie alles zusammenhängt
- 2.1.6 Moralische Konflikte und Dilemmata
- 2.1.7 Was ist Ethik?
- 2.2 Aufgaben der Ethik
- 2.2.1 Aufklären, Transparenz herstellen
- 2.2.2 Moral überprüfen und legitimieren
- 2.2.3 Prinzipien und Normen zur Verfügung stellen
- 2.2.4 Menschliches Handeln überprüfen
- 2.2.5 Korrektiv für die Praxis sein
- 2.2.6 Zur moralischen Kompetenz anleiten
- 2.3 Deskriptive Ethik, normative Ethik und Metaethik
- 2.4 Ethische Theorien und Positionen
- 3 Bereichsethiken
- 3.1 Kann man Ethik »anwenden«?
- 3.2 Besonderheiten von Bereichsethiken
- 3.3 Bereichsethiken etablieren sich
- 3.4 Bereichsethiken verändern sich
- 3.5 Ringen um Zuständigkeit
- 3.6 Abgrenzung zu Berufsethiken
- 3.6.1 Einteilung der Berufsethik
- 3.6.2 Regelwerke: Berufskodizes
- 3.6.3 Kritik an Berufskodizes
- 3.6.4 Unterschied zwischen Berufsethik und Bereichsethik
- 4 Ethik in der Pflege
- 4.1 Struktur der Disziplin Pflege
- 4.2 Struktur der Ethik in der Pflege
- 4.2.1 Ethik in der Pflegewissenschaft
- 4.2.2 Ethik im Pflegemanagement
- 4.2.3 Ethik in der Pflegepraxis (Pflegeethik)
- 4.2.4 Pflegerische Berufsethik
- 4.2.5 Fazit
- 4.3 Pflegeethik
- 4.3.1 Geschichtliche Entwicklung der Pflegeethik
- 4.3.2 Notwendigkeit ethischer Reflexion in der Pflege
- 4.3.3 Notwendigkeit einer eigenen Bereichsethik
- 4.3.4 Nicht frei zu moralischem Handeln?
- 4.3.5 Geltungsbereich der Pflegeethik
- 4.3.6 Maßstäbe der Pflegeethik
- 4.4 Zusammenfassung zur Ethik in der Pflege
- 4.5 Ethik in der Pflege und ihre Nachbarethiken der Medizin und der Sozialen Arbeit
- 4.5.1 Ethik in der Medizin
- 4.5.2 Ethik in der Sozialen Arbeit
- 4.5.3 Vergleich der Ethik in der Pflege mit den Bereichsethiken von Medizin und Sozialer Arbeit
- 4.5.4 Verhältnis der Medizinethik zur Ethik in der Pflege
- 5 Pflegequalität ohne Ethik?
- 5.1 Geschichte der Vorstellungen über gute Pflege
- 5.2 Konzeptionelle Ansätze zur Pflegequalität
- 5.3 Definitionen von Pflegequalität
- 5.4 Qualität gefordert – Ethik nicht erforderlich?
- 5.4.1 Unterschiedliche Pflegeverständnisse
- 5.4.2 Qualität ohne Ethik?
- 5.4.3 Ökonomisch verstandene Qualität
- 5.4.4 Qualität ist nicht wertneutral
- 5.4.5 Ist das ein moralisches Problem oder »nur ein normales«?
- 5.4.6 Qualität erfordert Ethik
- 5.5 Die Pflegebeziehung – menschlicher Beistand oder kühles Vertragsverhältnis?
- 5.6 Gute Pflege ist passende Fürsorge
- 6 Ethik im Zentrum der Pflegequalität
- 6.1 Modell der Gesundheitspflege
- 6.1.1 Selbstständigkeit und Wohlbefinden als Zieldimensionen
- 6.1.2 Eine pflegerische Definition von Gesundheit
- 6.1.3 Der Ausdruck »zufriedenstellendes Niveau«
- 6.1.4 Der Begriff der Alltagsaktivitäten (Aktivitäten des Lebens)
- 6.1.5 Definition des Pflegens
- 6.2 Integration von Pflegeethik und Pflegequalität
- 6.2.1 Wirksamkeit
- 6.2.2 Sicherheit
- 6.2.3 Wirtschaftlichkeit
- 6.2.4 Interaktion
- 6.3 Standard Pflegequalität
- 6.4 Neue Definitionen von Pflegequalität
- 6.5 Zusammenfassung
- 7 Ethische Entscheidungsfindung in der Pflege
- 7.1 Grundsätzliche Überlegungen zur ethischen Entscheidungsfindung
- 7.1.1 Begriffliche Überlegungen
- 7.1.2 Psychologische Überlegungen
- 7.2 Empfehlungen zur ethischen Entscheidungsfindung
- 7.2.1 Moralische Fragen gemeinsam beraten
- 7.2.2 Modelle zur ethischen Entscheidungsfindung
- 7.3 Modell der multiperspektivischen ethischen Entscheidungsfindung
- 7.3.1 Fallbeispiel: Zum Sterben in ein anderes Zimmer?
- 7.3.2 Schilderung des Falls
- 7.3.3 Einstieg in die Reflexion
- 7.3.4 Handlungsalternativen im Fallbeispiel
- 7.3.5 Ethische Beurteilung
- 7.3.6 Beschlussfassung – ein Votum
- 7.4 Individualethik oder Organisationsethik? Anmerkungen zur persönlichen Verantwortung
- 7.5 Grenzen von Verfahren zur ethischen Entscheidungsfindung
- 7.6 Zusammenfassung
- 8 Ethik in der Pflegepädagogik
- 8.1 Pädagogische Ethik
- 8.1.1 Einführung in die Pädagogische Ethik
- 8.1.2 Problemstellungen der Pädagogischen Ethik
- 8.1.3 Beispiel: Konstruktivistisch-systemtheoretische Didaktik
- 8.1.4 Kritik der konstruktivistisch-systemtheoretischen Didaktik
- 8.1.5 Alternativvorschlag: Handlungsorientierte Didaktik
- 8.2 Ethik lehren in der Pflege
- 8.2.1 Notwendigkeit ethischer Bildung in der Pflege
- 8.2.2 Ein Schattendasein?
- 8.2.3 Vorurteile von Pflegekräften über Ethik
- 8.2.4 Moralische Entwicklung von Menschen
- 8.2.5 Ziele ethischer Bildung in der Pflege
- 8.2.6 Inhalte ethischer Bildung in der Pflege
- 8.2.7 Methoden ethischer Bildung in der Pflege
- 8.2.8 Qualifikation der Ethik Lehrenden in der Pflegebildung
- 8.2.9 Konsequenzen ethischer Bildung in der Pflege
- 8.3 Zusammenfassung
- 9 Schlussfolgerungen und Ausblick
- Nachwort
- Verzeichnis der Definitionen
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Literatur
- Register
Vorwort zur 3., vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage
Was ist das Wichtigste in der Pflege? Welches ist das oberste moralische Prinzip? Wo zeigt sich im Pflegealltag moralisches, wo unmoralisches Handeln? Wann lohnt sich der Aufwand für umfassende und systematische Reflexionen moralischen Handelns und damit intensiveres ethisches Denken?
Dies sind nur einige der in diesem Buch bearbeiteten übergreifenden Fragestellungen. In der aktualisierten und vollständig überarbeiteten dritten Auflage vertieft der Autor die bisherigen Inhalte und ergänzt sie um neuartige Diskussionsansätze wie die Auseinandersetzung um robotische Assistenzsysteme in der Pflege, pro und contra im Hinblick auf das Konzept »Fürsorge« sowie die Reflexion der Beziehung zwischen Pflegekraft und Patientin/Patient als Bündnisbeziehung oder Vertragsverhältnis.
Das etablierte und vielzitierte Lehrbuch veranschaulicht zunächst zentrale Grundbegriffe, Konzepte und grundlegende ethische Theorien, bevor im Anschluss die »Ethik in der Pflege« als eigene Bereichsethik zwischen der Ethik der Medizin und der Ethik der Sozialen Arbeit verortet und systematisch begründet wird. Kritisch weist Herr Lay darauf hin, dass die Ethik in der Sozialen Arbeit sowohl von Seiten der Ethik in der Medizin als auch von Seiten der Ethik in der Pflege in Diskussionen kaum zur Kenntnis genommen wird. Dabei könne gerade die Ethik in der Pflege von dem überzeugenden Selbstverständnis, sich auch auf politischer Ebene für die Interessen der ihr anvertrauten Menschen einzusetzen, sehr viel lernen.
In der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen zum Thema Pflegequalität werden zunächst Aspekte der Qualitätsentwicklung in Deutschland aufgezeigt. Deutlich wird, dass Diskussionen um ethische Aspekte in diesem Zusammenhang bisher vernachlässigt zu werden scheinen. Die interessante Auseinandersetzung zur Gestaltung der Beziehung zwischen Pflegeperson und zu-pflegender Person, aber auch die Frage, inwieweit wirtschaftliches Denken im Kontext ethischer Fragestellungen überhaupt angebracht ist, ergänzen bisherige Diskussionen in diesem Bereich und weiten den Blick auf neue Fragestellungen. Im folgenden Kapitel wird Ethik als das Zentrum von Pflegequalität verstanden. Reinhard Lay betont, dass sich zentrale Konzepte in Pflegemodellen und Pflegetheorien ethisch begründen können lassen müssen. Er führt als neues Modell das Modell der Gesundheitspflege (Lay 1998) an. Dieses setzt sich aus den Komponenten 1) bewährte pflegefachliche Anliegen, 2) Elemente aus der Qualitätsdiskussion sowie 3) der Forderung nach ethischer Fundierung der Pflege zusammen. Als Ziele der Pflege werden Selbstständigkeit und Wohlbefinden definiert, die anhand theoretischer Auseinandersetzungen und zahlreicher praktischer Beispiele aus dem Pflegealltag veranschaulicht und kritisch reflektiert werden.
Die anschließenden Ausführungen zum Thema ethische Entscheidungsfindung in der Pflege greifen sowohl theoretische Hintergründe als auch unterschiedliche Modelle auf, die der Autor zu einem eigenen Modell der ethischen Entscheidungsfindung weiterentwickelt. Dieses wird Schritt für Schritt anhand eines Fallbeispiels erläutert. Das Kapitel bietet eine gelungene Überleitung zur Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen in der Pflegebildung. Der Autor bearbeitet die Frage der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen und zeigt vielfältige Möglichkeiten auf, moralisch vertretbares Handeln und ethische Reflexion zu lehren und zu lernen. Im abschließenden Kapitel werden in Form von 10 Thesen noch einmal die zentralen Themenbereiche des Buches zusammengefasst, auch werden Handlungsempfehlungen für zukünftige Auseinandersetzungen mit ethischen Fragestellungen in pflegerischen Kontexten abgeleitet.
Strukturiert und anschaulich führt Herr Lay die Leserinnen und Leser durch die aktuellen Entwicklungen der vielen Themengebiete zur Ethik in der Pflege. Besonders hervorzuheben ist die Verknüpfung von schlüssig durchdachter theoretischer Auseinandersetzung und hilfreichen praktischen Anwendungsbeispielen aus nahezu allen pflegerischen Handlungsbereichen.
Mittlerweile ein Standardwerk, stellt das umfangreiche Buch für Pflegende aller Bereiche eine Bereicherung dar:
• Für in der Pflegepraxis Tätige können gerade die Fallbeispiele dazu beitragen, theoretische Konzepte in die Praxis zu implementieren;
• Pflegemanagern und Pflegemanagerinnen können u. a. Auseinandersetzungen mit der Beziehungsgestaltung zwischen Pflegenden und Zu-Pflegenden sowie mit ethischen Aspekten im Zusammenhang mit Qualitätsmanagementsystemen und Wirtschaftlichkeit systematische Argumentationshilfen geben;
• für pädagogisch in der Pflege Tätige, aber auch für Lernende und Studierende bietet das Buch anschauliche Möglichkeiten, um sich auf Basis des alltäglichen Pflegehandelns moralischer Aspekte bewusst zu werden und zu lernen, diese systematisch ethisch zu reflektieren;
• Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden schließlich durch die Lektüre angeregt, Pflegetheorien und Modelle unter ethischen Aspekten zu reflektieren und (weiter) zu entwickeln, sowie ethische Reflexionen verstärkt in die Gestaltung von Forschung zu integrieren.
Dies sind nur einige ausgewählte Ansatzpunkte. Die Lektüre bietet zahlreiche weitere Anregungen zur Sensibilisierung für ethische Fragestellungen sowie zur systematischen Reflexion pflegerischen Handelns in den vielfältigen Arbeitsbereichen der Pflege.
Den Leserinnen und Lesern wünsche ich interessante Entdeckungen. Ich denke, dass sie in dem umfangreichen Buch wie in einer Schatzkiste viele schöne Stücke für sich finden werden – bekannte und neue, bereichernde und überraschende.
Prof. Dr. Katja Makowsky
Fachhochschule Bielefeld
Professorin für Pflege- und Gesundheitswissenschaften
Mitglied der Leitlinienkommission und stellvertretende Vorsitzende der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft
Vorwort zur 2., aktualisierten Auflage
Parallel zur zunehmenden Ökonomisierung der Pflege war in den vergangenen Jahren ein Boom an Fachliteratur zu ethischen Fragen in der Pflege zu beobachten. Zahlreiche Bücher und Beiträge in Fachzeitschriften bearbeiteten pflegeethische Themen und viele nahmen dabei auch Gedanken aus der vorigen Auflage dieses Lehrbuchs auf.
Da die erste Auflage innerhalb weniger Jahre vergriffen war, begann schon bald die Arbeit an der Präzisierung und Aktualisierung des Textes. Die Neuauflage gibt einen Überblick zur Diskussion über ethische Themen in der Pflege und bietet Orientierungs- und Argumentationshilfen für ethische Auseinandersetzungen an. Praktische Beispiele aus dem Pflegealltag, vertiefende Erläuterungen und weiterführende Hinweise sollen es den Leserinnen und Lesern ermöglichen, sich selbst eine fundierte Meinung bilden und ihr Handeln sicher begründen zu können.
An ethischen Fragen zu arbeiten, ist immer wieder eine neue Herausforderung. Das Thema »Ethik in der Pflege« ist komplex und unerschöpflich. Kritische Menschen kann es Tag und Nacht beschäftigen und sie im steten Prozess des Nachfragens und Zweifelns allerdings auch persönlich wachsen lassen.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich interessante Entdeckungen und viele Anregungen zur eigenen kritischen Reflexion. Über Rückmeldungen freue ich mich und hoffe auf wertvolle Hinweise zur Optimierung des Lehrbuchs.
Vorwort zur 1. Auflage
Welche Pflege können wir verantworten? Darf man beispielsweise einen sterbenden Menschen in ein anderes Zimmer verlegen, weil für einen Privatpatienten ein Einzelzimmer benötigt wird? Wie sollen sich Pflegende gegenüber ärztlichen Anordnungen verhalten, die aus ihrer Sicht fragwürdig sind?
Dies sind nur einige Fragen und Problemstellungen, mit denen sich die Ethik in der Pflege beschäftigt. Ihr Anliegen ist nicht die Propagierung einer neuen Moral, sondern die kritische Reflexion dessen, was in der Pflege geschieht. Eine Ethik in der Pflege schreibt nicht vor, wie man sich in schwierigen Situationen verhalten soll, aber sie gibt Orientierungen, mit deren Hilfe das eigene Handeln überprüft und ggf. geändert werden kann.
Mit dem Buch von Herrn Lay liegt zum ersten Mal ein deutschsprachiges Werk vor, welches grundlegend und umfassend in ethische Fragen in der Pflege einführt. Dabei werden alle vier Handlungsfelder der Disziplin Pflege angesprochen: Pflegepraxis, Pflegepädagogik, Pflegemanagement und Pflegewissenschaft.
Zwar liegen für die Pflegepraxis bereits diverse Einführungen vor; die Darstellungen sind jedoch häufig ausschließlich auf den Krankenhausbereich begrenzt und bieten keine Übersicht zum aktuellen Stand der Diskussion in Deutschland. Für die verantwortliche Arbeit im Pflegealltag gibt das vorliegende Buch wertvolle Hilfestellungen. Pflegemanagern hilft es ebenfalls weiter – berücksichtigt die Qualitätssicherungsund Qualitätsmanagementdiskussion in Deutschland ethische Problemstellungen bisher doch nur am Rande. Auch für Lehrende in der pflegerischen Aus-, Fort- und Weiterbildung ist das Buch eine Fundgrube, denn Ausführungen zur pädagogischen Ethik, zur Vermittlung ethischer Kompetenz und zur Kritik gängiger Didaktiken aus ethischer Perspektive fehlen in der bisherigen Diskussion nahezu vollständig. Nicht zuletzt die Pflegewissenschaft kann einen Gewinn aus der vorliegenden Arbeit ziehen, denn Forschung ist immer auch mit ethischen Herausforderungen konfrontiert. Interessant sind auch Herrn Lays Begründungen, warum es denn eigentlich eine »Ethik in der Pflege« als Bereichsethik geben muss und die allgemeine Ethik nicht ausreicht. Aber es soll noch nicht zu viel verraten werden.
Wie ist das Buch aufgebaut? Herr Lay gibt zu Beginn einen Einblick in relevante Begriffe und Kategorien der »Allgemeinen Ethik« (Moral, Moralität, moralische Kompetenz, Werte und Güter, moralische Konflikte, Ethik) und verhandelt danach unter dem Titel »Bereichsethiken« Aspekte der Ethik in Medizin und Sozialer Arbeit. Diese beiden Kapitel bilden eine Grundlage für die fundierte Begründung einer eigenen Bereichsethik in der Pflege. Die folgenden Kapitel stellen die Verbindung von Pflegequalität und Ethik ins Zentrum und enden mit einem Modell der Integration beider sowie mit zwei neuen Definitionen von Pflegequalität.
Hervorzuheben ist ein darauf folgendes ausführliches Fallbeispiel, welches den Prozess der ethischen Entscheidungsfindung in der Pflege anschaulich illustriert. Die transparente Argumentationsführung schließt mit einer Positionierung des Autors und macht sich damit der Kritik zugänglich. Das letzte große Kapitel setzt sich grundlegend mit der »Ethik in der Pflegepädagogik« auseinander, kritisiert den konstruktivistisch-systemtheoretischen Ansatz und beschreibt verschiedene Formen des Lehrens einer Ethik in der Pflege. Die Arbeit schließt mit einer thesenartigen Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und einem Ausblick auf den zukünftigen Forschungsbedarf.
Die von Herrn Lay vorgelegte Arbeit wurde zunächst als Diplomarbeit am Fachbereich Pflege der Katholischen Fachhochschule Freiburg eingereicht. Nicht nur durch ihren Umfang, sondern vor allem auf Grund ihrer umfassenden Bearbeitung der Literatur sowie der hohen Qualität der Argumentation ist die Arbeit außergewöhnlich. Mit der Integration von Pflegeethik und Pflegequalität betritt der Autor Neuland und es werden fruchtbare Anstöße für die Qualitätsdiskussion geliefert. Die argumentative Abwägung von Handlungsalternativen im Fallbeispiel: »Zum Sterben in ein anderes Zimmer!?« ist exemplarisch und unmittelbar für die Alltagsrealität der Pflege relevant. Mustergültig wird hier eine ethische Argumentation – und eben kein moralisierendes Raunen – vorgestellt und abschließend die eigene Position offen gelegt.
Die Anmerkungen zur in Mode gekommenen konstruktivistisch-systemtheoretischen Didaktik in der Pflege sind ebenfalls hervorragend. Es ist wirklich erstaunlich, welche Konjunktur dieser Ansatz auch in der Pflegepädagogik erfahren hat. Obwohl die Pflege sonst naturwissenschaftlichen Ansätzen und Paradigmen kritisch gegenübersteht, werden sie in der Pflegepädagogik fast gläubig übernommen und das ethische Defizit dieser Ansätze völlig ignoriert. Der Autor weist auf diese Problematik explizit hin und leistet damit auch einen kritischen Beitrag zum aktuellen pflegepädagogischen Diskurs.
Ich wünsche dem Buch eine breite Aufnahme – nicht nur in der Fachöffentlichkeit. Jedem, der sich mit Pflege beschäftigt und kritischen Fragen in den Handlungsfeldern nicht ausweichen möchte, sei die Lektüre des Buches empfohlen.
Prof. Dr. Hermann Brandenburg
Prodekan und Inhaber des Lehrstuhls für Gerontologische Pflege an der pflegewissenschaftlichen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar
Pflege ist eine lebenswichtige menschliche Hilfe – und ein wunderbarer Beruf. Als jemand, der in der Pflege 11 Jahre »am Bett« gearbeitet hat, bin ich davon überzeugt.
Menschen zu pflegen, bietet zahlreiche Möglichkeiten, in positiver Weise Einfluss zu nehmen. Obwohl die beruflichen Rahmenbedingungen dringend reformbedürftig sind, können Pflegende im Leben ihrer Mitmenschen viel Gutes bewirken: Pflegekräfte arbeiten in einem unverzichtbaren Gesundheitsberuf.
Außerdem ist Pflege ein ungewöhnlich lehrreicher Beruf. In welchem anderen Beruf ist es möglich, so viele wertvolle Erfahrungen für das eigene Leben zu sammeln?
Über Pflege nachzudenken und zu sprechen, ist eine sehr persönliche Angelegenheit, gerade wenn es um die Frage geht, welche Überzeugungen und Werte in der Pflege besonders wichtig sind. Ethik in der Pflege erfordert vernünftiges Denken und sachliche Begründungen. Gleichzeitig geht es um Offenheit für Gefühle und um die Fähigkeit, sich einfühlsam in die Lebenssituation anderer Menschen versetzen zu können.
Persönliche Ansichten beeinflussen ethische Auseinandersetzungen. Ethische Reflexion geschieht nicht in steriler Objektivität. Die Leserinnen und Leser2 bitte ich deshalb um Verständnis für die ungewöhnliche Verwendung der Ich-Perspektive. Für dieses Lehrbuch fände ich es unpassend, Ausdrücke wie »Der Verfasser hält folgende Argumente für stichhaltig …« zu verwenden. Derlei Distanzierungskonventionen machen einen wissenschaftlichen Text nicht objektiver als die einfache Formulierung »Ich bin der Überzeugung, dass …, und zwar aus folgenden Gründen: …«.
Lassen Sie mich deshalb in der persönlichen Form fortfahren. Sie werden feststellen, dass mein berufliches Herz leidenschaftlich für Pflege schlägt und dass ich auf diesem Erfahrungshintergrund schreibe. In meinem beruflichen Werdegang übernahm ich in der Pflege unterschiedliche Rollen, die meine Wahrnehmung und damit auch den Inhalt dieses Buches prägten: Praktikant, Pflegehelfer, Pflegeauszubildender, Krankenpfleger, Praxisanleiter, Stationsleiter, Student, Autor, Lehrbeauftragter, Lehrer und schließlich Schulleiter.
Viele Gedanken entstanden in meiner Rolle als Dozent und Berater. Fortbildungen und Projekte in mehr als 100 Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten ermöglichten es mir, unterschiedliche Kulturen innerhalb der Pflege kennenzulernen. Was ich dabei erlebte, machte deutlich: Überall in der Pflege denken Menschen ernsthaft darüber nach, wie sie ihre Arbeit mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Sie diskutieren miteinander, was ihnen wichtig ist und tauschen sich darüber aus, wo für sie persönlich Grenzen überschritten werden.
Pflege scheint durch und durch mit ethischen Überlegungen verwoben zu sein – ist das nicht eine faszinierende Erfahrung? Bei Ethik in der Pflege geht es vorwiegend um die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen in der praktischen Pflege von Menschen. Außerdem stellen sich moralische Fragen im Pflegemanagement, in der Pflegepädagogik und in der Pflegewissenschaft.
Ethik in der Pflege ist ein unerschöpfliches Thema, weil es alle Situationen in Pflegepraxis, Pflegepädagogik, Pflegemanagement und Pflegewissenschaft betreffen kann. Außerdem haben wir es mit einem konfliktreichen Gebiet zu tun, weil Ethik unser Handeln in Frage stellt. Statt sicher geglaubte Erkenntnisse und Gewohnheiten zu bestätigen, ruft Ethik mitunter Verunsicherung hervor.
Viele Pflegende empfinden es in ihrer täglichen Arbeit als große Herausforderung, in schwierigen Situationen verantwortbare Entscheidungen zu treffen. Das vorliegende Buch soll in den vielfältigen Fragen um Ethik in der Pflege Klarheit schaffen und praktische Orientierungshilfen bieten.
Ethik in der Pflege wird von vielen Seiten kontrovers bearbeitet – Pflegewissenschaftler, Pflegefachkräfte, Philosophen, Theologen, Psychologen und Ärzte beschäftigen sich mit ethischen Problemstellungen in der Pflege. Je nach Erfahrungshorizont der Autoren finden sich in der Literatur unterschiedliche Auffassungen zu moralischen und ethischen Fragen in der Pflege.
Dieses Buch wendet sich an kritische und suchende Menschen aus der Pflege, ob sie nun als Pflegende sehr an praktischen Fragen interessiert sind oder sich in Aus-, Fort- und Weiterbildung, in einem Studium oder in Lehre bzw. Unterricht engagieren. Es eignet sich für Pflegemanager und Pflegewissenschaftler, um ihre ethischen Kenntnisse zu vertiefen und sie in die kontroversen Diskussionen um Ethik in der Pflege einbringen zu können. Auch Angehörige benachbarter Disziplinen wie etwa Soziale Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie, Gerontologie, Ökonomie und Philosophie können in dieser Arbeit wertvolle Anregungen finden und – so hoffe ich – einen vertieften Einblick in das Wesen von Pflege gewinnen.
Wie ist das Buch aufgebaut? Grundsätzlich empfehle ich, den Gang der Argumentationen in der vorgegebenen Reihenfolge mitzuverfolgen. Auf diese Weise lässt sich ein fundierter Überblick zum aktuellen Stand der Fachdiskussionen um Ethik in der Pflege gewinnen.
Selbstverständlich ist das Lehrbuch auch als Nachschlagewerk verwendbar. Wer sich ausschließlich für spezielle Fragen interessiert, kann das Inhaltsverzeichnis, das umfangreiche Stichwortverzeichnis oder das Verzeichnis der Definitionen nutzen und gezielt einzelne Themen auswählen.
Mir ist es wichtig, dass die Leser wichtige Auseinandersetzungen unmittelbar nachvollziehen können. Zu diesem Zweck arbeite ich mit zahlreichen Originalzitaten. Zugegebenermaßen erschweren die wörtlichen Zitate die Lektüre zunächst etwas; sie ermöglichen es jedoch, die Kontroversen um Ethik in der Pflege besonders nah und authentisch mitzuerleben.
Die vorliegende Einleitung bildet Kapitel 1. In einem zweiten Teil (Kapitel 2: Allgemeine Ethik) werden Grundlagen einer allgemeinen Ethik erläutert. So sollen zunächst Begriffe wie Moral, Moralität, moralische Kompetenz, Werte, Güter und Übel geklärt werden, um danach ihre Zusammenhänge herauszuarbeiten. Erläuterungen zu den Aufgaben und Funktionen der Ethik schließen diesen allgemeinen Teil mit einem ersten Blick auf grundlegende ethische Theorien ab.
Der dritte Teil (Kapitel 3: Bereichsethiken) widmet sich der angewandten Ethik und unterscheidet zwischen Bereichsethiken und Berufsethiken. Ethik in der Pflege wird als eine Bereichsethik herausgearbeitet, die unter dem Dach einer Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen zwischen der Ethik in der Medizin und der Ethik im Sozialwesen zu verorten ist.
Kapitel 4 fokussiert die besondere Lage der Ethik in der Pflege als einer neuen Bereichsethik im Gesundheits- und Sozialwesen. Zunächst wird die Struktur der Disziplin Pflege beschrieben. Daraus leitet sich die Struktur der Ethik in der Pflege ab. Ausgehend von der geschichtlichen Entwicklung dieser Ethik stelle ich die Frage nach der Notwendigkeit ethischer Reflexion in der Pflege und ihrer Konstituierung als eigene Bereichsethik. Wir denken über die These nach, Ethik sei mangels beruflicher Autonomie nicht frei zu moralischem Handeln und konkretisieren anschließend die Maßstäbe und Geltungsbereiche der Pflegeethik. Am Schluss des Kapitels wird die Ethik in der Pflege mit der Ethik in der Medizin und der Ethik in der Sozialen Arbeit verglichen.
Pflegequalität ohne Ethik? Dieser Frage gehe ich in Kapitel 5 nach. Zunächst soll die Geschichte der Vorstellungen von Qualität in der Pflege betrachtet werden, um dann einzelne Modelle und Definitionen zu vergleichen. Handelt es sich bei Pflege um ein zwischenmenschliches Bündnis oder um ein vertragliches Dienstleistungsverhältnis? Wie gelingt Fürsorge ohne Bevormundung oder Selbstaufgabe? Aus der Auseinandersetzung mit diesen Fragen wird die Einsicht formuliert, dass Vorgaben zur Pflegequalität unbedingt eine ethische Fundierung brauchen.
Kapitel 6 stellt eine Verknüpfung von Qualität und Ethik in der Pflege vor: Pflegeethik als zentrale Komponente von Pflegequalität. Die Zusammenhänge zwischen Qualitätsvorstellungen und moralischen Forderungen an eine »gute« Pflege sollen anhand eines neuen Pflegemodells praxisnah beleuchtet werden. Aus einer integrativen Perspektive entwickeln sich zwei neue Definitionen von Pflegequalität.
Nachdem die wesentlichen Aspekte einer Ethik in der Pflege aufgewiesen sind, werde ich in dem sich anschließenden Kapitel 7 (Ethische Entscheidungsfindung in der Pflege) praktische Überlegungen zur ethischen Urteilsfindung anstellen und anhand eines Fallbeispiels den möglichen Gang einer systematischen Entscheidungsfindung in der Pflege detailliert erläutern.
In Kapitel 8 (Ethik in der Pflegepädagogik) gehe ich auf die pädagogischen Aspekte einer Ethik in der Pflege ein und stelle eine Verbindung zur Pädagogischen Ethik als einer wichtigen Bezugsethik der Pflegepädagogik her. Praktische Erfahrungen und methodische Vorschläge, wie Ethik verantwortungsbewusst gelehrt werden kann, runden das Kapitel ab.
Zusammenfassung und Ausblick schließen die Arbeit in Kapitel 9. Im Anhang finden sich umfangreiche Verzeichnisse der verwendeten Definitionen, Abkürzungen, Tabellen, Abbildungen, Quellen sowie häufiger Stichworte.
Nun wünsche ich Ihnen schöne Erlebnisse beim angeregten Stöbern, kreativen Durchdenken, kritischen Hinterfragen, erstaunten Entdecken und lebhaften Diskutieren.
_____________
2 Lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwende ich im weiteren Verlauf des Buches vorwiegend die männliche Form. Nichtsdestoweniger beziehen sich Personenbezeichnungen gleichermaßen auf Angehörige des männlichen und weiblichen Geschlechts sowie auf Menschen, die sich keinem oder keinem einzelnen Geschlecht zugehörig fühlen.

Einige Leser, die in erster Linie an praktischen Fragen der Ethik interessiert sind, mögen das Grundlagenkapitel zur Allgemeinen Ethik, vielleicht auch die Kapitel 3 (Bereichsethiken) und 4 (Ethik in der Pflege) »theoretisch« oder »trocken« finden. Ihnen empfehle ich, zunächst mit den praktischen Kapiteln 5 (Pflegequalität ohne Ethik?) ( Kap. 5) oder 6 (Ethik im Zentrum der Pflegequalität) (
Kap. 5) oder 6 (Ethik im Zentrum der Pflegequalität) ( Kap. 6) fortzufahren. Wer sich allerdings für die Hintergründe der praktischen Arbeit in der Pflege interessiert, wird gebeten, einfach weiterzulesen.
Kap. 6) fortzufahren. Wer sich allerdings für die Hintergründe der praktischen Arbeit in der Pflege interessiert, wird gebeten, einfach weiterzulesen.
Philosophische Ethik gliedert sich in allgemeine Ethik und angewandte Ethik. Zu Beginn werde ich grundlegende Begriffe der allgemeinen Ethik erläutern. Anschließend führe ich in die Ziele, Aufgaben und Funktionen der Ethik ein ( Kap. 2.2) und gebe eine kurze Übersicht zu verschiedenen ethischen Theorien und Positionen (
Kap. 2.2) und gebe eine kurze Übersicht zu verschiedenen ethischen Theorien und Positionen ( Kap. 2.3). Damit der Bezug zum pflegerischen Alltag deutlich wird, veranschauliche ich die theoretischen Themen mit praktischen Beispielen aus dem Pflegealltag.
Kap. 2.3). Damit der Bezug zum pflegerischen Alltag deutlich wird, veranschauliche ich die theoretischen Themen mit praktischen Beispielen aus dem Pflegealltag.
2.1 Begriffsklärungen
In schwierigen Situationen suchen Menschen nach Eindeutigkeit. In der Ethik finden sich aber keine einheitlichen Definitionen – ethische Begriffe werden in unterschiedlichen Bedeutungsvarianten verwendet. In diesem Kapitel sollen deshalb Gemeinsamkeiten wichtiger Begriffsdefinitionen herausgeschält und in prägnanter Form dargestellt werden. Wir beginnen mit dem Hauptbegriff der Ethik: Moral.
2.1.1 Was ist Moral?
Moral3 ist ein Regelwerk aus geschriebenen und ungeschriebenen Üblichkeiten. Mit dem etwas altertümlichen Begriff Moral sind Wertvorstellungen und Verhaltensregeln gemeint, die von Menschen als gültig erachtet werden oder zumindest Geltung beanspruchen. Moral umfasst einerseits
• die vorgegebenen Werte (z. B. Patientensicherheit) und Normen4 (Vorgaben zur Verwirklichung von Werten, z. B. die Hygienestandards eines Pflegeheims) und andererseits
• die im Alltag tatsächlich etablierten Gewohnheiten (z. B. das übliche Vorgehen beim schnellen Verbandwechsel unter großem Zeitdruck).
Bestimmte Moralen kennzeichnen unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen (z. B. Berufe) und Kulturen (z. B. Rehabilitationsmedizin oder Palliativpflege). »Eine Moral ist der Inbegriff jener Normen und Werte, die durch gemeinsame Anerkennung als verbindlich gesetzt worden sind und in der Form von
• Geboten (Du sollst …; es ist deine Pflicht, …) oder
• Verboten (Du sollst nicht …)
an die Gemeinschaft der Handelnden appellieren« (Pieper 2000:32).
Gruppen und Organisationen haben unterschiedliche Moralen. Eine Pflegekraft, die den Arbeitgeber oder das Arbeitsgebiet wechselt, wird an ihrem neuen Arbeitsplatz nicht dieselben Regeln und Gewohnheiten vorfinden. Sie muss sich erst einmal orientieren, »… wie das hier so läuft«. Jede Moral ist »… immer eine Gruppenmoral, deren Geltung nicht ohne weiteres über die Mitglieder der Gruppe hinaus ausgedehnt werden kann« (Pieper ebd.).
Moral zeigt sich auf unterschiedlichen sozialen Ebenen (vgl. Arn 2009:129): als persönliche Moral (meine eigenen Überzeugungen), auf der Ebene von Organisationen bzw. Institutionen (z. B. Vorschriften in einer Einrichtung für behinderte Menschen), in mehr oder weniger abgeschlossenen Teilen der Gesellschaft (Subkulturen, z. B. Vorstellungen politischer Parteien zur angemessenen Ausbildung und Bezahlung von Pflegepersonal) sowie auf der Ebene der Gesamtgesellschaft (z. B. Stellenwert von Gesundheit und Wirtschaft in Pandemiezeiten). Kemetmüller fasst zusammen: »Moral kann als die Summe der geschriebenen und ungeschriebenen Werte und Normen einer Gesellschaft, Kultur, Gruppe oder einer Einzelperson definiert werden.« (Kemetmüller 2013:33)
Überall Moral?
Kann man ohne Moral miteinander leben oder zusammenarbeiten? »Weil moralische Überzeugungen in der Erziehung und in der Sozialisation erworben werden, ist es nicht möglich, keine Moral zu besitzen. Im Gegenteil: Jeder Mensch besitzt moralische Einstellungen.« (Lay 2015:66) Entsprechend gibt es keine Gruppen ohne Moral, auch nicht in der Pflege. »In jeder Lebenspraxis besteht ein Moralsystem. So kann z. B. auf einer Station das Zu-spät-zum-Dienst-kommen grundsätzlich toleriert oder aber missbilligt werden, wenngleich es konkret situativ und personbezogen differenziert wird.« (Heffels 2008:20)
Wozu brauchen wir Moral?
Wenn es keine Pflege ohne moralische Vorstellungen geben kann, könnte man fragen: Welchen Nutzen haben Menschen von Moral? Profitieren beispielsweise Bewohner davon, dass in ihrem Pflegeheim eine bestimmte Moral vorherrscht?
Wozu dient Moral? Sie ist eine notwendige Einrichtung der Gesellschaft, um …
• … für das übliche, häufig unreflektierte Alltagshandeln Orientierung zu haben (Hofmann 1995b:36),
• … ein gelingendes Zusammenleben zu gewährleisten,
• … das Verhältnis und den Umgang untereinander zu ordnen (Hofmann 1995a:445),
• … eine gerechte Verteilung von Gütern und Lebenschancen zu fördern,
• … Konflikten vorzubeugen oder sie zu regeln,
• … Lebensqualität zu sichern (Lay 2001:7; 2015:67; vgl. Eid 1994b:157),
• … kulturell oder religiös bewährte Werthaltungen weiterzugeben,
• … das oberste Moralprinzip zu verwirklichen (wichtigste moralische Orientierung;  Kap. 2.1.2).
Kap. 2.1.2).
Moralen konkurrieren miteinander
Wo Menschen miteinander zu tun haben, treffen unterschiedliche moralische Vorstellungen aufeinander. Im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen (z. B. Pluralismus, Globalisierung, Migration, Digitalisierung) stehen ältere und neuere Wertvorstellungen zunehmend im Wettbewerb um Akzeptanz und Zustimmung. Auch innerhalb scheinbar homogener Gruppen sind Konflikte um moralische Auffassungen an der Tagesordnung, ja sogar Individuen erleben überraschende Konflikte mit sich selbst, wenn sie in verschiedenen Rollen unterschiedlichen Interessen gerecht werden wollen. »Genau betrachtet, verfügen Menschen als Mitglieder unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen gleichzeitig über mehrere Moralvorstellungen.« (Lay 2015:66)
Je stärker alltägliche Abläufe verinnerlicht sind, desto wichtiger wird es, sie kritisch zu hinterfragen. Die Krankenschwester und Philosophin Irmgard Hofmann empfiehlt: »Verantwortliches Handeln im Sinne ethisch begründeten Handelns bedeutet daher, daß Pflegende immer wieder einmal einzelne Routineabläufe in Frage stellen und darüber nachdenken sollten, ob das praktizierte Handeln und/oder Unterlassen den betroffenen Menschen eigentlich noch gerecht wird.« (Hofmann 1995a:445) Müssen im Pflegeheim beispielsweise die Betten aller Bewohner gemacht sein, bis der Essenswagen mit dem Frühstück aus der Küche kommt? Müssen alle Patienten im Krankenhaus »… vor acht Uhr gewaschen sein, weil dann ja schon wieder die Röntgenabteilung einzelne Patienten anfordert« (Rux-Haase 1999:694)? Müssen Patienten routinemäßig ein (hinten offenes) Klinikhemd statt des eigenen Schlafanzugs tragen, obwohl sich viele dadurch in ihrer Bewegungsfreiheit im Bett wie außerhalb des Bettes eingeschränkt fühlen (Bobbert 2003:82)?
Die Pflegeprofessorin Astrid Elsbernd fordert zur kritischen Reflexion von Routinen auf: »In der Organisation Krankenhaus findet man eine Vielzahl von Regeln, die oft nur mit einer unzureichenden Begründung angeordnet werden, deren Befolgung aber in der Regel selten in Frage gestellt wird. So richtet sich der Pflegedienst nach zum Teil unsinnigen Essenszeiten der Patienten oder auch Visitenzeiten der Ärzte und versucht, seine Tätigkeit in einen Zeitplan einzuordnen, der für die pflegerische Handlung oft nur wenig Sinn macht.« (Elsbernd 1994:113)
Ludger Risse berichtet von einem Erlebnis im Krankenhaus: »Auf meine Frage, warum täglich zwischen 9 und 11 Uhr bei allen Patienten auf der Station Fieber und Pulsfrequenz gemessen, dafür aber Lagerungswechsel, Zwischenmahlzeiten und atemfördernde Maßnahmen regelmäßig vergessen würden, bekam ich von der Stationsleitung folgende Antwort: ›Dies machen wir, weil unser Chef (Chefarzt) möchte, daß zur Visite die aktuellen Werte eingetragen sind‹.« (Risse 1997:20)
Derartige Routineabläufe in Pflege und Behandlung sind nicht allein aus wirtschaftlichen Gründen fragwürdig, sondern auch aus ethischen Überlegungen kritisch zu überprüfen. »Das ›normale‹ Verhalten im pflegerischen und medizinischen Alltag – wie etwa auch der ›normale‹ Umgang mit Sterbenden und Verstorbenen im Krankenhaus – kann unter Umständen höchst fragwürdig sein. (…) Das Normale ist eben nicht immer auch das Richtige. Viele Praktiken und Maximen der Alltagspraxis mögen faktisch ziemlich unstrittig sein und können sich bei näherer kritischer Betrachtung doch als ziemlich kritikbedürftig erweisen.« (Rehbock 2005a:215f)
»[Moralen] sind nicht nur kulturell verschieden, sondern Individuen ändern im Laufe des Lebens ihre Moral.« (Lay 2015:66) Wenn etwa eine Fachpflegekraft einer chirurgischen Intensivstation nach jahrzehntelanger Erfahrung in der kurativen Hightech-Medizin und -Pflege beschließt, in einem Hospiz zu arbeiten, kann das daran liegen, dass ihre im Laufe der Zeit veränderte Einstellung nicht mehr zum bisherigen Arbeitsgebiet passt.
Pflegekräfte kennen das Phänomen, dass Stationen oder Wohnbereiche im Laufe der Zeit ihre Kultur verändern. Je nachdem, welche Menschen dort arbeiten und/oder gepflegt werden und wie etwa die Vorgesetzten denken, ändern sich das Arbeitsklima, die Gewohnheiten, die Regeln für die Arbeitsabläufe, die Wertvorstellungen – kurz: die Moral wechselt. Insbesondere nach einem Trägerwechsel sind Veränderungen zu beobachten.
»Sittliche Gewohnheiten und Werthaltungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bei einem Individuum oder in einer Gruppe/Organisation üblich sind, unterliegen gesellschaftlichen Veränderungen. So wie Werte und Normen kultur- und erziehungsabhängig sind, sich zwischen Menschen unterscheiden und in der Lebensspanne variieren, so verändern sich moralische Vorstellungen im Laufe sozialer und beruflicher Entwicklungen auch im Gesundheitswesen.« (Lay & Needham 2022) Beispielsweise können Vorstellungen von menschenwürdiger Betreuung im Laufe der Geschichte wechseln. »Noch vor einigen Jahrzehnten galten hier zu Lande Mehrbettzimmer für vier bis zehn Pflegeheimbewohner als angemessen – heute wird dem Einzelnen bei uns weitaus mehr Privatsphäre zugebilligt, wohingegen in anderen Kulturkreisen und in wirtschaftlich schwächeren Ländern Einzelzimmer noch immer als Luxus gelten.« (Lay 2015:66)
Definition Moral
Moral ist die Summe der Werte und Normen, die zu einer bestimmten Zeit für Individuen oder in sozialen Gebilden (z. B. Partnerschaft, Gruppe oder Gesellschaft) gelten (vgl. Lay 2015:66; 2021:61).
Berufe sind Spiegelbilder gesellschaftlicher Wertvorstellungen – gleichzeitig haben sie selbst Anteil an der Bestätigung oder Veränderung von Moral. Die von ihnen vertretenen Berufsmoralen ( Kap. 3.1) bestehen aus offiziellen Schriftstücken (Berufskodex) und impliziten, informellen Regeln (Berufsethos).
Kap. 3.1) bestehen aus offiziellen Schriftstücken (Berufskodex) und impliziten, informellen Regeln (Berufsethos).
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842690660
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Mai)
- Schlagworte
- Altenpflege Altenpflegeausbildung Ambulante Pflegedienste Ethik Ethikunterricht Krankenpflege Krankenpflegeausbildung Menschenwürde Palliativpflege Patientenverfügung Pflegebedürftigkeit Pflegemanagement Pflegepädagogik Pflegepraxis