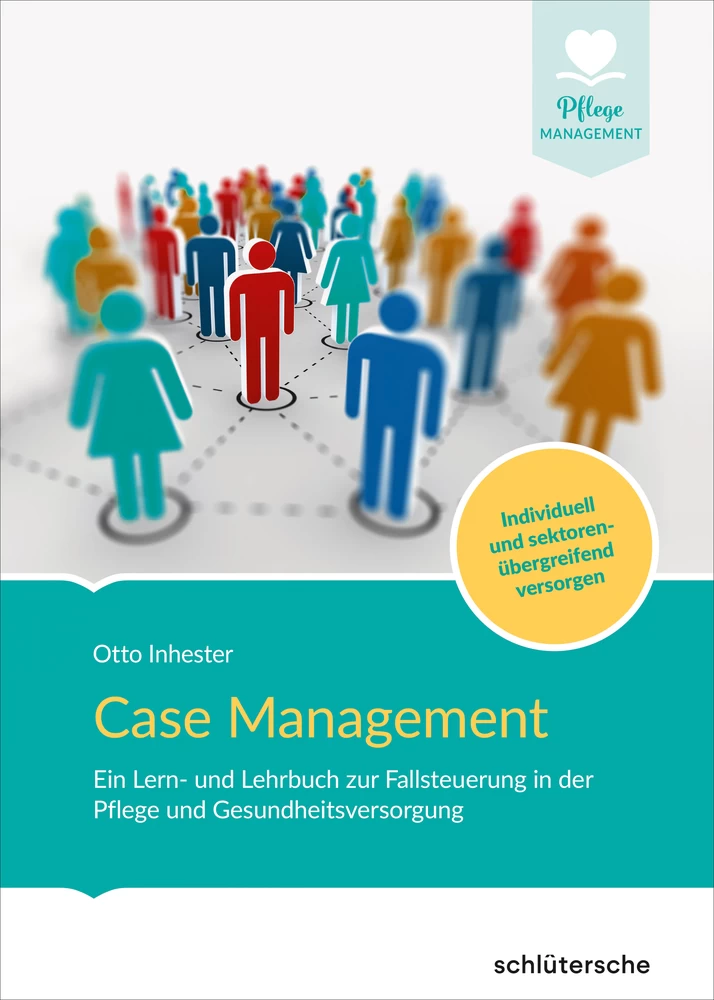Case Management
Ein Lern- und Lehrbuch zur Fallsteuerung in der Pflege und Gesundheitsversorgung. Individuell und sektoren-übergreifend versorgen
Zusammenfassung
Herausforderungen ausgesetzt. Um im Spannungsfeld
von Klient – Organisation – Leistungsprozess
– Kostenträger möglichst effiziente Hilfen zu organisieren,
müssen sie den Case Management-Prozess sicher
beherrschen. Anhand zahlreicher Beispiele und
Übungen führt dieses Werk Schritt für Schritt in die
Handlungslogik des Case Management ein und erleichtert
den Transfer in das jeweilige eigene Arbeitsfeld.
Behandelt werden Fälle aus der Langzeitversorgung
(besonders bei chronischen Erkrankungen, in der Altenhilfe
und der Kurzeitpflege), dem Entlassungsmanagement,
in der ambulanten Versorgung, in der Reha, in
der psychiatrischen Versorgung, bei technikabhängigen
Klient*innen in der Häuslichkeit, bei der palliativen
Versorgung und im Quartiersmanagement.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- 1 Einleitung
- 1.1 Aufbau des Lern- und Lehrbuchs
- 1.1.1 Gesellschaftliche, ökonomische und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen und ihre Bedeutung für das Case Management
- 1.1.2 Theoretische Grundlagen des Case Managements
- 1.1.3 Gestaltung und Umsetzung der Handlungs- bzw. Prozessstruktur des Case Managements
- 1.1.4 Spezifische methodisch-persönliche Kompetenzen und Rollenklarheit
- 2 Case Management – Was ist es und wozu benötigt man es?
- 2.1 Generelle Aufgaben im Case Management
- 2.2 Leitfragen des Case Management-Prozesses
- 2.3 CM als persönliche soziale Dienstleistung
- 2.3.1 Das Uno-actu-Prinzip
- 2.3.2 Die Notwendigkeit der Kundenpräsenz
- 2.3.3 Die Integration des externen Faktors in den Dienstleistungsprozess
- 2.3.4 Die Immaterialität der Dienstleistung
- 2.3.5 Die Bedarfsorientierung und die geringe Standardisierbarkeit
- 2.3.6 Die existenzielle Bedeutung
- 2.4 Case Management als persönliche soziale Dienstleistung
- 3 Case Manager*in – didaktische Anmerkungen
- 3.1 Lernziel: situations- und falladäquate Ausgestaltung des Case Management Prozesses
- 3.1.1 Rollenspiele vorbereiten – so geht‘s
- 3.2 Lernziel: Haltungen und Rollenklarheit
- 3.2.1 Gatekeeper
- 3.2.2 Broker (Beauftragter, Vermittler, Makler, Agent)
- 3.2.3 Advokat (anwaltliche Funktion, Beistandsfunktion)
- 3.2.4 Supportfunktion (Unterstützer)
- 4 Zentrale Themen des Case Managements
- 4.1 Krise
- 4.1.1 Krankheit als Krisenauslöser
- 4.1.2 Chronische Erkrankungen
- 4.1.3 Behinderung
- 4.2 Das Trajektmodell
- 4.3 Schnittstellen
- 4.3.1 Sozialversicherungsrechtliche Schnittstellen
- 4.3.2 Transitorische Schnittstellen
- 4.3.3 Merkantile Schnittstellen
- 4.3.4 Operative Schnittstellen
- 4.4 Schnittstellenmanagement
- 4.5 Grundlagen der Netzwerkarbeit
- 4.5.1 Fallabhängige Netzwerke
- 4.5.2 Fallunabhängige Netzwerke und Systemsteuerung
- 4.5.3 Gefährdung des Netzwerks
- 4.6 Der Sozialraum
- 5 Datenschutz im Case Management
- 5.1 Dokumentationsdisziplin und Aktenführung
- 6 Die Prozessphasen des fallbezogenen Case Managements
- 6.1 Programmatische Grundlagen
- 6.2 Intake – Aufnahme ins Case Management
- 6.2.1 Screening
- 6.2.2 Initialassessment
- 6.2.3 Kontraindikationen
- 6.2.4 Beziehung, Arbeitsbündnis, Auftrag
- 6.3 Bedarfsermittlung und Assessments
- 6.3.1 Zielklärung und Vertiefung des Fallverstehens
- 6.3.2 Kommunikative Validierung
- 6.3.3 Ermittlung von Bewältigungsanforderungen
- 6.3.4 Ressourcencheck
- 6.3.5 Instrumente der Bedarfsermittlung
- 6.3.6 Checkliste Assessment
- 6.4 Hilfe- und Serviceplanung
- 6.4.1 Fallkonferenz
- 6.4.2 Der Serviceplan
- 6.4.3 Instrumente der Hilfeplanung und Fallkonferenz
- 6.4.4 Ressourcenmanagement: Marktübersicht
- 6.4.5 Auswahlkriterien für Ressourcen
- 6.4.6 Checkliste Hilfe- und Serviceplan
- 6.5 Umsetzung (Linking)
- 6.6 Überwachung des Versorgungsprozesse (Monitoring)
- 6.6.1 Durchführung/Instrumente
- 6.6.2 Umfang/Häufigkeit des Monitoring
- 6.6.3 Gründe für die Unzufriedenheit des Klienten
- 6.6.4 Umgang mit Konflikten
- 6.7 Abschluss und Evaluation
- 6.7.1 Inhalte und Methoden der Evaluation
- 6.7.2 Beendigung/Entpflichtung/Anschlussversorgung
- 6.7.3 Abschlussbericht/Gutachten
- 7 Lösungvorschläge zu den Fallbeispielen
- 7.1 Lösung Fallbeispiel 1: Der Vertrauensvorschuss
- 7.2 Lösung Fallbeispiel 4: Amputation I – Förderung von Vertrauen und Kooperation
- 7.3 Lösung Fallbeispiel 16: Amputation II – Ziele bestimmen
- 7.4 Lösung Fallbeispiel 7: Die Arbeitsvermittlung
- 7.5 Lösung Fallbeispiel 8: Das Hilfsmittel
- 7.6 Lösung Fallbeispiel 9: Ingenieur I – Scheidung
- 7.7 Lösung Fallbeispiel 10: Ingenieur II – Behandlungs- bzw. Prozessketten
- 7.8 Lösung Fallbeispiel 17: Jugendlicher Straftäter I – Zweitbestes Ziel
- 7.9 Lösung Fallbeispiel 19: Jugendlicher Straftäter II – Zugang zur beruflichen Bildung
- 7.10 Lösung Fallbeispiel 13: Screening Suchtproblematik
- 7.11 Lösung Fallbeispiel 11: AIDS I – Programm für die Aidshilfe
- 7.12 Lösung Fallbeispiel 12: AIDS II – Screening Aidshilfe
- 7.13 Lösung Fallbeispiel 14: AIDS und Schwangerschaft I
- 7.14 Lösung Fallbeispiel 15: AIDS und Schwangerschaft II
- 7.15 Lösung Fallbeispiel 18: AIDS und Schwangerschaft III
- 7.16 Lösung Fallbeispiel 20: AIDS und Schwangerschaft IV
- 7.17 Lösung Fallbeispiel 22: AIDS und Schwangerschaft VI
- Abkürzungen
- Literaturverzeichnis
- Register

Dieses Kapitel soll Sie für den Lernprozess motivieren und ins Thema einstimmen, indem es
• eine erste Vorstellung über die Bedeutung von Case Management vermittelt,
• Gründe nennt, warum Case Management ein notwendiges Angebot der Pflege und Gesundheitsversorgung) ist,
• warum es eine gute Entscheidung ist, sich als Case Manager*in zu qualifizieren,
• den Aufbau des Lehrbuches skizziert und die didaktischen Intentionen erläutert,
• über die inhaltlichen Anforderungen der Qualifikation und die verschiedenen Einsatzgebiete informiert,
• die typische Denkweise (Handlungslogik) im Case Management herausstellt und
• auf die entsprechenden Rollenanforderungen und die zahlreichen z. T. widersprüchlichen Erwartungen und Dilemmata hinweist, die mit der Tätigkeit des/der Case Manager*in verbunden sind.
Zur Unterstützung Ihres Lernprozesses benutze ich folgende Überschriften bzw. Kästen im Text:
• Fallbeispiel: Fallbeispiele werden teils kapitelübergreifend in Teilaufgaben angeboten. Die Ergebnisse benötigen Sie z. T. für einen späteren Lernschritt bzw. für die Weiterbearbeitung. Da ich Fallbeispiele nur in Auszügen schildere, können Sie fehlende Daten und Sachverhalte jeweils nach Ihrem Gutdünken ergänzen. (Ist ein Lösungsvorschlag am Ende des Buches hinterlegt, wird jeweils darauf hingewiesen).
• Wichtig: Wichtige Informationen oder Zusammenfassungen stehen in Kästen. Diese Inhalte sind als Knoten für ein »kognitives Netz« gedacht, das Sie im Verlauf der Lektüre ausbilden werden.
• Aktivität: Aktivitäten helfen Ihnen dabei, den Stoff des jeweiligen Abschnitts zu vertiefen. Sofern die Aktivität eine Internetrecherche erfordert, sind relevante Links und/oder Suchworte angegeben.
• Übung: Übungen umfassen Aufgaben, die Teilaspekte des Case Management-Prozesses betreffen. Im Unterschied zu Aktivitäten, die auf die Aufnahme von Information zielen, geht es bei Übungen um Ihre praktische Auseinandersetzung mit einzelnen Arbeits- oder Gedankenschritten.

Bei Fragen können Sie sich direkt an mich wenden: Otto Inhester, WBHiEx@gmx.de
1.1 Aufbau des Lern- und Lehrbuchs
Der Schwerpunkt dieses Buches liegt darin, Sie als Lernende und Lehrende mit typischen Herausforderungen des Case Managements und des Case Management-Prozesses auf Einzelfallebene (Fallsteuerung) und mit Lösungsmöglichkeiten vertraut zu machen. Dazu wird eine dem Case Management entsprechende Denk- und Arbeitsweise vermittelt. Dies erfordert zum einem die Internalisierung einer bestimmter Haltung – z. B. jeder Mensch hat das Recht, sein Leben nach seinen Glücks- und Zufriedenheitsvorstellungen zu gestalten (Respekt vor dem Eigensinn abweichender Lebensentwürfe) – und die Überzeugung, dass Menschen, wenn sie über entsprechende Ressourcen und Unterstützung verfügen, ihr Schicksal ändern können, wenn sie es denn wollen. Zum zweiten erfordert die Umsetzung ein differenziertes Methodenrepertoire, um die verschiedenen Phasen des Case Management-Prozesses individuell, fall- und situationsgerecht gestalten zu können.
Diesem Lernziel wird durch die Vielzahl von Aufgaben und Übungen entsprochen. Gerade weil es oft keine eindeutig beste Musterlösung gibt, ist es sinnvoll, wenn Sie sich über die Unterschiede der Ergebnisse austauschen. Einige Übungen lassen sich auch gut in der Beratung und beim Coaching von Klient*innen einsetzen.
Wichtig Vertrautheit mit der Handlungslogik und Prozessstruktur
Eine hohe Vertrautheit mit der Handlungslogik und Prozessstruktur ist das Fundament, auf dem ein Fall flexibel und kreativ bearbeitet werden kann, ohne dass Sie bei der entfaltenden Komplexität den roten Faden verlieren.
Dieses Lern- und Lehrbuch ist zum Selbststudium, besonders aber zum Lernen in der Gruppe und bei hybriden Unterrichtsformen geeignet. Meine didaktischen Überlegungen gehen davon aus, die Weiterbildung zur/m Case Manager*in als einen speziellen Sozialisationsprozess (entsprechend dem Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen [DQR] Stufe 6) anzusehen, der auf beruflichen Erfahrungen aufbaut. Diese gilt es als wertvolle Ressource in den Lernprozess einzubringen. Einmal im Sinne von Feldkompetenz (Expertenwissen) und zum anderen als Kristallisationspunkt kritisch-reflexiver Auseinandersetzung mit (liebgewordenen) professionellen Handlungslogiken und gewohnten, oft auch einfach hingenommenen soziokulturellen Arbeitsbedingungen und Organisationskulturen. In quasi kontrastierender Weise zu Ihrer bisherigen professionsgeprägten Denk- und Arbeitsweise möchte ich Sie so mit der Handlungslogik des Case Managements vertraut machen.

Wichtig
Die Idee des Case Managements
Die Idee des Case Managements geht von der Vorstellung aus, dass die Rahmenbedingungen, unter denen Menschen ihre jeweilige Krise, Krankheit oder persönlichen Schicksalsschläge durchleben und bewältigen müssen, im Grundsatz veränderbar sind. Barrieren und Erschwernisse können reduziert oder beseitigt, Ressourcen (wieder)entdeckt, entwickelt bzw. neu erschlossen werden.
Ihre Problemlösungskompetenz, Kreativität und Fantasie als Case Manager*in sind gefordert, um in der Zusammenarbeit mit den Klient*innen einen möglichst breiten Lösungshorizont zu erschließen, damit jeder Klient eine echte Wahl darüber treffen kann, wie es für ihn weitergehen soll.
Der Case Management-Prozess sollte nicht nur als rationale Managementaufgabe aufgefasst werden, sondern als Organisation von Lebenskunst1. Leben ist danach eine individuelle Ausdrucksform, in der auch nonkonforme Werte und Ansichten kultiviert werden. Lebenskunst ist Arbeit an sich selbst und folgt selbstbestimmten Idealen. Daher ist der Case Management-Prozess nicht nur von den vordringlichen und akut krisenhaften Themen und Inhalten bestimmt. Über alle Phasen hinweg kommt dem Empowerment der Klient*innen ( Kap. 6.7.1) eine tragende Bedeutung zu. Dies schlägt sich v. a. in einem an den Veränderungswünschen der Klient*innen orientierten Vorgehen, der Alltags- und Lebensweltorientierung sowie der Stärkung seiner Koproduzentenrolle nieder. Eine im Sinne des Empowerments gelingende Begleitung zeichnet sich dadurch aus, dass es Ihnen als Case Manager*in gelingt, einen Teil Ihrer Kompetenzen zur Problemlösungsfähigkeit auf den Klienten zu übertragen. Ebenfalls im Sinne des Empowerments ist es erforderlich, den Veränderungswillen des Klienten zum Ausgangspunkt und zur tragenden Ressource zu entwickeln.
Kap. 6.7.1) eine tragende Bedeutung zu. Dies schlägt sich v. a. in einem an den Veränderungswünschen der Klient*innen orientierten Vorgehen, der Alltags- und Lebensweltorientierung sowie der Stärkung seiner Koproduzentenrolle nieder. Eine im Sinne des Empowerments gelingende Begleitung zeichnet sich dadurch aus, dass es Ihnen als Case Manager*in gelingt, einen Teil Ihrer Kompetenzen zur Problemlösungsfähigkeit auf den Klienten zu übertragen. Ebenfalls im Sinne des Empowerments ist es erforderlich, den Veränderungswillen des Klienten zum Ausgangspunkt und zur tragenden Ressource zu entwickeln.
Wichtig Veränderungswünsche vs. -wille
Die Psychologie bietet allerlei Begriffe, um die Handlungsbereitschaft von Menschen zu erklären: Motiv, Motivation, Bedürfnisse, Wünsche, Interesse etc. Für den Case Management-Prozess sind zunächst die Veränderungswünsche der Ausgangspunkt. Da Wünsche das Zentrum des Handelns nach außen projizieren – der Staat oder andere mögen den Wunsch erfüllen – erfolgt in der Zielklärung die Transformation von Veränderungswünschen in explizite Ziele (= Veränderungswille). Entscheidend ist, dass der Wunsch nach Veränderung einer Situation mit der Handlungsbereitschaft des Klienten verbunden wird. Auch wenn es nur darum geht, Hilfe anzunehmen (siehe Sozialraum, ausführlicher in  Kap. 4.3.1).*
Kap. 4.3.1).*
* Vgl. auch Hinte W (2019): „Sozialraumorientierung – Grundlage und Herausforderung für professionelles Handeln. In: Fürst R, Hinte W (Hrsg.): Sozialraumorientierung. Ein Studienbuch zu fachlichen, institutionellen und finanziellen Aspekten. Wien, S. 9–28
Um die aktuelle Diskussion in der Entwicklung des Case Managements verfolgen zu können, werden verschiedene Rechercheaufgaben gestellt (siehe die Kästen »Aktivität«). Über diesen Weg werden Sie stets auf den aktuellen Sachstand in der Entwicklung und Ausgestaltung von Case Management-Projekten verwiesen. Um diese besser einordnen und bewerten zu können, nehme ich an vielen Stellen Bezug auf bestimmte theoretische Kontexte.
Beachten Sie bitte: Theorien helfen, komplexe Zusammenhänge überschaubar darzustellen. Sie bilden einen Rahmen, um die Komplexität sowohl des Case Managements als Institution wie die eines Falles handhabbar zu machen2. Um Case Management als Institution im Bereich der Humandienstleistungen besser verstehen zu können, behandelt dieses Lehrbuch vier Schwerpunkte, aus denen die Inhalte und Lernziele abgeleitet werden:
1. Gesellschaftliche, ökonomische und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen und ihre Bedeutung für das Case Management
2. Theoretische Grundlagen des Case Managements
3. Gestaltung und Umsetzung der Handlungs- bzw. Prozessstruktur des Case Managements
4. Spezifische methodisch-persönliche Kompetenzen und Rollenklarheit
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842691650
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Oktober)
- Schlagworte
- Altenpflege Case Manager Entlassungsmanagement Pflegemanagement Quartiersmanagement