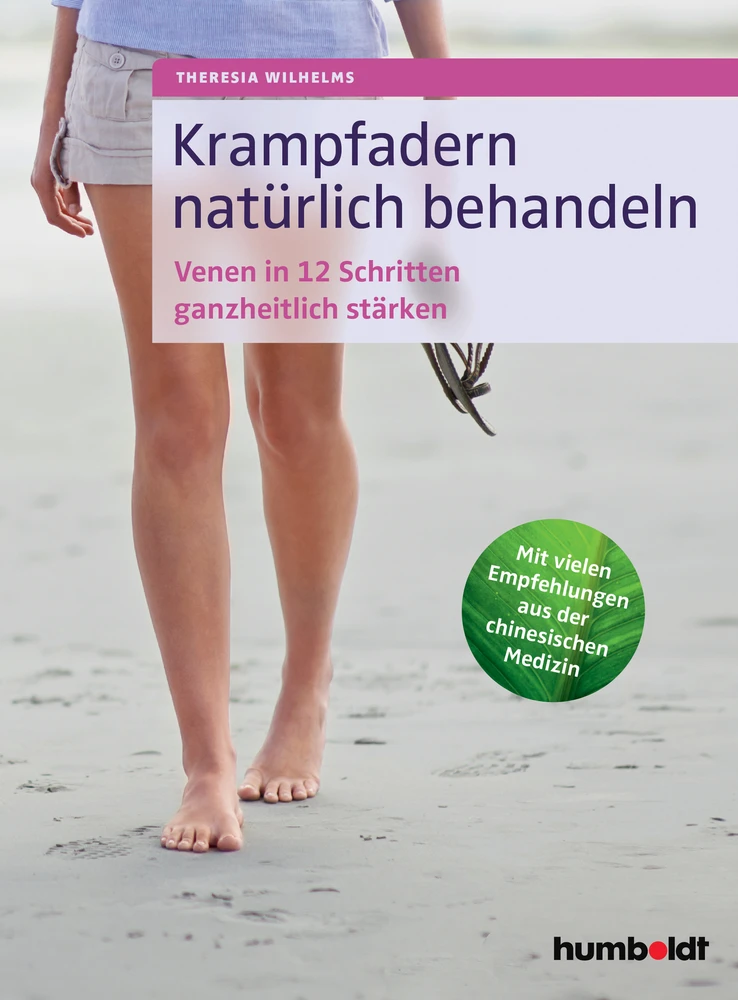Zusammenfassung
In wenigen Monaten von Krampfadern zu schönen Beinen? Das geht. Und zwar ganz natürlich: Theresia Wilhelms ist Spezialistin für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und biologisch-sanfte Krampfaderentfernung. In diesem Ratgeber gibt sie ihren Lesern wertvolle Informationen an die Hand, um funktionstüchtige Venen zu stärken und Krampfadern naturheilkundlich zu entfernen. Frühzeitiges Erkennen, sinnvolle Anwendungen, richtige Bewegungen im Alltag, die Fünf-Elemente-Ernährung sowie die Kochsalztherapie bilden den Kern des ganzheitlichen Ansatzes. Für alle, die sich mehr Wohlbefinden und Lebensqualität durch gesunde Blutgefäße und schöne Beine wünschen.
So profitieren Sie von diesem Ratgeber:
- Der erste Venenratgeber, der die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) mit dem westlichen Erfahrungswissen verbindet.
- Alle wirksamen naturheilkundlichen Maßnahmen zur Behandlung und Vorbeugung von Venenleiden in einem Buch zusammengefasst und bewertet.
- Mit pro- und präbiotischen Rezepten nach den fünf Elementen.
- Die Autorin ist ausgewiesene Expertin für TCM und sanfte
Krampfaderentfernung mit Kochsalz.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
was ist attraktiver als gut gewachsene und schöne Beine, verbunden mit kraftvoller Lebensenergie, munterem Tatendrang und begeisterter Lebensfreude? Diese Gedanken tun gut, lassen uns erst schmunzeln, dann hoffen und wir könnten uns rasch an diese Vorstellung gewöhnen. Und wenn wir uns an unsere Kindertage erinnern, wie war das damals? Frisch und frohen Mutes waren wir, hatten wunderbare Beine, perfekt durchblutet und allzeit zum Laufen bereit. Ganz unbeschwert und ohne darüber nachzudenken.
Überall finden wir dieselben pauschalen Tipps, Informationen und Ratschläge zum Vorbeugen und Behandeln von Krampfadern. Viele sind verwirrend und werfen Fragen auf. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich dieses ganzheitliche Therapiekonzept aufbauen und mit verschiedenen Heilmethoden verknüpfen und ausarbeiten durfte. Daraus ist ein rundes Konzept entstanden, mit dem Sie Ihre Venen stärken und Krampfadern natürlich entfernen können. Mit Ihrem Interesse an diesem Buch haben Sie den ersten Schritt getan.
Neu daran ist die ganzheitliche Methode der chinesischen Medizin – kombiniert mit unserer westlichen Naturheilkunde. Krampfadern lassen sich nahezu natürlich mit Kochsalz – als Alternative zur chirurgischen Venenoperation – entfernen. Und oftmals stelle ich gemeinsam mit meinen Patienten fest, wie schnell und wohltuend sich die alternativen Anwendungen auf ihr Befinden auswirken. Sie motivieren und stoßen Veränderungen an, die sich im weiteren Leben erfreulich widerspiegeln.
In diesem Buch zeige ich Ihnen, wie sich Ihre Beine und Ihre gesamte Gesundheit in wenigen Wochen sichtbar verbessern können. Dafür gibt es zu den ausgearbeiteten Verfahrensweisen ein paar einfache Regeln:
1. Konzentrieren Sie sich auf schöne und gesunde Beine. Verfolgen Sie Ihr Ziel kontinuierlich. Wenden Sie Ihre Routine dauerhaft und konzentriert an.
2. Verstehen Sie die Funktionen der Energieleitbahnen und der Gefäßsysteme mit ihren Netzwerken und den dazugehörigen Körperorganen.
3. Unterstützen Sie Ihren Organismus und seine Funktionen als Ganzes mit den vorgeschlagenen Maßnahmen. Unser Körper leistet täglich unermüdliche Dienste. Bringen Sie ihm die Beachtung entgegen, die er verdient.

„Der Schlüssel zum Erfolg ist Geduld“
Chinesisches Sprichwort
Es ist ein Zusammenspiel von Bewusstsein und Lebensfreude. Erst mit dem Tun kommen wir zur Ruhe. Und mit der Ruhe kommen Leichtigkeit und die schönen Dinge des Lebens zurück. Es folgen Linderung und Heilung.
Dieses Buch können Sie auf unterschiedliche Weise nutzen. Im Kapitel „Die Funktion der Venen natürlich verbessern“ steht jede Methode für sich. So bleibt es Ihnen überlassen, die Maßnahmen an Ihre Bedürfnisse anzupassen oder auszubauen.
Eine Empfehlung zum Schluss: Gehen Sie spielerisch, aber gewissenhaft an die Informationen heran. Sie werden rasch merken, dass die vorliegenden Maßnahmen und gewonnenen Kenntnisse sich keinesfalls nur auf Ihre Venen positiv auswirken. Die Tipps und Ratschläge folgen einem ausgetüftelten, ganzheitlichen Gesundheitsplan und bieten so den maximalen Erfolg, um Krampfadern sanft und nachhaltig loszuwerden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind medizinisches Grundverständnis, Bewusstsein, Einsicht und Ausdauer gefragt. Und denken Sie daran, Ihre Erfolge stets mit anderen Menschen zu teilen.
Ich wünsche Ihnen allzeit viel Freude im Leben!
Theresia Wilhelms
DAS GEFÄSSSYSTEM DES BLUTES
Unser Körper mit all seinen Organen und Geweben ist an ein umfassendes Blutsystem angeschlossen. Über dieses Netzwerk erhält er vitale Nährstoffe, Sauerstoff und Energie. Gleichzeitig übermittelt Blut wichtige Botenstoffe an die Zellen, entsorgt nicht mehr benötigte Stoffwechselprodukte und wehrt gefährliche Feinde ab. Vorausgesetzt, die einzelnen Einrichtungen funktionieren untereinander einwandfrei. Das ist von großer Bedeutung, da der Körper von diesen Vorgängen bis in die kleinste Haarwurzel profitiert und davon abhängig ist. Seite an Seite begleiten Arterien, Lymphgefäße, Nerven- und Energieleitbahnen die kilometerlangen Wege der Venen und arbeiten eng mit ihnen zusammen. Das zeigt, dass der gesamte Körper mit seinen Gefäßen und Bahnen untrennbar verbunden ist.
Wie Krampfadern entstehen

Ein anders Wort für Krampfadern ist Varizen und für ein Krampfaderleiden Varikose.
Unnatürlich vergrößerte, überdehnte und verfärbte Krampfadern sind oftmals schmerzhaft und lassen Beine unattraktiv oder älter wirken. Viele Frauen und Männer verstecken sie gerne unter langen Hosen. Krampfadern lösen im wahrsten Sinne des Wortes starken Druck auf die Betroffenen aus. Energiemangel, fehlende Bewegung oder Übergewicht verstärken zusätzlich die psychische Belastung.
Wie kommt es überhaupt zu Krampfadern?
In den Beinen unterscheiden wir zwei verschiedene Venensysteme: Das sogenannte tiefliegende mit wenigen, bleistiftdicken Leitvenen, eingebettet zwischen der Beinmuskulatur. Sie verfügen über die meisten Venenklappen und schließen sich von Unterschenkel über Oberschenkel immer weiter zusammen, bis in der Leiste eine fingerdicke Beckenvene entsteht. Diese Vene bildet für beide Venensysteme den einzigen Weg des Blutes aus dem Bein heraus zurück zum Herzen. Hier fließen circa 90 Prozent des Blutes nach oben. Parallel zu den tiefen Venen laufen die pulsierenden, muskulösen Arterien mit ihrem sauerstoffreichen Blut. Die tiefen Venen können bis zu 15 Millimeter stark sein.

Krampfadern sind ein Symptom bereits erkrankter Venen. Sie entstehen durch Rückstau des Blutes und sollten bald behandelt werden.
Zum zweiten Venensystem gehören die oberflächlichen Venen, auch Stammvenen genannt. Sie liegen außerhalb der Muskulatur, teilweise sichtbar unter der Haut und teilweise unsichtbar im Fettgewebe eingebettet. Sie bilden ein zartes Netzwerk. Ihre Venen sind ein bis drei Millimeter dick. Zwei der oberflächlichen Venen, die große Rosenvene und die kleine Rosenvene, sind kräftiger und etwa drei Millimeter dick. Weil sie tiefer unter der Haut liegen, sind sie für uns nicht sichtbar. Ihre Aufgabe: Das Blut aus der Haut aufzunehmen und in das tiefliegende System zu bringen. Dazu sind sie mit zahlreichen Verbindungsvenen verankert, die in der Muskulatur liegen. Je Bein sind es ungefähr 150 bis 200 Verbindungstellen, die ihrerseits mit Einmündungsklappen ausgestattet sind. Sie befördern das Blut aus dem oberflächlichen Netzwerk auf dem direkten Weg in die tiefen Venen. Oberflächliche Venen führen ungefähr zehn Prozent des Blutes zum Herzen zurück.
Die große Rosenvene verläuft an der Innenseite des Beins nach oben und mündet in der Leistenbeuge ins tiefe Venensystem. Die Stelle der Einmündung heißt Venenstern oder Krosse. Sie ist die zentrale Stelle aller Zuflüsse aus dem Fuß-, Unter- und Oberschenkel sowie aus dem Beckenbereich. Die kleine Rosenvene zieht sich an der Rückseite des Beins nach oben und mündet in der Kniekehle ebenfalls über eine Krosse in das tiefe Venensystem. Die Krossen sind die größten Ankerpunkte der Verbindungsvenen und auch mit Klappen ausgestattet.

Links ein Bein mit Krampfadern, rechts ein gesundes Bein.
Obwohl wir sie als Verursacher nicht sehen können, gehen alle äußerlich sichtbaren Krampfadern, Besenreiser oder Venen von den großen oder kleinen Rosenvenen aus.
Jede oberflächliche und tiefe Beinvene besitzt Klappen. Diese Venenklappen lassen den Blutstrom nur in Richtung Herzen zu. Wenn wir stehen und die Erdanziehungskraft das Blut nach unten drückt, sorgen sie dafür, dass der Blutstrom zum Herzen aufsteigen kann. Die große Rosenvene hat etwa 20 Klappen.
Sind die Klappen in den Gefäßen schwächer ausgebildet oder defekt, passiert folgendes: Wenn wir stehen, wird das Blut nicht mehr nach oben aufsteigen, sondern es fließt nach unten zurück und erweitert die Vene. Erstmal sehen wir das von außen nicht. Wir sehen es erst, wenn sich der Stau weiter in die Hautgefäße fortsetzt. Das heißt, was wir äußerlich sehen – die hässlichen Krampfadern oder Venen am Unterschenkel – sind nur ein Symptom der erkranken Rosen- oder Stammvenen.

Die Gründe für Krampfadern sind vielseitig, aber beeinflussbar.
Oft entstehen Krampfadern durch ein schwaches Bindegewebe, das angeboren sein kann oder sich mit der Zeit entwickelt hat. Die Folge dieser Bindegewebsschwäche sind überdehnte Venen mit Klappen, die nicht richtig schließen. Als Ursachen spielen außerdem bestimmte Verhaltensweisen eine Rolle, die die Entstehung von Varizen begünstigen – zum Beispiel Bewegungsmangel, ständiges Stehen beziehungsweise Herunterhängen der Beine, beispielsweise im Berufsalltag, eng anliegende Kleidung, die die Beine abschnürt oder auch eine Schwangerschaft.
Krampfadern frühzeitig behandeln
Im Laufe der Zeit überdehnen sich die Verbindungsstellen vom oberflächlichen zum tiefen Venensystem. Mit der Folge, dass die Klappen an den Einmündungen nicht mehr schließen und das Blut statt zum Herzen zurück in die Beinvenen pendelt. Dadurch überdehnt der nächste Abschnitt ebenfalls und der Blutstrom wandert auch hier zur vorherigen Klappe zurück. Auf diese Weise breitet sich das von oben nach unten aus. Der Unterschenkel verändert sich sichtbar durch den Überdruck und Rückfluss, der sich bis in die Blutgefäße fortführt und sie überdehnt.

Haben sich Krampfadern überdehnt, bilden sie sich nicht mehr zurück.
Obwohl das Blut weiter nach unten sackt, muss es einen Weg nach oben finden. Ansonsten überdehnt sich das Bein komplett und schwillt stark an. Diese massive Überlastung in den oberflächlichen Venen überdehnt auf Dauer auch die Venen im tiefen System und schädigt sie tiefgreifend. Es entsteht eine sogenannte Chronisch Venöse Insuffizienz (CVI-Stadium I bis IV). Im vierten Stadium sind die tiefen Venen nicht mehr in der Lage, das Blut der oberflächlichen Venen zum Herzen zu transportieren. Das Ergebnis ist ein offenes und schwer zu heilendes Bein (siehe auch Seite 19).
Interessant zu wissen: Mit den oberflächlichen Venen sind mehrere, kleinere Venen und Besenreiser verbunden. Zeigen sich am Sprunggelenk, Unterschenkel oder Oberschenkel Besenreiser, sind sie ein Indiz dafür, dass es durch eine Schwäche der Venenklappen zum Überdruck gekommen ist.
Sind Krampfadern erstmal ausgedehnt, gehen sie nicht mehr in ihre ursprüngliche Form zurück. Kompressionsstrümpfe wirken nur symptomatisch. Der Patient muss sie konsequent jeden Morgen anziehen und den ganzen Tag lang tragen. Für gut angepasste Kompressionsstrümpfe ist es dringend erforderlich, dass das Ausmessen auf jeden Fall früh morgens erfolgt, wenn die Beine noch schlank sind. Erst am Tag oder abends die bereits angeschwollenen Beine für das Anpassen auszumessen wäre sinnlos.
Eine Venenerkrankung schreitet fort. Deshalb ist es notwendig, das defekte, oberflächliche Venensystem so früh als möglich zu behandeln und zu entfernen. Bei einer Untersuchung mit Ultraschall findet der Therapeut heraus, welche Venen krank sind. Typischerweise sind das entweder die große Rosenvene, die kleine Rosenvene oder eine der zahlreichen Verbindungsvenen. Sie funktionieren nicht mehr und andere Venen haben die Aufgaben übernommen, kleine Mengen Blut nach oben zu transportieren.

Durch Rückstau des Blutes bis ins tiefe Venensystem überdehnen sich die Venenklappen.
Unbehandelt verursachen sie einen Blutstau in das tiefe Venensystem. Dieses muss das rückgestaute Blut zum Herzen bringen. Durch diese Überlastung erweitern sich die tiefen Venen mitsamt ihrer Klappen. Die Folge ist eine Insuffizienz, die sich unter Umständen nicht mehr therapieren lässt. Deshalb ist es ratsam, die oberflächlichen Venen zu behandeln, bevor solche Schäden auftreten.
Nur sichtbare Venen zu entfernen ist sinnlos, da sie sofort wiederkommen. Die biologische Entfernung von Krampfadern mit einer Kochsalzinjektion nach Professor Linser und Dr. Köster hat den Vorteil, dass die flüssige Kochsalzlösung die unsichtbaren Krampfadern mit erfasst und mit entfernt. Dadurch wird eine Operation in den meisten Fällen überflüssig. Dieser Methode ist im hinteren Teil des Buches ein eigenes Kapitel gewidmet (siehe Seite 70).
Venenaufbau und Funktion
Venen, die auch als Blutadern bezeichnet werden, sind „Kapazitäts- oder Speichergefäße“. Immerhin bergen sie zwei Drittel des gesamten Blutes. Sie verlaufen zwischen den Kapillaren in der Peripherie und dem rechten Vorhof des Herzens. Dorthin transportieren sie venöses, sauerstoffarmes Blut. Ausnahme: Zwischen den Kapillaren der Lunge und dem linken Vorhof des Herzens führen sie sauerstoffreiches Blut. Sie besitzen genauso wie die parallel laufenden, muskulösen und elastischen Arterien eine dreischichtige Wand. Von innen nach außen werden sie als Intima (innere Schicht), Media (mittlere Schicht) und Adventitia (äußere Schicht) bezeichnet. Allerdings sind sie weitaus dünner und weniger kräftig als ihre muskulösen Kollegen. Ihre glatte Muskelschicht ist eher locker und enthält mehr kollagene Fasern, in diesem Fall Bindegewebe. Ihre Venenklappen im inneren sind im Grunde Falten, die aus demselben Material bestehen wie die Intima. Wir finden die Klappen hauptsächlich in den Beinvenen. Sie funktionieren wie ein Rückschlagventil mit der Aufgabe, das Blut nach oben zu bringen und einen Blutfluss in die falsche Richtung zu verhindern.
Die Kapillaren befinden sich in allen Organen, um sie mit Nährstoffen und Energie zu versorgen. Dort findet ein Austausch von Gas und Produkten aus dem Stoffwechsel statt. Sie sind ein dicht verzweigtes Netzwerk, welches die kleinsten Arterien (Arteriolen) mit den Venolen verbindet. Venolen sind kleine Venen, die in größere Venen münden. Seite an Seite begleiten Arterien, Lymphgefäße und Nervenbahnen die kilometerlangen Wege der Blutadern. Tagtäglich transportieren sie pflichtgetreu mehr als 7000 Liter Blut durch unseren Körper.

Blutadern sind kilometerlang und transportieren täglich mehr als 7000 Liter Blut.
Durch ihre eigene und glatte Muskulatur lassen sich Venen nicht bewusst trainieren. Aber unsere Skelettmuskulatur lässt sich bewusst steuern, etwa die Oberschenkel- und Wadenmuskulatur. Unsere Venen sind darin eingebettet und deshalb können wir ihre Leistungsfähigkeit mit bewusster Muskelarbeit fördern.

In den Beinvenen befinden sich Venenklappen. Zusammen mit der Muskelpumpe unterstützen sie den Rückfluss des Blutes zum Herzen.
Die Aufgaben des Blutes
Blut ist ein Transportmittel und jeder lebende Organismus ist darauf angewiesen. Wir Menschen verfügen – abhängig von Körpergewicht, Alter und Geschlecht – über vier bis sechs Liter dieser dynamischen Flüssigkeit. Das sind bei einem gesunden Erwachsenen circa sieben bis acht Prozent des Körpergewichtes. Blut liefert unseren Zellen energiebeladene Nährstoffe, die es aus dem Darm aufnimmt. Gleichzeitig federt es Säuren ab und spült unentwegt die giftigen Endprodukte des Stoffwechsels zum Ausscheiden in die Nieren. Kontinuierlich befördert es Sauerstoff von der Lunge in die Gewebe und das dort entstehende Kohlenstoffdioxid wieder zurück zur Lunge. Auch an chemischen Vorgängen ist der blutrote Saft beteiligt, da er die im Körper entstehenden Hormone an die entsprechenden Organe übermittelt. Er sorgt für eine gleichbleibende Körpertemperatur und wehrt feindliche, krankmachende Organismen ab. Schließlich schützt Blut uns vor seinem eigenen Verlust, indem es gerinnt. Auch erneuert es sich ständig selbst.

Blut versorgt Gewebe und Organe mit Nährstoffen und Sauerstoff. Alle lebenden Organismen brauchen es.

Schematische Zeichnung des Herz-Kreislaufsystems. Die Arterien transportieren das Blut in die Peripherie, und die Venen zurück zum Herzen.
Unterschätzte Lymphe
Jedes Blutgefäß in unserem Körper, und sei es noch so klein, begleitet ein Lymphgefäß. Diese sind dünn, zart und weißlich-transparent. Die kräftigen Arterien pressen täglich 20 Liter Flüssigkeit in unsere Gewebe. Dort findet ein Austausch von Nährstoffen statt, woraufhin ein Großteil der Flüssigkeit (18 Liter) in die Venen zurückfließt. Übrig bleiben zwei Liter Lymphe, die erst über einen Umweg in die Blutbahn zurückkehren. Ihre Aufgaben: Filtern, Reinigen, Aufnehmen und Transportieren von Fetten aus der Ernährung, Immunabwehr und die Lymphozytenbildung. Lymphozyten gehören zu den weißen Blutkörperchen. Viele Lymphgefäße sammeln und vereinigen sich im Unterbauch zu einem großen Gefäß. Dieses Gefäß heißt Ductus thoraticus oder Milchbrustgang. Von unten nach oben aufsteigend, durchquert es Zwerchfell und Brustkorb. Dabei befördert es die Lymphe aus Beinen, Bauchorganen, der linken oberen Körper- und Kopfhälfte über den linken Venenwinkel direkt ins Herz. Die Lymphe der rechten oberen Körper- und Kopfhälfte fließt in den rechten Venenwinkel direkt ins Herz.

Lymphe gehören zur Immunabwehr. Durch Verletzungen ihrer Gefäße kann ein Lymphödem entstehen.
Lymphgefäße haben Klappen, die einen Rückfluss der Lymphe verhindern. Ihre Wände bestehen – ähnlich wie bei Venen – ebenso aus drei Schichten. Allerdings sind sie nicht muskulös und schwächer. Muskelarbeit, pulsierende Arterien und Atembewegungen pressen die Lymphgefäße zusammen und verstärken den Rückfluss der Lymphe in das venöse System um ein Vielfaches. Durch Verletzungen der zarten Lymphbahnen bei einer Krampfaderoperation kann durch die gestaute Flüssigkeit ein Lymphödem entstehen.
Die Aufgaben von Nerven und Hormonen
Nerven- und Hormonsysteme arbeiten eng zusammen. Sie steuern vielseitige Lebensprozesse, beispielsweise das Herz-Kreislaufsystem mit dem Blutdruck und den venösen Rückstrom des Blutes zurück zum Herzen. Unsere Durchblutung funktioniert, indem sich die Weite der Gefäße verändert. Der Spannungszustand (Tonus) der Gefäßmuskulatur und damit ihr Widerstand verändern sich durch unsere Bewegung und Nervenimpulse sowie durch hormonelle Impulse.
Nerven sind spezialisiert auf die rasche Weiterleitung von fein abgestimmten Reizen. Werden die Nervengefäße bei einer Krampfaderoperation geschädigt oder durchtrennt, fehlt dieser Mechanismus, die Venen erweitern sich und dehnen sich aus.
Hormone sind chemische Botenstoffe, die ihre Informationen über das Blut transportieren und sie im Kreislauf verteilen. Hormonelle Veränderungen während einer Schwangerschaft können die Blutgefäße weich machen und Krampfadern verursachen. Nach der Geburt bilden diese sich oft zurück (siehe Seite 77). Auch hormonelle Verhütungsmittel fördern ein Krampfaderleiden und können Thrombosen oder Embolien auslösen.
Venöse Durchblutungsstörungen mit Folgen
Besteht eine fortgeschrittene Schwäche der Venenfunktion mit chronischem Rückfluss des Blutes, ist die Diagnose Chronisch Venöse Insuffizienz (CVI) leicht zu stellen. Es fallen vor allem sichtbare Hautschäden auf:
• erweiterte, prall gefüllte Krampfadern
• Gewebeschwund
• harte Stellen
• dunkelbraune Verfärbungen am Unterschenkel
• Geschwüre typischerweise oberhalb des Innenknöchels (Ulcus cruris)
• Ödeme

Missempfinden, Schwere und Spannungsgefühl in den Beinen bedeuten Durchblutungsstörungen.
Anfangs haben die Betroffenen keine oder verborgene Beeinträchtigungen. Neben dem kosmetischen Makel treten je nachdem unklare Missempfindungen in den Beinen auf. Es entsteht ein Schwere- oder Spannungsgefühl, vor allem nach längerem Stehen. Die Beschwerden verstärken sich durch Wärme, bei Frauen auch vor der Menstruation. Durch Bewegung in kühler Umgebung und dem Hochlegen der Beine bessern sie sich. Weitere Symptome sind Juckreiz, geschwollene Knöchel und Ödeme, die für eine beginnende Chronisch Venöse Insuffizienz (CVI) sprechen. Durch die mangelnde Durchblutung entsteht ein schlecht heilendes Geschwür, das bis auf die Knochen reichen kann.

Typische Befunde für ein fortgeschrittenes Krampfaderleiden sind sichtbar gestaute Venen, Durchblutungsstörungen, Verfärbungen der Haut oder Ekzeme. Im schlimmsten Fall ein offenes Bein.
Stadien der Chronisch Venösen Insuffizienz (CVI)
| STADIEN | BESCHWERDEN | KENNZEICHEN |
|---|---|---|
| I | Keine nennenswerten Beschwerden | Schwellungen, die sich zurückbilden; Verfärbungen; tastbare und sichtbare Krampfadern; das Gewebe ist nicht verhärtet |
| II | Schwere- und Spannungsgefühl, Juckreiz | Verhärtungen; lang anhaltende Schwellungen; trockene Haut; nächtliche Wadenkrämpfe; prall gefüllte Krampfadern; sichtbar gestaute Venen am äußeren und inneren Fußrand |
| III | Hitzegefühl, Juckreiz, Schwellung | Wie Stadium II, aber starker ausgeprägt; Hautstörungen; starke Verfärbungen; Hautentzündungen; Entzündungen der oberflächlichen Venen; Ekzeme |
| IV | Beinschmerzen mit Engegefühl bei Körperlicher Belastung, lässt in Ruhe nach | Chronisches offenes Bein (Ulcus cruris); Entzündungen durch Folgeinfektionen; Lymphödem; versteifte Sprunggelenke; Eisenmangel; Uhrglasnägel an den Zehen |
Thrombophlebitis und Varikophlebitis
Ein Krampfaderleiden kann lange ohne Symptome verlaufen und keine Beschwerden verursachen. Oft entstehen aber auch Komplikationen mit weitreichenden Folgen. Diese lassen sich durch das Entfernen der Krampfadern mit einer Kochsalztherapie verhindern (siehe Seite 70).
Eine Komplikation ist die Thrombophlebitis. Hier sind die Wände der großen oder kleinen Rosenvene im oberflächlichen Venensystem entzündet. Sind die Venen zusätzlich überdehnt, haben sie ihre Funktion verloren und sind zu Krampfadern geworden, sprechen Mediziner von einer Varikophlebitis.
Häufig besteht die Gefahr, dass sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) bildet. Kommt beides zusammen – Entzündung und Thrombus –, handelt es sich um eine nicht bakterielle Thrombophlebitis. Das tiefe Venensystem gewährleistet weiterhin den größten Teil des Blutabflusses, weshalb es zu keinem Blutstau kommt.

Entzündete Gefäße kommen plötzlich, sind schmerzhaft und können gefährlich werden.
Das geschieht ganz plötzlich. Die betroffenen Venen und ihre Umgebung sind rot und fühlen sich geschwollen, heiß und schmerzhaft an. Die Gefäße entzünden sich, wenn bei langem Sitzen oder bei Bettlägerigkeit das Blut durch die gestauten Gefäße zu langsam fließt. Außerdem können Verletzungen durch Schlag und Stoß oder Bisse und Stiche von Insekten eine Thrombophlebitis auslösen. Weitere Risikofaktoren sind:
• Operationen
• Wochenbett
• Ruhigstellen bei Gipsverband
• Rauchen
• starkes Übergewicht
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Tritt eine Thrombophlebitis im Bereich der Leiste auf, kann sich ein Blutgerinnsel in den tiefen Venen bilden und dort eine Thrombose auslösen.
Wichtig: Viel bewegen und nicht im Bett oder auf dem Sofa liegen bleiben. Selbst Bettlägerige müssen tagsüber aufstehen und umherlaufen. Längeres Stehen und Sitzen ist auf jeden Fall zu vermeiden. Kühlende Salben oder Gels mit Arnika lindern die Entzündung und fördern die Heilung. Traditionelle und alternative Helfer sind Wickel und Umschläge mit Lehm, Heilerde, Arnkiatinktur oder Schwedenkräuter (siehe Seite 40). Zudem wirken sie schmerzlindernd und antiseptisch. Bevorzugt sollten Speisen und Getränke mit entzündungshemmenden Eigenschaften verzehrt werden (siehe Seite 96 ff.). In der Regel ist die Einnahme von Antibiotika unnötig.
Die bakterielle Thrombophlebitis ist eine weitere Form der Thrombophlebitis. Durch Venenkatheter oder Drogenmissbrauch verschleppte Bakterien lösen eine Infektion in der Vene aus. Sie tritt mit Fieber und Schüttelfrost auf. Der Betroffene muss dringend in ein Krankenhaus gebracht werden.
Selbsttest zum Beurteilen der Einmündungsklappen
Legen Sie sich hin. Heben Sie das betroffene Bein an und lassen es blutleer laufen. Binden Sie es in der Mitte des Oberschenkels ab oder bitten Sie jemanden, das für Sie zu tun. Das geht gut mit einem Schal, mit einer drei bis fünf Zentimeter breiten Binde oder einem Gummiband. Stehen Sie auf und beobachten Sie die große Rosenvene:
1. Lassen Sie das Bein abgebunden. Füllt sich die Vene von unten nach oben (vom Fuß bis zur Leiste), sind die Klappen der Verbindungsvenen zum tiefen Venensystem defekt.
2. Entfernen Sie anschließend im Stehen die Bandage. Füllt sich die Vene schnell von oben nach unten (von der Leiste bis zum Fuß), ist die Klappe an der Einmündungsstelle (Krosse, Venenstern) defekt. Dieses Verfahren nennen die Mediziner „Trendelenburg-Test“. Er hat sich in der Praxis zur Beurteilung der Venenklappen bewährt.
Phlebothrombose
Typische Erkennungszeichen einer Phlebothrobose sind das plötzlich schmerzhafte, dick und blau werdende Bein. In einer tiefen Beinvene hat sich ein Blutgerinnsel gebildet. Dadurch ist das Gefäß teilweise oder komplett eingeengt und verschlossen. Der Rückfluss des Blutes zum Herzen hin ist gestört. Phlebothrombosen kommen häufiger vor und bringen große Komplikationen mit sich. Ältere Menschen sind häufiger betroffen als jüngere. Meist entwickeln sie sich aus den tiefen Bein- und Beckenvenen. Bei Menschen, die lange bettlägerig sind, verursacht eine Phlebothrombose oftmals keine oder verborgene Beschwerden. Deshalb wird sie leicht übersehen und eventuell erst nach einer Lungenembolie erkannt.

Thrombosen sind immer gefährlich und sofort behandlungsbedürftig.
Ursachen einer Phlebothrombose
Die Ursachen sind unterschiedlich und vielfältig. Auslöser sind Schäden an der Gefäßwand bei Knochenbrüchen, Prellungen oder Operationen vor allem an den Knien, Hüften und am Unterleib. Oder sie werden ausgelöst durch ungewohnte körperliche Belastung, Dauerkatheter und Krampfadern. Ein weiterer Grund ist ein verlangsamter Blutfluss bei langer Bettruhe, einem Gipsverband oder einer Herzschwäche. Auch eine beengende Sitzposition bei Langstreckenflügen, langes Sitzen, einschnürende Kleidung, Übergewicht und Krampfadern begünstigen einen gestörten Blutfluss.
Eine große Rolle spielen veränderte Bluteigenschaften durch hormonelle Störungen, Hormonbehandlungen, Ernährungsfehler oder Störungen der Blutgerinnung. Außerdem verändern sich die Eigenschaften des Blutes durch Austrocknen des Körpers bei Durchfall, Entwässerungstabletten und Tumoren.
Weitere Risikofaktoren sind das Rauchen, hormonelle Verhütungsmittel, Bewegungsmangel, Ernährungsfehler, familiäre Vorbelastung, Infektionen, Operationen und Unfälle.
Typische Symptome einer Phlebothrombose sind Ödeme, pralle Waden, glänzende und überwärmte Haut mit krampfartigen, heftigen Schmerzen durch Dehnen oder beim Laufen. Durch den Rückstau des Blutes wird das Bein bläulich und die Venen treten deutlich hervor. Wird das Bein hochgelagert, bessert sich der Schmerz. Blutgerinnsel können mit dem Blutstrom in den Körperkreislauf gelangen und Hustenreiz, Schmerzen in der Brust, Atemnot, Angst und Unruhe auslösen. Thromben (Blutpfropfe) werden gefährlich, wenn sie die Gefäße des Lungenkreislaufs verstopfen und dort eine Lungenembolie auslösen.
Postthrombotisches Syndrom
Das postthrombotische Syndrom (PTS) entsteht, wenn eine tiefe Venenthrombose nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird. Zurück bleiben schwere Schäden an den tiefen Venenklappen. Typische Beschwerden sind chronischer Blutstau mit Juckreiz, Schwellung, Wadenkrämpfe und schwere Beine. Im Laufe des Tages und bei warmem Wetter verschlimmern sie sich. Werden die Beine hochgelegt oder bei kühlem Wetter verbessern sie sich. Weitere Folgen sind Hautveränderungen, Pigmentstörungen, erweiterte Hautvenen an den Knöcheln, Ekzeme und ein offenes Beingeschwür.
DIE FUNKTION DER VENEN NATÜRLICH VERBESSERN
Um die Venen zu stärken und die Gesundheit zu verbessern, erhalten Sie in den folgenden Kapiteln fachgerechte Kenntnisse aus der westlichen Naturheilkunde bis hin zur Traditionellen Chinesischen Medizin. In zwölf Schritten erfahren Sie, was Sie regelmäßig tun können, um Ihre Venen zu stärken, Krampfadern vorzubeugen oder sie mit einer Kochsalzlösung natürlich entfernen zu lassen. Und wie Sie die vorgeschlagenen Methoden sinnvoll einüben und erfolgreich anwenden können.
DAS TUT DEN VENEN GUT
1. Richtig atmen aktiviert
Wir beginnen unser Leben mit einem Einatmen und beenden es mit einem Ausatmen. Der Atemrhythmus begleitet uns ununterbrochen ein Leben lang. Pro Minute atmen wir zwölf bis 16-mal. In einem Jahr sind das rund sechs bis sieben Millionen Atemzüge. Grund genug, sich das Luftholen bewusst zu machen und näher anzuschauen.
Unsere Lunge – lebenswichtiges Atmungsorgan
Für die Sauerstoffversorgung ist die Lunge zuständig. Beim Einatmen nimmt sie Energie und Sauerstoff aus der Luft auf, verteilt diese Substanzen im ganzen Körper und scheidet sie mit der verbrauchten Luft beim Ausatmen wieder aus. Das ist der sogenannte Gasaustausch. Sind die Lungen gesund, ist das Atmen ruhig und rhythmisch. Ist der Atemfluss gestört, dann quälen Symptome wie Husten, Atembeschwerden oder Asthma den Betroffenen.

Gemäß der chinesischen Medizin verbindet die Lunge das innere mit dem äußeren Qi (siehe Seite 79) und reguliert den gesamten Blut- und Energiekreislauf.
Die Lunge reguliert gemäß der Traditionellen Chinesischen Medizin zugleich die Wasserwege und wandelt Körperflüssigkeiten um. Sie bewegt ihre Kraft in zwei Richtungen: Abwärts gerichtet und verflüssigend sowie zirkulierend und ausstreuend. Das beeinflusst den gesamten Energie- und Blutkreislauf und kann eine Disharmonie in der Lunge und im gesamten Organismus auslösen. Störungen in der Lungenfunktion wirken negativ auf die körpereigene Abwehr und führen zu Schwellung und Einlagerung von Wasser.
Die Lunge unterstützt mit ihrer Atmung den Rücktransport des Blutes aus den Venen zurück zum Herzen. Bei dieser Aufgabe helfen ihr funktionierende Venenklappen, trainierte Muskeln, die Muskelkraft von Arterien- und Venenwänden sowie die Sogkraft des rechten Herzens.
Wichtig: Ein gleichmäßiges tiefes Einatmen verstärkt die Sogkraft des Herzens. Das hat bei einer Varikose besondere Bedeutung, da Krampfadern ihre Aufgabe, das Blut zum Herzen zu pumpen, nicht oder nur eingeschränkt ausüben.
Der Gasaustausch mit Bäumen
Unser Bronchialbaum ermöglicht den Austausch von Kohlenstoffdioxyd (CO2) und Sauerstoff (O2), beides sind geruchs- und farblose Gase. Sauerstoff – das häufigste Element auf der Erde – ist zu 21 Prozent in der Atmosphäre enthalten und für alle Verbrennungs- und Zersetzungsvorgänge erforderlich. Der Mensch, alle Tiere und zahlreiche Pflanzen benötigen Sauerstoff zum Leben. Sie entnehmen ihn aus der Luft, durch Atmen oder durch Aufnahme aus in Wasser gelöstem Sauerstoff. In hoher Konzentration ist er für viele Lebewesen giftig.
Für Bäume, Sträucher und Gehölze ist Sauerstoff ein nicht mehr benötigtes Stoffwechselprodukt, das sie beim Ausatmen an die Luft abgeben. Im Gegenzug nehmen sie unser angefallenes Stoffwechselprodukt – das Kohlenstoffdioxyd – auf. Sie wandeln es in Kohlenhydrate um, die sie für ihren Organismus zum Leben benötigen. Bei diesem Vorgang nehmen die Blätter ebenso Umweltgifte wie Ozon, Kohlenmonoxyd und Schwefeldioxid auf und verstoffwechseln sie zu Sauerstoff. Ein gesunder, ausgewachsener Baum versorgt am Tag zehn bis 20 Menschen mit Sauerstoff und bindet pro Jahr etwa fünf Tonnen Kohlenstoffdioxyd und 100 Kilogramm Feinstaub.
Der Baum bildet die äußere Form der Atmung, bindet Kohlenstoffdioxyd und erzeugt Sauerstoff. Wir Menschen machen es genau anders herum: Wir atmen O2 ein und CO2 wieder aus. Die Lunge schaut wie ein umgekehrter Baum aus. Innen- und Außenwelt wechseln sich gegenseitig ab. Daraus folgt, dass wir zur Mutter Erde gehören und mit der Natur eine Lebensgemeinschaft haben.

Bäume versorgen uns mit lebenswichtigem Sauerstoff und binden nebenbei Umweltgifte.
Der Atem und seine vielseitigen Aufgaben

Die Atmung ist ein unaufhörlicher, automatischer Reflex, den wir bedingt beeinflussen können.
Egal ob wir schlafen, uns bewegen oder arbeiten: Unsere Sauerstoffversorgung funktioniert unaufhörlich. Sie ist ein automatischer Reflex und genauso wie Essen und Trinken ein Vorgang des Stoffwechsels.
Gleichmäßiges, tiefes und ruhiges Atmen versorgt uns mit lebensnotwendigem Sauerstoff, setzt Energie frei, gleicht Basen mit Säuren aus, reinigt und nährt uns und ist Grundlage des Sprechens. Unterstützt wird der Atemvorgang vom Zwerchfell, Hals-, Bauch-, Brustmuskulatur und der Muskulatur zwischen den Rippen. Die „äußere Atmung“ ist der Gasaustausch in der Lunge. Im Gegensatz zur inneren Atmung, der Zellatmung: Ein Stoffwechselvorgang, der zur Energiegewinnung in den Zellen Sauerstoff verbraucht, indem er Nährstoffe wie Kohlenhydrate und Fette abbaut und verbrennt.
Das Einatmen ist ein aktiver Vorgang. Atemmuskeln und Zwerchfell weiten Brust- und Bauchraum aus. Über die Nasenhöhle, Rachen, Kehlkopf gelangt die eingeatmete, angewärmte Luft in die Luftröhre, von dort aus in die Lungenflügel und Bronchien. Wie ein Baum verzweigen die Bronchien sich in feine Äste und gehen in die Lungenbläschen über. Diese sind mit hauchdünnen Wänden ausgestattet und besitzen kleinste Blutgefäße. In den Blutgefäßen findet der Austausch von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxyd statt. Beim Ausatmen entspannen die Muskeln, Brust- und Bauchraum ziehen sich zusammen und pressen die Luft aus der Lunge raus.
Atemsteuerung: Das Atmen hat mehrere Impulsgeber, die es steuern und regeln. Zum einen gibt es das Atemzentrum: Es liegt im zentralen Nervensystem zwischen Gehirn und Rückenmark und leitet Nervenimpulse weiter oder die chemischen Rezeptoren, die den Säure-Basen-Haushalt ausgleichen. Dazu kommen Muskelund Geweberezeptoren, die Signale auslösen, oder Hormone wie Adrenalin, Cortisol, Schilddrüsen- und Sexualhormone. Auch Schmerz- und Temperaturreize wirken sich auf den Atemrhythmus aus. Ebenso psychische Einflüsse wie Wut, Trauer, Angst und Schrecken oder Freude.
Bewusstes Atmen: Körper, Geist und Seele stehen in einer engen, gegenseitigen Beziehung zum Atmen. Bei fehlender Entspannung, Stress, belastenden Gedanken oder negativen Gefühlen bleibt einem die Luft weg. Vor Angst stockt der Atem oder wir schnauben vor Wut. Sind wir traurig, ist die Atmung flach und kraftlos. Mit Seufzen und Stöhnen versucht der Körper die fehlende Belüftung der Lunge auszugleichen. Geht das über das natürliche Maß hinaus, ist die Atmung angespannt und blockiert. Die Lunge ist zwar gesund, aber ihre Funktion und die Atemregulation sind gestört. Erkennen wir das nicht frühzeitig und gewöhnen uns daran, kommen wir in eine Spirale, die uns weiter anspannt und blockiert. Die Folgen sind beispielsweise ein schlechter Abtransport von Säuren und Kohlenstoffdioxyd. Die Auswirkungen davon sind:

Negative Gefühle lassen sich durch ruhiges und bewusstes Atmen auflösen.
• Mangelhafte Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff
• Brustenge
• Rücken- und Nackenschmerzen
• Konzentrationsstörung
• Kurzatmigkeit und Müdigkeit
Das Erfreuliche ist: Dieser Ausgleich funktioniert genauso umgekehrt. Bewusstes, tiefes ein- und ausatmen erfrischt und belebt. Die Wut löst sich auf, wenn wir ruhig und gleichmäßig atmen. Obwohl Atmen unterbewusst und automatisch abläuft, lässt es sich mit der richtigen Technik und bewusstem Üben gezielt verändern. Im Vordergrund steht das Wissen um den natürlichen Atemvorgang, das Üben und Kontrollieren einer gesunden, vitalen Atmung. Die Ergebnisse machen sich sofort sowohl körperlich als auch seelisch und geistig wohltuend bemerkbar.
Energiequelle Atmen: Unsere Atmung besteht aus drei Phasen: Einatmen, ausatmen und einer Pause, die je nachdem, ob wir angespannt oder entspannt sind, kürzer oder länger ausfällt. Atmen ist ein kontinuierlicher Austausch mit allem, was uns umgibt. Ein Geben und Nehmen, ein Ausdehnen und Zusammenziehen, ein Festhalten und Loslassen.
Der Atemrhythmus funktioniert vollautomatisch und im Hintergrund. Wenn der Körper uns dazu zwingt, schnappen wir reflexartig nach Luft. Damit unterliegt er streng genommen nicht einer bewussten Kontrolle. Aber da die Skelettmuskeln beim Atmen mithelfen, lässt sich das Atmen mit diesen Muskeln bewusst steuern. Es ist also machbar, bewusst tiefer, schneller, flacher oder nur in den Brustkorb oder Bauch zu atmen.
In diesem Rahmen lassen sich durch eine vertiefte Atmung der venöse Rückfluss zum Herzen, Herzschlag, Durchblutung, Muskeln, die Haltung sowie unser seelisches und körperliches Befinden beeinflussen. Die folgenden Anleitungen unterstützen dabei, das bewusste Atmen zu üben. Bitte ausprobieren!

Eine vertiefte Atmung wirkt sich auf vielerlei Weise positiv auf Körper und Geist aus.
Sechs Atemtechniken
Betont und bewusst atmen. Beim Ausatmen spannen sich die Bauchmuskeln an. Beim Einatmen entspannen und dehnen sie sich. Falls nichts anderes erwähnt, kann das Üben stehend, sitzend oder liegend erfolgen. Zwei- bis dreimal täglich bewusst und achtsam üben.

Bewusstes Atmen ist erlernbar, baut Stress ab und entspannt.
Stehend: Die Füße parallel und schulterbreit aufstellen. Die Fußspitzen leicht nach innen drehen. Arme locker hängen lassen. Die Handflächen zeigen zu den Oberschenkeln. Die Knie sind leicht gebeugt. Kopf und Rücken aufrecht und locker halten.
Sitzend: Aufrecht auf einem Stuhl sitzen. Die Füße sind parallel und schulterbreit. Ober- und Unterschenkel sind im rechten Winkel. Der Oberkörper ist aufrecht und entspannt. Das Kinn leicht nach unten sinken und zurückziehen. Die Hände liegen locker auf dem Schoß.
Liegend: Auf den Rücken legen. Beine hüftweit anwinkeln oder ausstrecken. Rücken strecken, aber nicht auf die Unterlage drücken. Kopf nach oben verlängern. Steißbein nach unten verlängern. Der ganze Körper ist locker und leicht.
• Natürliches Atmen: Jeweils dreimal durch die Nase einatmen und durch die Nase ausatmen.
• Qi-Atmung: Durch die Nase einatmen, dabei die Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne legen. Beim Ausatmen durch den Mund die Zungenspitze hinter die unteren Schneidezähne legen. Jeweils dreimal. Diese Technik verbindet zwei wichtige Meridiane – Lenker- und Dienergefäß – miteinander, damit Energie und Blut besser zirkulieren können.
• Qi vom Himmel holen: Sitzposition. Den Kopf in den Nacken legen. Das Gesicht zeigt zum Himmel. Tief und gleichmäßig dreimal durch die Nase in den Unterbauch einatmen. Langsam durch den Mund ausatmen.
• Gedanken frei: Sitzposition. Körper entspannen. Augen schließen. Die Gedanken sind frei und leer. Auf die Atmung konzentrieren. Durch die Nase langsam, gleichmäßig und tief einatmen. Den Atem so lange es geht anhalten und langsam wieder ausatmen, dreimal wiederholen.
• Atem fließen lassen: Durch die Nase einatmen. Dabei die gestreckten Arme langsam nach vorne bis zur Schulterhöhe anheben. Die Handflächen zeigen zum Boden. Langsam durch den Mund ausatmen und die Arme dabei senken, dreimal wiederholen.
• Bauchatmung: Durch die Nase tief einatmen bis in den Unterbauch. Dabei wölbt sich der Bauch vor. Mit dem Mund ausatmen, der Bauch zieht sich zusammen, dreimal wiederholen.

Beim bewussten Atmen werden die Gedanken frei und leer.
2. Kneippsche Wasserkuren – Wundermittel kaltes Wasser
Kaltes Wasser für gesunde Venen
Seit gut 150 Jahren gibt es die ganzheitliche Heilmethode von Naturarzt und Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897). Es ist ein bewährtes traditionelles Verfahren, bei dem die Vorbeugung von Krankheiten und die Gesunderhaltung des Menschen an erster Stelle stehen. Genauso wie die chinesische Medizin, setzt sich die naturheilkundliche Lehre von Kneipp aus fünf Säulen zusammen:
1. Wasserkuren
2. Kräuterheilkunde mit Tees und Badezusätzen
3. Ernährung in Form von leichter vegetarisch-veganer Kost oder Fastentherapien
4. Ausdauernde Bewegung an der frischen Luft
5. Ordnungstherapie mit bewusster, ausgeglichener Lebensführung und Entspannung
Kaltes Wasser im Kneippschen Sinne ist ein reines Wundermittel. Es fördert die Durchblutung, erfrischt, härtet ab und wirkt heilend. Besonders die Kneippschen Kälteanwendungen sind ein angesehenes Verfahren, um Venen zu unterstützen und zu stärken. Sie wirken abschwellend, lösen Stauungen und Schmerzen. Lindernd sind bei Krampfadern kalte Güsse, kalte Teilbäder, Wassertreten und Beinwickel.

Kneippsche Anwendungen beugen Erkrankungen vor und stärken das Immunsystem.
Bei den Maßnahmen mit kaltem Wasser reagieren die Blutgefäße, der Stoffwechsel, das Immunsystem und die Muskulatur. Die hierdurch ausgelösten Temperaturreize helfen nachhaltig, wobei der richtige Einsatz des Wassers eine wesentliche Rolle spielt. Die Grundregeln sind bei allen Wassertherapien gleich: Kein kaltes Wasser auf kalte Haut. Die Gliedmaßen müssen warm sein durch Bewegung, ein warmes Fußbad, durch warme Luft in der Sauna oder Bettruhe. Die Kuren bewirken hinterher eine wohlige, entspannende Wärme im ganzen Organismus. Ausgekühlte Gliedmaßen schwächen den Körper und haben unangenehme Nebenwirkungen. Zu der Wassertherapie nach Kneipp zählen Waschungen, Wickel, kalte Güsse, Wechselgüsse und Bäder.
Zuhause Kneippen

Wasser ist ein zentrales Element in der Kneippschen Lehre.
Die Maßnahmen sind ein bewährtes Hausmittel und lassen sich auch ohne fachmännische Unterstützung regelmäßig in jedem Badezimmer durchführen. Dafür bedarf es einfacher Mittel wie eines Schlauchs, Fußgitters, Rost oder Matte und einer Fußbadewanne.
Wichtigste Regel: Um einen sanften Reiz zu bewirken, alle kalten Wasserkuren nur bei warmen Gliedern anwenden. Bei kalten Füßen wäre der Reiz zu stark und würde die Selbstheilungskräfte hemmen oder auflösen. Sanfte Reize fördern sie, deswegen darauf achten, dass der Körper warm ist.

Kneippsche Wassergüsse trainieren die Gefäße, regen den Kreislauf und die Atmung an.
So kneippen Sie zuhause richtig: Den Wasserstrahl so einstellen, dass er handbreit und beinahe drucklos als „Wassermantel“ über die Haut fließen kann. Mit dem Schlauch der Handbrause und einem verstellbaren Duschkopf lassen sich die Güsse gut durchführen. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, sind die Temperaturreize so lange zu setzen, bis eine verstärkte Durchblutung eintritt. Die Wassertemperatur liegt bei 14 bis 18 °C. Wichtiger dabei ist es, auf das eigene Wärmeempfinden zu achten. Bei kalten Füßen, frösteln, frieren oder Kälteempfindlichkeit den kalten Guss durch einen Wechselguss ersetzen. Jede Schockwirkung auf das Herz, den Kreislauf und die Atmung vermeiden.
Es wird zuerst die rechte, herzferne Körperseite behandelt, damit sich das Herz an die Maßnahme gewöhnen kann. Die erste Reaktion ist ein leichter Kälteschmerz, darauf folgen eine leichte Hautrötung und ein angenehmes Wärmegefühl. Wird die Haut blau, war der Guss zu lange. Die Dauer eines kalten Gusses hängt vom persönlichen Empfinden ab. In der Regel dauert er 40 bis 60 Sekunden. Die Anwendungen zwei- bis dreimal wöchentlich durchführen, frühestens zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Zwischen mehreren Anwendungen dem Körper jeweils zwei Stunden Zeit geben, weil er aktiviert ist und die Beine kräftig durchblutet, sonst wäre das zu viel.

Die Kneippschen Kälteanwendungen wie Wassertreten sind ein angesehenes Verfahren, um Venen zu unterstützen und zu stärken.
Der kalte Guss erfrischt besonders bei müden, schweren Beinen und ist Teil eines effektiven Gefäßtrainings. Die regelmäßige Anwendung lindert unruhige Beine, Schwellungen und Stauungen, Krampfaderbeschwerden, Schmerzen in Waden und Füßen. Der Knieguss bietet Hilfe bei Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Wärmestau und Hitzeerschöpfung im Sommer. Abends angewendet wirkt der kalte Knieguss gegen Schlafstörungen.
Kontraindikationen: Akute, fiebrige Erkrankungen, Blasenentzündung, Nierenentzündung, Unterleibsentzündung, schwere, arterielle Durchblutungsstörungen, Menstruation, Frieren und Frösteln.
Anwendung: Damit das Wasser schön abfließen kann und man nicht im kalten Wasser steht (Abkühlungsgefahr), in die Badewanne ein Rost oder eine Matte legen. Den Wasserstrahl eine Handbreit entfernt vom rechten, kleinen Zeh über den Fußrücken an der Außenseite der Wade entlangführen bis eine Handbreit oberhalb des Knies. Dort fünf Sekunden verweilen, den Schlauch hin- und her bewegen, wobei das Wasser als Wassermantel abfließt. Weiter den Strahl an der Innenseite zurück bis zur Ferse führen. Nun genauso den Wasserstrahl am anderen, linken Bein hochführen und oberhalb des linken Knies fünf Sekunden verweilen. Um den Reiz zu verstärken, in gleicher Höhe auf die rechte Seite wechseln und dort fünf Sekunden verweilen. Zurück nach links wechseln, das Wasser wieder fünf Sekunden wirken lassen und den Wasserstrahl an der Innenseite zur linken Ferse leiten. Ein leichter Kälteschmerz zeigt die Reaktion an. Zum Schluss die Fußsohlen behandeln. Erst den rechten Fuß von vorne nach hinten und zurück, das gleiche am linken Fuß durchführen.
Den Körper durchströmt erst eine angenehme Kühle, gefolgt von einer wohligen Wärme. Wichtig: Das Wasser nur abstreifen, wodurch ein Wasserfilm mit Verdunstungswärme auf der Haut entsteht, der den Reiz verstärkt. Niemals abtrocknen. Aktives Bewegen nach dem Knieguss wirkt anregend, im Bett eingewickelt zu liegen wirkt entspannend. Beides sorgt für eine Wiedererwärmung.

Alle kalten Wasserkuren nur bei warmen Gliedmaßen anwenden und die Anleitungen genau befolgen!
Kalter Schenkelguss
Der Schenkelguss beginnt wie der kalte Knieguss, wobei der Wasserstrahl über den Oberschenkel bis in Höhe des Gesäßes geführt wird. Durch die größere gereizte Hautfläche ist das Gefäßtraining stärker. Das beugt Krampfadern vor und verhilft zu schönen Beinen. Der Guss kräftigt die Venen und das Bindegewebe. Er hilft gegen venöse Durchblutungsstörungen, Zellulitis und Fußschweiß. Bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Bluthochdruck (leitet das Blut aus dem Kopf) ist er nützlich. Abends angewendet, hilft der kalte Schenkelguss gegen Schlafstörungen und beruhigt die Nerven.
Kontraindikationen: Siehe kalter Knieguss. Akute Ischialgie (Schmerzen im Bereich des Ischiasnerv).
Anwendung: Den Wasserstrahl vom rechten, kleinen Zeh über den Fußrücken an der Außenseite der Wade entlang über das seitliche Knie bis zur Leistenbeuge führen. Dort fünf Sekunden verweilen und an der Innenseite zurück zum Fuß. Am linken Bein den Wasserstrahl genauso führen, fünf Sekunden in der Leistenbeuge verweilen. Zur Verstärkung des Reizes nach rechts und zurück nach links wechseln und das Wasser jeweils fünf Sekunden wirken lassen. Zum Schluss den Wasserstrahl an der Innenseite zur linken Ferse leiten und beide Füße erst rechts, dann links begießen. Das Wasser an den Beinen abstreifen, nicht abtrocknen, und entweder aktiv bewegen oder in einer Decke eingerollt ruhen, bis der Körper angenehm wohlig warm ist.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842688278
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (März)
- Schlagworte
- Venen Krampfadern Traditionelle Chinesische Medizin TCM Alternative Medizin Bewegung Gesundheits-Ratgeber