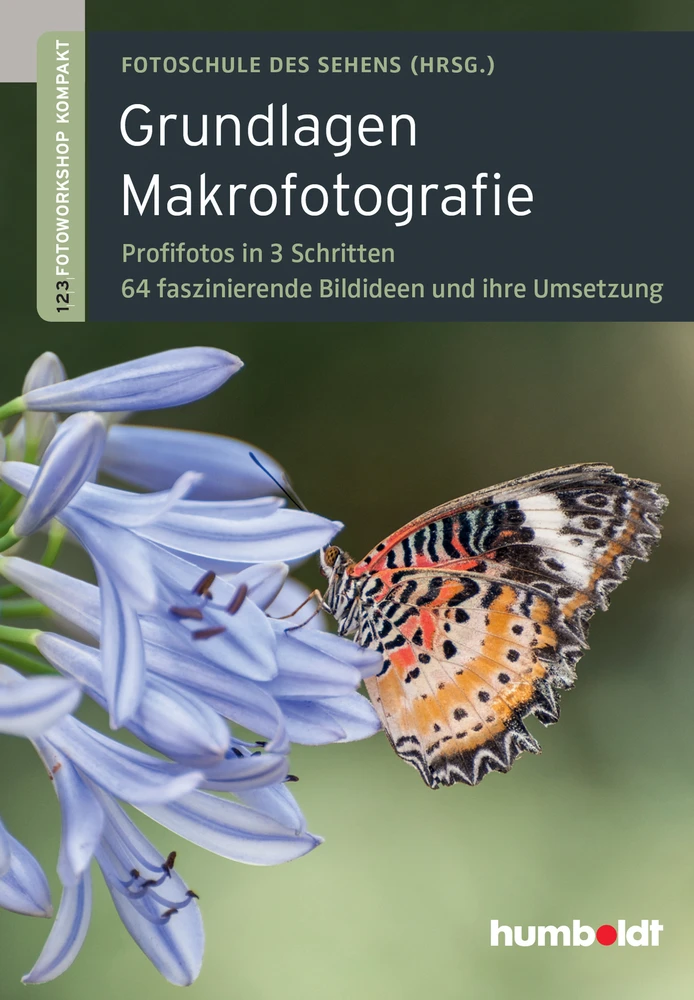Grundlagen Makrofotografie
1,2,3 Fotoworkshop kompakt. Profifotos in 3 Schritten. 64 faszinierende Bildideen und ihre Umsetzung
Zusammenfassung
Für alle Einsteiger in die Makrofotografie, die sich nicht mit Theorie aufhalten möchten: Die zahlreichen Bildideen, Anleitungen und Tipps lassen Sie selbst als Anfänger schnell professionelle Aufnahmen machen. In drei kleinen Schritten lernen Sie, wie Sie Ihre Kamera einstellen müssen, um Makro-Motive gekonnt in Szene zu setzen. Das Grundlagenbuch für beeindruckende Nahaufnahmen!
Für alle wichtigen Indoor- und Outdoor-Makromotive: Pflanzen, Insekten, Produkte und vieles mehr.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis


Der Fotografenmeister Peter Uhl gründete zusammen mit seiner Frau, der Diplom-Biologin und Fotografin Martina Walther-Uhl, 2008 die Fotoschule des Sehens.
Zunächst starteten sie mit einem kleinen Fotoseminarangebot im Raum Hannover. Doch aufgrund stark wachsender Nachfrage zu verschiedensten Fotothemen vergrößerten sie kontinuierlich ihr Fotoseminarangebot, nicht nur thematisch, sondern auch regional. Heute bieten beide als Fotoschule des Sehens europaweit etwa 100 ein- und mehrtägige Fotoseminare pro Jahr an. Das komplette Seminarangebot ist auf der Website www.fotoschule-des-sehens.de ersichtlich.


Der Erfolg liegt nicht nur im fundierten fachlichen Wissen, das beide in den Fotoseminaren vermitteln. Eine große Rolle spielt auch die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge der Fotografie leicht verständlich und für jedermann schnell erfassbar zu beschreiben. Die Seminaratmosphäre ist so gestaltet, dass jede Frage ernst genommen und ausführlich beantwortet wird.
In allen Fotoseminaren kommt immer wieder ein Leitsatz für die Fotografie zum Ausdruck: Fotografieren soll Spaß machen und neue Sichtweisen ermöglichen, aber nicht zum Leistungsdruck werden.
VORWORT
Makrofotografie – bei diesem Begriff denken viele sicherlich an Großaufnahmen von Hummeln und Bienen auf Blüten, an riesige Insektenaugen, bei denen man die einzelnen Facettenaugen erkennen kann, oder an Blütenaufnahmen mit interessant angelegter Schärfe und Unschärfe an den Staubgefäßen und am Stempel der Blüte.
Diese Bilder bezaubern und prägen sich ein. Neben den ausdrucksstarken und faszinierenden Aufnahmen von Tier- und Pflanzendetails gibt es natürlich noch viele weitere Themen für die Makrofotografie. Beispielsweise das Fotografieren von Schmuck oder Münzen oder Makroaufnahmen der unbelebten natürlichen Umwelt wie Versteinerungen, Sandkörner und kleine Steine, die erst beim genauen Hinschauen ihre Farbigkeit und Strukturen verraten.
Wir, die Fotoschule des Sehens, möchten Sie mit diesem Buch an die Makrofotografie heranführen und Ihnen die Befürchtung nehmen, dass Makrofotografie immer kompliziert und teuer sein muss. Außerdem möchten wir Anregungen für interessante Motive geben, egal ob draußen in der freien Natur oder drinnen auf dem Tisch. Dabei werden wir natürlich nicht die unendlich vielen Möglichkeiten komplett erfassen und Ihnen aufzeigen können. Doch wir hoffen, Sie mit unserem Buch auf Ideen zu bringen, was man alles einfach mal durch die „Makrobrille“ betrachten könnte. Für die 63 Workshops haben wir daher Motive gewählt, die Ihnen im Alltag drinnen und draußen begegnen könnten. Genau wie in unseren fotografischen Seminaren, Workshops, Wanderungen und Reisen möchten wir Ihnen Technik und Vorgehen so vermitteln, dass diese jederzeit von allen mit einfachen Mitteln nachgemacht werden können. Jeder, der gerne fotografiert, auch wenn er gerade erst damit angefangen hat, soll Anregungen bekommen und sich zutrauen können, mit unseren Anleitungen ähnliche Makrofotos selbstständig machen zu können. Auf den Punkt gebracht: Dieses Buch wird Sie unterstützen, sich auf die Makrofotografie vorzubereiten, es wird Anregungen für Motive geben und Ihnen Lust machen, vieles selber auszuprobieren.
Alle unsere Empfehlungen, Anleitungen und Veranschaulichungen fototechnischer Sachverhalte sind auf der Basis unserer Erfahrungen, die wir in unseren Fotoworkshops gemacht haben, entstanden und geben daher oftmals unsere ganz persönliche Bewertung und Meinung wieder. Wir hoffen, Ihnen mit unseren Tipps neue Anregungen und Ideen für gelungene Makrofotos geben zu können und wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken kleiner Dinge und Details in der Welt der Makrofotografie.
Viel Spaß beim Fotografieren wünschen Ihnen
Peter Uhl und Martina Walther-Uhl
von der Fotoschule des Sehens
FASZINATION
MAKROFOTOGRAFIE
In der Makrofotografie heißt es, kleine Dinge ganz groß abzulichten. Egal, ob man ein Makroobjektiv hat oder die preisgünstigere Variante der Makrolinse oder der Zwischenringe wählt, man entdeckt Dinge, die man nie zuvor gesehen hat.
So klein ist Makro
Am Strand können es kleine Muscheln und Schneckenhäuser sein, im Wald vielleicht Insekten oder kleine Baumpilze, die Sie in den Bann ziehen. Aber auch Mineralien, Versteinerungen, Schmuckstücke oder Münzen zeigen sich in der Makrofotografie von einer Ihnen noch unbekannten Seite. Man entdeckt Dinge, die man oftmals mit bloßem Auge, ohne weitere Hilfsmittel wie z. B. einer Lupe, nicht oder nur sehr undeutlich wahrnehmen würde. Hierin liegt die Faszination der Makrofotografie. Es ist wie ein Ausflug in eine andere Welt, und wer einmal Feuer gefangen hat, kann nicht mehr aufhören, sich kleine Dinge ganz groß anzusehen.
Manch einer fragt sich vielleicht, ab welchem Abbildungsmaßstab genau die Makrofotografie anfängt. Ob es da eine exakte Trennung gäbe zwischen noch gerade Makro und nicht mehr Makro. Hier kann vielleicht die Definition der Deutschen Industrie Norm (DIN) weiterhelfen, die Aufnahmen mit Abbildungsmaßstäben von 1:10 bis 10:1 als Nah- und Makrobereich zusammenfasst.
Ein Abbildungsmaßstab von 1:10 bedeutet, dass das Objekt in 1/10 seiner Originalgröße aufgenommen wird. Bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1 wäre dann das Objekt genau so groß aufgenommen, wie es im Original groß ist und bei 10:1 würde es bei der Aufnahme 10-fach vergrößert werden. So verführerisch das auch klingen mag, einen Pferdefuß hat die ganze Sache: Zu kämpfen hat jeder, der sich mit der Makrofotografie beschäftigt, mit der geringen Schärfentiefe, die umso mehr abnimmt, je größer der Abbildungsmaßstab ist.
Der Grundproblematik, nämlich dass die Schärfentiefe bei einem größer werdenden Abbildungsmaßstab immer weiter abnimmt, kann keiner ausweichen. Im Workshopteil des Buches zeigen wir Ihnen aber, wie Sie die geringe Schärfentiefe ein bisschen überlisten können (siehe Workshop „Mehr Schärfentiefe durch Kamerastandpunkt“).
Nahe rangehen, aber nicht zu nah
Damit Sie in die Welt der Makrofotografie eintauchen können, benötigen Sie entweder ein spezielles Makroobjektiv oder die Alternativen dazu (siehe Kapitel „Alternativen zu Makroobjektiven“). Mit Makroobjektiven kann und muss man nahe an das Fotoobjekt herangehen, um es groß abzulichten, denn der Abbildungsmaßstab ist abhängig von der Entfernung zum Motiv. Je näher man mit dem Makroobjektiv herangeht – natürlich nur bis zu einem bestimmten Mindestabstand – desto größer ist der Abbildungsmaßstab. Maximal erreicht man mit Makroobjektiven einen Abbildungsmaßstab von 1:1.
Wenn wir unsere Teilnehmer fragen, was ihnen zum Begriff Makrofotografie einfällt, hört man meist „ganz nahe herangehen“ und „möglichst groß abbilden“. Im zweiten Atemzug wird dann „viel Detailschärfe“ genannt. Leider liegt darin ein gewisser Widerspruch, mit dem sich jeder, der Makroaufnahmen macht, auseinandersetzen muss. Denn mit dem „nahe Herangehen“ fangen die Probleme an. Hier treffen wir auf die Problematik der abnehmenden Schärfentiefe bei einem größer werdenden Abbildungsmaßstab. Natürlich gibt es für jedes Bild einen gewissen Grad an Unschärfe, der es auch spannend macht, denn Unschärfe ist ein schönes Gestaltungsmittel. Wird jedoch das richtige Maß überschritten, dann überlagert die Unschärfe die eigentliche Bildaussage, und der Betrachter erkennt nicht mehr sofort das, worauf es Ihnen bei der Aufnahme ankam.
Wenn die Schärfentiefe trotz weiteren Schließens der Blende (siehe Kapitel „Schärfentiefe im Bild“) nicht ausreicht, gehen Sie einfach ein kleines Stück zurück und nehmen Ihr Motiv etwas kleiner auf, dafür aber mit mehr Schärfe. Am besten also nah ran, aber nicht zu nah.
ALLGEMEIN GILT:
Je größer der Abbildungsmaßstab und je weiter geöffnet die Blende (kleiner Blendenwert), desto geringer ist die Schärfentiefe. Wenn das Schließen der Blende für die gewünschte Schärfentiefe nicht ausreicht, gehen Sie mit der Kamera einfach ein bisschen zurück. Dann wird der Abbildungsmaßstab kleiner und der Schärfentiefenbereich wächst.
Aber damit, die Blende einfach weit zu schließen, um auf die gewünschte Schärfentiefe zu kommen, ist es leider auch noch nicht getan. Denn jetzt kommt die Belichtungszeit ins Spiel (siehe Kapitel „Blende“), die dann für einige Aufnahmen, insbesondere draußen, wenn Bewegung mit im Spiel ist, zu lang wird.
Doch keine Sorge, diese Schwierigkeiten haben alle, die im Makrobereich fotografieren. Wenn Sie erst einmal ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, werden Sie schnell erkennen, was machbar ist und wo die Grenzen der Fotografie bzw. der Optik liegen. Wir werden Sie unterstützen, das Mögliche aus der Makrofotografie herauszuholen.
Lassen Sie sich auf jeden Fall genügend Zeit, um die Möglichkeiten und Grenzen der Makrofotografie zu entdecken und auszuprobieren.
Makro-Motive sind überall
Motive für die Makrofotografie finden Sie eigentlich überall. Ob draußen in freier Natur, im Garten oder auf dem Balkon oder auch drinnen in der Wohnung, in der Küche oder im Keller – lassen Sie den Blick schweifen und Sie entdecken zahlreiche Motive. Die Rahmenbedingungen, die Sie bei der Makrofotografie draußen und drinnen erwarten, sind teilweise identisch, wie z. B. die geringe Schärfentiefe, teilweise aber auch sehr unterschiedlich, wie z. B. die Lichtsituation und der Einfluss des Windes.
Makrofotografie draußen: Für viele ist es eine ganz große Freude, draußen in der Natur auf Motivsuche für Makrofotos zu gehen. Typische Makromotive, die Sie draußen in der Natur finden, sind beispielsweise im Wald kleine Schnecken, winzige Baumpilze, Moose oder Flechten. Am Strand können es Muscheln, Sandkörner und Bewuchs auf angespülten Holzteilchen oder auf Seetang sein, die Ihre Neugierde wecken. Und natürlich auch Insekten und Spinnen. Wer hat noch nicht einmal versucht, eine flink auf der Blüte umhereilende Biene oder Hummel zu fotografieren, oder eine scheinbar so langsam kriechende Schnecke. Die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, sind sicher vielfältig, doch vielleicht werden Sie das eine oder andere von dem, was wir im Folgenden beschreiben, wiedererkennen.
Im Gegensatz zur Fotosituation drinnen, müssen Sie draußen im Großen und Ganzen mit dem Vorliebnehmen, was da ist. Das beginnt mit der Motivsuche. Wenn Sie gerne Insekten fotografieren, sollten Sie zur richtigen Jahreszeit unterwegs sein und im Wald, auf den Wiesen oder im botanischen Garten Ausschau halten. Je nach Habitat werden Sie die verschiedensten Insekten finden: Bienen auf Blüten, Heuschrecken auf Wiesen und Libellen an Waldrändern oder an Fließ- und Stillgewässern. Einige der Insekten lassen sich nicht so schnell stören, doch andere fliegen bei der kleinsten Beunruhigung davon. Deshalb sollten Sie sich den Insekten möglichst langsam annähern, fast so, als würden Sie sich in Zeitlupe bewegen. Dann haben Sie gute Chancen, nahe genug heranzukommen. Auch wenn wir für die Makrofotografie ein Stativ für unbedingt erforderlich halten, bei der Insektenfotografie kann es sich als hinderlich und sperrig erweisen. Eine Möglichkeit, trotzdem auf eine sehr kurze Belichtungszeit zu kommen, ist, den ISO-Wert höher zu stellen (siehe Kapitel „ISO und das Tauschgeschäft“). Schwierig wegen des oftmals hohen Kontrastes sind dunkle Hummeln auf hellen Blüten. Hier wird die im Verhältnis zur Hummel relativ große helle Blüte meist richtig belichtet, die dunklere Hummel dagegen lässt keine Details erkennen. Bitte blitzen Sie die Insekten bei der Aufnahme nicht an, denn es schadet ihren Facettenaugen. Lernen Sie lieber die von uns „Geheimtaste“ genannte Taste zur Belichtungskorrektur kennen und einzusetzen (siehe Kapitel „Die Geheimtaste zur Belichtungskorrektur“).
Ein anderer typischer Faktor im Freien ist der Wind, der einige der Motive zum Wackeln bringen kann, z. B. Blumen, Gräser und Insekten auf Blüten. Hier helfen nur sehr kurze Belichtungszeiten und ein wenig Geduld, denn die Windstärke variiert. Mal ist sie stärker, dann wieder schwächer, bis hin zum kurzen Stillstand. Und diesen Moment gilt es abzuwarten und dann auszulösen.
Dann wäre da noch die Lichtsituation draußen zu nennen, auf die man allerdings bedingt Einfluss nehmen kann. Je nachdem, ob die Sonne scheint oder ob es bewölkt ist, ob Sie auf einer freien Wiese oder im belaubten Wald fotografieren, haben Sie unterschiedliche Lichtsituationen. Die pralle Mittagssonne lässt Farben gerne ausbleichen. Reflexionen machen das Motiv weiß, oder am dunklen Waldboden bekommen die schönen Lamellen an der Unterseite von einigen Pilzen nicht genügend Licht, und man erkennt vor lauter Schatten keine Strukturen. Hier helfen, je nach Situation verschiedene Hilfsmittel: zum Aufhellen ein Reflektor oder eine Taschenlampe oder, um das Licht weicher zu machen, ein Diffusor (siehe Kapitel „Nützliche Utensilien für die Makrofotografie“).
Zum Fotografieren draußen abschließend noch eine Bitte: Machen Sie Fotos nicht um jeden Preis. Das soll heißen, bitte reißen oder schneiden Sie nicht umstehende Pflanzen heraus, nur um besser an Ihr Motiv heranzukommen. Bei Pflanzen finden sich häufig noch andere Exemplare in der Nähe, an die Sie vielleicht besser heranreichen. Auch Insekten oder Spinnen sollten nicht, nur um sie zu Hause im Miniterrarium zu fotografieren, gefangen und mitgenommen werden. Neben den naturschutzrechtlichen Aspekten ist für uns hier der respektvolle Umgang mit unserer Umwelt das wichtigste Argument.
Makrofotografie drinnen: Auch wenn Sie Ihre Makromotive im Innenraum suchen, werden Sie einiges entdecken, von dem Sie nicht gedacht hätten, es irgendwann einmal zu fotografieren. Schauen Sie doch einfach mal in die Küche, welches Gemüse sich gut eignen würde. Vielleicht schwebt Ihnen eine Aufnahme von einem dünnen Querschnitt einer Kiwischeibe vor. Auch gesammelte Versteinerungen, Mineralien, Münzen und Schmuckstücke eignen sich bestens.
Die größte Freiheit für die Makrofotografie drinnen ist, dass Sie Ihre Motive weitestgehend unabhängig von der Jahreszeit und vom Tag- und Nachtrhythmus fotografisch umsetzen können. Für viele stellt somit die Makrofotografie drinnen eine schöne Überbrückung der Winterzeit dar, wenn die Natur nicht die gewünschten Motive bietet oder wenn es für das Fotografieren draußen zu kalt ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie vom natürlichen Licht unabhängig sind. Als Lichtquelle können Sie natürlich auch das Tageslicht, das durchs Fenster fällt, mit einbeziehen und eine Lichtsituation aus Mischlicht etablieren. Sie können das Tageslicht aber auch ganz weglassen und nur mit künstlichem Licht Ihr Motiv ausleuchten. Dazu eignen sich beispielsweise Leuchtkästen, Schreibtischlampen, Taschenlampen und Ähnliches (siehe Kapitel „Nützliche Utensilien für die Makrofotografie“).
Ein Sonderfall für die Makrofotografie drinnen sind die Aufnahmen von lebenden Schmetterlingen in Schmetterlingshäusern. Hier werden Sie mit einigen Bedingungen konfrontiert, die denen draußen ähneln. Denn wer denkt, dass es in Schmetterlingshäusern keine Bewegung durch Wind gäbe, irrt gewaltig. Neben dem Wind, der aus Belüftungsanlagen durchs Schmetterlingshaus weht und die Pflanzen in Bewegung versetzt, können Luftzüge auch durch Vögel, die oftmals gemeinsam mit den Schmetterlingen im gleichen Schauhaus gehalten werden, verursacht werden. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass der Temperaturunterschied zwischen dem Schmetterlingshaus und draußen, von wo Sie kommen, dazu führt, dass Objektive und Kameragehäuse beschlagen und einige Zeit benötigen, wieder klar zu werden. Hier lohnt es sich, die Kamera „vorzuwärmen“ (siehe Kapitel „Nützliche Utensilien für die Makrofotografie“).
MAKROOBJEKTIVE
Makroobjektive zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit einem besonders geringen Objektabstand eingesetzt werden können und dass dadurch ein besonders großer Abbildungsmaßstab möglich wird. Das heißt, Sie können recht nahe an Ihr Motiv herangehen und es recht groß abzubilden.
„Echte“ Makroobjektive haben immer feste Brennweiten, beispielsweise mit 60 mm, 70 mm, 100 mm, 105 mm, 150 mm oder mit 180 mm. Sie sind durchweg sowohl im Fernbereich als auch bei großen Abbildungsmaßstäben von guter Qualität und universell einsetzbar. Allesamt können sie maximal bis zu einem Maßstab von 1:1 abbilden. Das heißt, wenn man so nahe, wie vom Objektiv aus möglich, herangeht, kommt man auf einen Abbildungsmaßstab von 1:1. Das klingt erst einmal so, als wäre es völlig egal, welches Makroobjektiv Sie für Ihre Aufnahmen nehmen. So ist es aber nicht. Denn bei einem 70-mm-Makroobjektiv sind Sie wirklich nur wenige Zentimeter vom Objekt entfernt, wenn Sie es groß abbilden wollen. Doch nicht jedes Motiv lässt sich dies ohne Weiteres gefallen. Bei Makroaufnahmen von Briefmarken, Sand, Steinen, Pflanzenteilen oder Flechten ist dies grundsätzlich kein Problem. Wenn Sie allerdings Insekten oder Spinnen ablichten möchten, schafft diese Nähe oftmals Probleme, denn jedes Insekt hat eine Fluchtdistanz. Wenn Sie diese unterschreiten, flieht es und Sie müssen sich ein neues Motiv suchen. Deshalb sollten Sie bei der Aufnahme von Insekten, Spinnen und anderen kleinen Tieren immer ein Makroobjektiv mit einem größeren Mindestabstand wählen. Für Sie ist wichtig, zu wissen: Der Mindestabstand zwischen Objektiv und Objekt vergrößert sich mit größer werdender Brennweite.

Erforderliche Abstände zum Motiv beim
Abbildungsmaßstab von 1:1.
| WICHTIG: NAHEINSTELLGRENZE |  |
Der Mindestabstand zwischen Motiv und Sensorebene wird Naheinstellgrenze oder kürzeste Einstellentfernung genannt. Dabei erreichen Sie mit Ihrem Makroobjektiv einen Abbildungsmaßstab von 1:1. Die Naheinstellgrenze können Sie an Ihrem Objektiv ablesen. Aber Achtung: Diese Entfernung stellt den Mindestabstand von Kamerasensor bis zum Motiv dar. In der Praxis ist aber der Abstand von der Frontlinse Ihres Objektivs zum Motiv wichtig und diese Entfernung ist viel geringer als die an Ihrem Objektiv angegebene Entfernung. Beispiel: Auf dem 150-mm-Makroobjektiv von Sigma lesen Sie eine Mindestentfernung von 38 cm bei 1:1 ab. Der Mindestabstand von der Frontlinse bis zum Motiv beträgt aber real nur 19 cm, da Sie von der auf dem Objektiv angegebenen Entfernung noch den Abstand von der Frontlinse des Objektivs bis zum Sensor abziehen müssen. Bei dem genannten 150-mm-Makroobjektiv beträgt dies ebenfalls 19 cm.
Makroobjektive um 70 mm Brennweite sind relativ preisgünstig und haben wenig Gewicht. Als nachteilig kann sich bei ihnen erweisen, dass man sehr nahe an das Motiv herangehen muss und dass bei Insekten dabei meist die Fluchtdistanz unterschritten wird. Außerdem kann es passieren, dass Sie durch das nahe Herangehen ans Motiv dieses mit dem Objektiv und der Kamera abschatten und sich dabei selbst das für kürzere Belichtungszeiten oder für einen höheren Blendenwert nötige Licht wegnehmen. Bei Aufnahmen von unbelebten Motiven oder von Pflanzen und Flechten ist dieses Makroobjektiv gut einsetzbar, denn zum einen laufen diese nicht weg und zum anderen können Sie hier problemlos aufhellen oder zusätzliches künstliches Licht einsetzen, ohne die Flucht des Motivs auszulösen.
Makroobjektive um 100 mm sind wohl die am meisten gekauften Makroobjektive. Ihr Vorteil gegenüber den kleineren Brennweiten ist der größere Arbeitsabstand, sodass zum einen die Gefahr des Schattenwurfs geringer ist. Zum anderen kommen Sie damit gut an Insekten heran, da Sie mehr Abstand haben und die Fluchtdistanz bei vielen Insekten nicht unterschreiten. Das 100-mm-Makroobjektiv ist allerdings etwas teurer und auch schwerer als die 70-mm-Version.
Makroobjektive um 150 mm und mit 180 mm Brennweite sind von den drei genannten Klassen die schwersten und wohl auch die teuersten. Ihr Vorteil ist, dass man sie gut für das Fotografieren von kleinen Tieren mit etwas größerer Fluchtdistanz, wie z. B. Fröschen nutzen kann. Auch eine Beschattung des Fotoobjekts durch das Objektiv ist nahezu ausgeschlossen. Nachteil ist allerdings ihr Gewicht und damit die Gefahr, schnell zu verwackeln, sollte man sie mal ohne Stativ einsetzen.
Makrozoomobjektive sind – wie dargelegt – keine Makroobjektive im eigentlichen Sinne, denn echte Makroobjektive haben immer Festbrennweiten. Makrozoomobjektive sind Zoomobjektive mit einer erweiterten Einstellgrenze, die es erlaubt, näher an das Objekt heranzugehen und so einen größeren Abbildungsmaßstab zu erreichen. Sie sind allerdings nicht für den Makrobereich optimiert, das heißt, dass die Abbildungsqualität nicht an die eines „echten“ Makroobjektives heranreicht.
ALTERNATIVEN ZU
MAKROOBJEKTIVEN
Wenn Sie nun noch kein Makroobjektiv besitzen und auch erst einmal ausprobieren möchten, ob Ihnen das Thema „Makrofotografie“ gefällt, gibt es natürlich verschiedene Alternativen, um mit Ihrem Normalobjektiv oder Zoomobjektiv Makroaufnahmen zu machen, beispielsweise mit einer Nahlinse, mit Zwischenringen oder mittels Umkehrring.
Nahlinsen sind Objektivvorsätze, die Sie in das Filtergewinde Ihres bereits vorhandenen Objektivs einschrauben. Durch die Nahlinse verringert sich der Abstand, den Sie zwischen Objektiv und Ihrem Motiv einhalten müssen. Dadurch vergrößert sich der Abbildungsmaßstab. Sie können Ihr Motiv nun also größer ablichten, als wenn Sie das Objektiv ohne die Nahlinse eingesetzt hätten. Allerdings können Sie, wenn Sie eine Nahlinse auf das Objektiv geschraubt haben, mit Ihrem Objektiv nicht mehr auf unendlich scharf stellen. Das heißt: Mit der Nahlinse haben Sie – anders als beim Makroobjektiv – immer nur einen ganz kleinen Bereich, in dem die Schärfe liegt und den Sie nicht durch den Autofokus oder manuelles Fokussieren verlegen können. Sie müssen sich selber aktiv auf das Motiv so lange zubewegen, bis es sich in der Schärfeebene befindet.

Vergleich Schärfebereich Makroobjektiv und Objektiv
mit Nahlinse.
Die folgende Übung zeigt Ihnen, wie weit Sie mit dieser Kombination von Objektiv und Nahlinse an Ihr Motiv herangehen müssen, um in den Schärfebereich zu kommen, und wie schnell Sie wieder aus dem Schärfebereich heraus sind.
ÜBUNG ZUM SCHÄRFEBEREICH VON NAHLINSEN
Um zu testen, wie weit Sie mit der vor Ihr Objektiv geschraubten Nahlinse an Ihr Motiv herangehen müssen, bis Sie den Abstand zwischen Objektiv und Motiv gefunden haben, in dem der Schärfebereich der Nahlinse liegt, empfehlen wir Ihnen Folgendes: Bewegen Sie sich einfach, während Sie durch die Kamerasucher schauen, langsam auf ein Bücherregal zu. Zunächst ist alles unscharf, plötzlich können Sie die Buchtitel auf den Buchrücken lesen, und wenn Sie sich weiter darauf zu bewegen, wird es schnell wieder unscharf.
Nahlinsen gibt es in verschiedenen Stärken, z. B. mit +1, +2, +3, +4, +8 und +10 Dioptrien. Je stärker die Nahlinse, desto näher müssen Sie an Ihr Motiv herangehen und umso kleiner ist auch der Bereich der Schärfentiefe. Auch verschlechtert sich mit zunehmendem Abbildungsmaßstab die Abbildungsqualität. Abbildungsmaßstäbe bis zu 1: 4 sind mit Nahlinsen in guter Qualität erreichbar. Darüber hinaus lässt die Abbildungsleistung vor allem im Randbereich meist nach. Im direkten Vergleich mit Makroobjektiven sind die optische Qualität und der Benutzungskomfort in der Regel geringer. Zwei ganz große Vorteile haben Nahlinsen aber trotzdem: der erste ist, dass sie recht preisgünstig sind und somit ein Hineinschnuppern in die Makrofotografie erleichtern. Der andere Vorteil ist, dass sie – anders als Zwischenringe – keinen Lichtverlust verursachen.
Einen Spezialfall der Nahlinsen bilden die hochwertigen Achromaten. Bei ihnen sind zwei Linsen fest zusammengekittet und es sind die physikalisch möglichen Abbildungsfehler nahezu korrigiert. Dafür sind sie teurer als einfache Nahlinsen.
Zwischenringe werden im Gegensatz zur Nahlinse nicht vor das Objektiv geschraubt, sondern direkt zwischen Kameragehäuse und Objektiv gesetzt. Zwischenringe werden meist als Satz, bestehend aus drei unterschiedlich langen Ringen, angeboten, die miteinander kombinierbar sind. Zwischenringe erkennen Sie daran, dass Sie mit dem Finger durch das Loch des Ringes fassen können. Es ist keine Linse dazwischengesetzt. Somit gibt es auch durch den Einsatz der Zwischenringe keine optische Beeinträchtigung und keinen Qualitätsverlust durch eine zusätzliche vielleicht nicht ganz so hochwertige Linse. Das Scharfstellen funktioniert mit den Zwischenringen genau so wie mit einer aufgeschraubten Nahlinse: Sie haben nur einen sehr kleinen Bereich innerhalb dessen Sie scharf stellen können, und auf diesen bewegen Sie sich am besten langsam aktiv zu. Genau wie bei den Nahlinsen mit steigender Dioptrienzahl wird auch hier der Schärfebereich umso kleiner, je dicker der Zwischenring oder die Kombination der Zwischenringe ist. Die Übertragung von Belichtungsmessung und Autofokus der Kamera bleibt beim Fotografieren mit Zwischenringen nur dann erhalten, wenn Sie Automatikzwischenringe kaufen, die speziell mit Ihrer Kamera kompatibel sind. Manuelle Zwischenringe, die preisgünstiger sind, enthalten diese Funktionen meist nicht. Bei der Verwendung eines 50-mm-Objektivs in Kombination mit einem Zwischenring von 50 mm erhalten Sie einen Abbildungsmaßstab von 1:1, genau wie bei einem Makroobjektiv.
Ein Nachteil von Zwischenringen ist, dass durch die Verlängerung des Auszugs – zu der Länge Ihres Objektivs sind ja auch noch die Zwischenringe dazugekommen – Licht „geschluckt“ wird, sodass Sie entweder längere Belichtungszeiten benötigen, oder – wenn möglich – einen kleineren Blendenwert einstellen müssen, was wiederum eine Abnahme der Schärfentiefe zur Folge hat. Hier muss man also abwägen, was das Motiv braucht und was nicht.
Objektive in sogenannter Retrostellung erlauben – ebenso wie die beiden vorherigen Beispiele – Makrofotografie ohne aufwendige technische Ausrüstung. Benötigt wird nur ein Umkehrring, mit dem sich ein Wechselobjektiv verkehrt herum an den Objektivanschluss des Gehäuses Ihrer Spiegelreflexkamera ansetzen lässt. Also zeigt das Objektiv nun mit seiner Frontlinse in Richtung Kameragehäuse, und der Teil, der sonst im Gehäuse arretiert wird, zeigt nun auf das Motiv. Wegen der Bauweise der meisten Objektive vergrößert sich der Abbildungsmaßstab beim Fotografieren mit einem Objektiv in Retrostellung.
Die Vorteile dieser Art der Makrofotografie sind zum einen, dass – anders als bei den Zwischenringen – kein Lichtverlust auftritt ist, denn der Auszug wurde ja nicht verlängert, es ist und bleibt das Objektiv in derselben Länge. Außerdem ist die Abbildungsqualität hervorragend und mit der von Makroobjektiven vergleichbar. Es ist eine kostengünstige Variante für Makroaufnahmen.
Der einzige Nachteil ist, dass die Funktionen der Kamera nur manuell übertragen werden.
LOS GEHT’S:
VORBEREITUNGEN FÜR
DIE MAKROFOTOGRAFIE
Egal, ob Sie Ihre Makroaufnahmen drinnen in der Wohnung oder draußen in freier Natur machen wollen, etwas Planung und Vorbereitung vorweg sollte sein. Auch für Aufnahmen drinnen ist es hilfreich, sich all das, was man voraussichtlich benötigt, schon mal griffbereit zurechtzulegen. Schön wäre es auch, wenn man zum Fotografieren drinnen einen Bereich hätte, auf dem alles auch mal eine Weile stehen bleiben könnte, denn die Makrofotografie drinnen, wo die Motive ja zusätzlich noch arrangiert werden, dauert manchmal einfach ein bisschen länger.
Alles dabei? Kameraausrüstung
und Ausrüstungs-Check
Kameraausrüstung: Und natürlich sollte auch die Kameraausrüstung für die Makrofotografie vollständig und einsatzbereit sein. Fangen wir am besten mit der Kameraausrüstung an. Was Sie für die Makrofotografie drinnen und draußen brauchen, zeigt die folgende Checkliste.
CHECKLISTE:
KAMERAAUSRÜSTUNG MAKROFOTOGRAFIE
• Fotoapparat
• Makroobjektiv
• oder Objektiv mit Nahlinse oder Zwischenringen
• Akku (plus einen oder mehrere Ersatzakkus)
• Dreibeinstativ (Schnellspannkupplung nicht vergessen)
• kleines, leichtes Stativ (z. B. Gorillapod)
• Streulichtblende
• Regenschutzhülle für Kamera und Objektiv (bei Aufnahmen draußen)
• Speicherkarten
• Bedienungsanleitung Ihrer Kamera
• Aufheller
• Diffusor
• Fernauslöser
Ausrüstungs-Check: Bevor Sie loslegen, insbesondere wenn Sie draußen fotografieren wollen, denken Sie bitte an den Ausrüstungs-Check, also daran, Ihre Kameraausrüstung noch einmal genau auf ihre Funktionsfähigkeit zu testen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man erst draußen im Wald oder am Strand feststellen muss, das der Akku fast leer oder die Speicherkarte voll ist und man keinen Ersatz dabei hat. Also: Bevor Sie nach draußen auf Makropirsch gehen, noch einmal testen, ob Kamera und Objektiv wirklich einwandfrei funktionieren.
Nützliche Utensilien für die Makrofotografie
Im Folgenden möchten wir Ihnen noch einige nützliche Utensilien für die Makrofotografie vorstellen, die Sie griffbereit haben sollten, wenn Sie draußen oder drinnen Makroaufnahmen machen.
Sonnencreme und Mückenschutz: Sie werden vielleicht lachen, dass wir dies als Erstes nennen, aber falls Sie draußen fotografieren, sei es auf einer sonnigen Blumenwiese, im Wald oder an einem Tümpel, sollten Sie auf keinen Fall die Sonnenschutzcreme und den Mückenschutz vergessen. Falls Sie für Mücken so attraktiv sind, dass diese sich ständig auf Ihnen niederlassen und anstechen, werden Sie mit Sicherheit von Ihren eigentlichen Motiven abgelenkt sein, was Ihnen das Fotografieren erschweren wird. Also lieber Sonnen- und Mückenschutz als Erstes einpacken.
Regen- und Sandschutzhüllen für Kamera und Objektive: Noch etwas, das Sie draußen auf jeden Fall zur Hand haben sollten! Bei leichtem Regen und auch am Strand ist Ihre Kameraausrüstung besser geschützt, wenn Sie eine Regenschutzhülle aus dem Fotobedarf darüber ziehen. Wer weiß schon so genau, wie viel Nieselregen die spritzwassergeschützten Kameragehäuse und Objektive vertragen? Oder ob am Strand bei stärkerem Wind nicht doch Sandkörner in die Kamera eindringen können. Mit einer Schutzhülle werden Sie auf jeden Fall bei Regen und Flugsand entspannter fotografieren.
Aufheller: Wenn die Sonne draußen stark scheint, aber auch, wenn Sie drinnen ein Makromotiv einseitig ausleuchten, sind oftmals die Schattenpartien im Motiv sehr dunkel. Den hohen Kontrastumfang zwischen hellen und dunklen Partien im Motiv nehmen wir mit unseren Augen oftmals gar nicht so extrem wahr. Doch die meisten Kameras haben Probleme mit hohem Hell-Dunkel-Kontrast und können diesen nur schwer bewältigen. Die Schattenpartien sind dann auf dem Bild sehr dunkel, es ist oft nur sehr wenig darin zu erkennen. Um diese Stellen aufzuhellen, können Sie ein weißes DIN-A4-Papier, einen kleinen Klappspiegel oder ein etwas dickeres Stück Pappe, das Sie vorher mit Alufolie beklebt haben, als Aufheller einsetzen. Dabei hat das weiße Papier die geringste Reflexionskraft, danach folgt die Alufolie, und am stärksten reflektiert der Klappspiegel das Licht. Vorteil beim Klappspiegel gegenüber anderen Kosmetikspiegeln: Sie können ihn hinstellen und er reflektiert das Licht, ohne dass Sie ihn die ganze Zeit halten müssen. Um die mit Alufolie bezogene Pappe zum Stehen zu bringen, können Sie etwas Knetmasse aus dem Spielwarengeschäft einsetzen.
Mit dem Diffusor wollen Sie erreichen, dass hartes Licht auf dem Motiv weicher wirkt. Denn hartes Licht, z. B. pralle Sonne um die Mittagszeit, macht Ihr Motiv eher platt, ausgeblichen und konturenlos. Wenn Sie draußen fotografieren, können Sie natürlich so lange warten, bis sich ein natürlicher Diffusor – sprich eine Wolke – vor die Sonne schiebt. Aber das kostet Zeit und hartes Lampenlicht drinnen braucht in jedem Fall eine andere Lösung. Sie können einen Diffusor mit einfachen Mitteln selbst herstellen. Dazu nehmen Sie einen DIN-A4-Bogen grafisches Zeichenpapier und laminieren ihn mit matter Laminierfolie. Wenn Sie kein eigenes Laminiergerät besitzen, können Sie das grafische Zeichenpapier auch in einem Kopiershop laminieren lassen. Durch die Folie ist der Diffusor auch gegen Feuchtigkeit geschützt. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie drei längliche Hölzer zu einem „U“ zusammenleimen und eine der offenen Flächen mit dem grafischen Zeichenpapier bekleben. Diese Variante hat den Vorteil, dass sie alleine steht (siehe Foto).
Setzen Sie ruhig einmal eine Taschenlampe mit weißem Licht ein, wenn Ihr Makromotiv völlig im Dunklen liegt. Das passiert schnell bei kleinen Waldpilzen oder Moosen und Flechten im Wald in Bodennähe. In der Regel wird der automatische Weißabgleich auf das Taschenlampenlicht reagieren und die Aufnahme so wiedergeben, dass die Farben passen.

Diffusor
Eine Plastiktüte als Alternativ-Stativ: Möchten Sie z. B. am Strand Muscheln, Sandkörner oder kleine Steine in „Augenhöhe“ fotografieren, also im Sand liegende kleine Makroobjekte nicht von oben, können Sie eine Plastiktüte halb mit Sand füllen und leicht verknoten. Ihre Kamera lässt sich nun gut in alle Richtungen auf der mit Sand gefüllten Plastiktüte positionieren. Benutzen Sie bei den Aufnahmen den Selbstauslöser. Wenn Sie mit den Aufnahmen fertig sind, schütten Sie den Sand aus der Tüte an den Strand zurück und verstauen die Plastiktüte wieder in Ihrem Rucksack.
Handtuch oder Wärmeknickkissen zum Vorwärmen: Einige Insekten kann man auch im Winter gut fotografieren. Wir denken da z. B. an Schmetterlinge in einem Schmetterlingshaus. Bei kühlen Außentemperaturen gibt es aber oftmals Probleme, wenn das Objektiv im sehr warmen Innenraum erst einmal beschlägt. Achten Sie daher darauf, dass Sie Ihre Kamera und die Objektive schon vorher warmhalten, etwa mit einem Handtuch und/oder mit einem Wärmeknickkissen. Dadurch vermeiden Sie, dass Kamera und Objektive im warmen Innenraum längere Zeit durch den Temperaturwechsel beschlagen bleiben. Nehmen Sie aber bitte keine Wärmflasche zum Anwärmen der Kamera, denn sie könnte auslaufen!
Dia-Leuchtkasten für Durchlicht: Dies ist eines der nützlichen Dinge für die Makrofotografie drinnen, wenn auch leider etwas teuer. Aber vielleicht haben Sie noch einen eigenen alten Dia-Leuchtkasten, auf dem man früher zur Zeit der analogen Fotografie seine Dias im Durchlicht schnell sortieren konnte. Diese Leuchtkästen eignen sich nämlich in der Makrofotografie hervorragend, um Strukturen in Blättern oder dünnen Fruchtscheiben zu durchleuchten und so hervorzuheben. Mit etwas Glück kann man einen Leuchtkasten im Internet ersteigern. Wenn nicht, müssen Sie improvisieren. Dazu legen Sie zwei weiße Leuchtstoffröhren mit Kabel und Stecker nebeneinander und platzieren mit etwas Abstand darüber eine milchige, zu etwa 50 % lichtdurchlässige Plexiglasscheibe – und fertig ist Ihr improvisierter Leuchtkasten.

Selbst gebauter Leuchttisch für Durchlicht.
MIT DER KAMERA PER DU
Jeder, der schon einmal Makroaufnahmen in der freien Natur gemacht hat, weiß, wie schnell man manchmal reagieren muss, um eine bestimmte Situation einzufangen.
Insbesondere quirlige Bienen auf Pflanzenblüten warten nicht unbedingt so lange, bis man alle Kameraeinstellungen vorgenommen hat. Doch auch für Aufnahmen drinnen sollten Sie gut vorbereitet sein, damit Sie sich voll und ganz auf das Makromotiv konzentrieren können. Deshalb sollten Sie, bevor Sie hinaus in die freie Natur oder hinein in Ihre Fotoecke gehen, Ihre Kamera halbwegs kennen und bedienen können. Auch sollten Sie – insbesondere wenn Sie hinausgehen – Ihre Bedienungsanleitung mitnehmen, auch wenn Sie sich im Umgang mit Ihrer Kamera bereits sicher fühlen. Moderne digitale Kameras sind heutzutage Kleincomputer mit mehreren Hundert Funktionen. Einstellungen, die man nur selten anwendet, werden schnell wieder vergessen, insbesondere dann, wenn Sie die Kamera erst neu gekauft und noch nicht allzu viel mit ihr fotografiert haben. Also nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit, um sich mit Ihrer Kamera vertraut zu machen und die wichtigsten Einstellungen kennenzulernen. Wenn Sie wissen, wie Sie z. B. die Blende schließen können, um mehr Schärfentiefe im Bild zu erhalten, oder was Sie tun müssen, um eine quirlige Hummel, die Blütenpollen sammelnd auf der Blüte herumläuft, ohne Bewegungsunschärfe abzulichten, dann sind Sie für Ihre Makrofotos gut vorbereitet.
Im Folgenden möchten wir Sie fit machen für die wichtigsten fototechnischen Aspekte und einige wichtige Funktionen Ihrer Kamera.
Kamerasucher auf das Auge einstellen
In der Makrofotografie gibt es immer wieder Situationen, in denen Sie manuell fokussieren, also per Hand das Bild scharf stellen, müssen, weil der Autofokus überfordert ist. Damit Sie für diese Situation gewappnet sind, raten wir Ihnen, den Sucher der Kamera auf das Auge, mit dem Sie durch den Sucher schauen, einzustellen. Zum einen stellt dies sicher – sollten Sie doch einmal manuell fokussieren müssen – dass das Bild genau da auftrifft, wo es auftreffen soll, nämlich direkt auf der Sensorebene und nicht davor oder dahinter. Sonst wäre Ihr Foto nämlich immer leicht unscharf. Beim Fokussieren mit dem Autofokus passiert so etwas normalerweise nicht, da die Objektive genau auf die Kamera justiert sind. Doch wie gesagt, gerade in der Makrofotografie gibt es immer wieder Momente, wo Sie manuell die Schärfe ins Bild legen müssen.
Aber es gibt noch einen weiteren Grund, den Sucher auf das durchschauende Auge einzustellen: Damit können Sie im Sucher die Anzeige, also die Leiste, auf der die wichtigsten aktuellen Kamerawerte wie Blende und Zeit angegeben sind, scharf sehen und gut ablesen. Diese Werte sind für Ihre Einschätzungen wichtig, z. B. dafür, ob die Verschlusszeit, die Ihnen die Kamera bei der Blendenvorwahl vorschlägt, auch ausreicht, um ein sich bewegendes Motiv ohne Bewegungsunschärfe abzulichten.
Um den Sucher auf Ihr Auge einzustellen, schalten Sie die Kamera ein, nehmen den Deckel vom Objektiv und schauen durch den Sucher auf einen hellen neutralen Hintergrund, z. B. in den Himmel. Im Zentrum des Sucherfeldes sehen Sie oft viereckige Felder – die Autofokusmessfelder. Ihre Anzahl ist bei den verschiedenen Kameras unterschiedlich. Sie sehen die Felder mehr oder weniger scharf. Wenn der Sucher gut auf Ihr Auge eingestellt ist, sehen Sie sie scharf. Dann können Sie alles lassen, wie es ist. Sehen Sie sie unscharf, drehen Sie an dem kleinen Rädchen bzw. bewegen Sie den kleinen Schieber direkt neben dem Sucher für die sogenannte Dioptrieneinstellung, bis die Autofokusfelder für Sie scharf zu sehen sind.
| WICHTIG: SUCHER UND AUGE MÜSSEN ZUSAMMENPASSEN |  |
Um den Kamerasucher auf Ihr Auge einzustellen, drehen Sie am kleinen Rädchen oder bewegen den Sie Schieber für die Dioptrieneinstellung direkt neben dem Sucher am Kameragehäuse, nicht am Fokusring des Objektivs! Prüfen Sie öfter mal auf die beschriebene Weise, ob Ihr Kamerasucher noch gut auf Ihr Auge eingestellt ist, denn die Sehschärfe ändert sich mit zunehmendem Alter.
Blende
Die Blende ist das „Loch“, durch das Licht auf den Sensor fällt. Die Größe dieses „Blendenlochs“ können Sie selbst wählen, wenn Sie das Belichtungsprogramm AV (Canon) bzw. A (Nikon) eingestellt haben (siehe auch Kapitel „Belichten mit dem Belichtungsprogramm AV/A“). Die Blende wird üblicherweise mit „ƒ“ und einer Zahl bezeichnet. Wenn Sie die Blende selbst einstellen, haben Sie mehr Einfluss auf die Gestaltung Ihres Bildes. Aber Vorsicht: Wenn das Blendenloch weit geschlossen ist (große Blendenzahl, z. B. ƒ22), dauert es länger als bei einer weit geöffneten Blende (kleine Blendenzahl ƒ5,6), bis genügend Licht auf den Sensor trifft und das Bild richtig belichtet ist. Hier besteht die Gefahr das Bild zu „verwackeln“, wenn frei aus der Hand fotografiert wird. Oder das Motiv bewegt sich während der langen Belichtungszeit und wird deshalb unscharf abgebildet.
Um Ihnen dies stärker zu verdeutlichen, greifen wir auf ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zurück. Sie stehen im Garten und haben zwei große Fässer mit dem gleichen Fassungsvermögen, es passt also in beide Fässer gleich viel hinein. Nun möchten Sie beide Fässer mit Wasser füllen. Zum Befüllen nehmen Sie für das eine Fass einen Gartenschlauch (kleiner Durchmesser) und für das andere einen Feuerwehrschlauch (großer Durchmesser). Es ist klar, dass mit einem Feuerwehrschlauch das Fass schneller voll ist, als mit einem Gartenschlauch.
Auf unsere Kamera bezogen ist der enge Gartenschlauch die weit geschlossene Blende (große Blendenzahl) und der Feuerwehrschlauch die weit geöffnete Blende (kleine Blendenzahl). Bei der weit geschlossenen Blende mit beispielsweise Blendenzahl ƒ22, (Gartenschlauch) dauert es länger, bis dieselbe Lichtmenge auf dem Sensor eingetroffen ist, als bei einer weit geöffneten Blende (Feuerwehrschlauch) mit Blendenzahl z. B. ƒ5,6. Sie kommen also mit kleinen Blendenzahlen (weit geöffnete Blende) auf viel kürzere Belichtungszeiten, als bei hohen Blendenzahlen (weit geschlossene Blende), unveränderte ISO-Zahl und gleichbleibende Lichtverhältnisse vorausgesetzt. Kürzere Belichtungszeiten wiederum erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Bild verwacklungsfrei und scharf wird.

 |
WICHTIG: DAS GEHÖRT ZUSAMMEN |
• Kleine Blendenzahl und weit geöffnete Blende (großes Loch)
• Große Blendenzahl und weit geschlossene Blende (kleines Loch)
Vielleicht wundern Sie sich jetzt, dass wir immer, wenn wir von einer weit geöffneten Blende reden, damit eine kleine Blendenzahl verbinden und umgekehrt, wenn wir von einer großen Blendenzahl reden, die Blendenöffnung klein ist. Das klingt erst einmal unlogisch! Es erklärt sich aber dadurch, dass die korrekte Blendenzahl ein Bruch ist, also nicht einfach nur ƒ4, sondern ƒ1/4 und nicht einfach ƒ22, sondern ƒ1/22. Und da der Zahlenwert 1/4 nun einmal größer ist, als der Zahlenwert 1/22, löst sich das Rätsel und erklärt, warum die Blendenöffnung bei 4 viel größer ist als bei 22. Es hat sich umgangssprachlich so entwickelt, dass man lieber nur die Zahl unter dem Bruchstrich als Blende nennt und nicht den ganzen Bruch. Das ist zwar für Neueinsteiger zunächst undurchsichtig und scheinbar unlogisch, aber im Alltag einfacher zu handhaben.
Wie Sie gleich noch sehen werden, ist die Blende auch noch zuständig für die im Bild mögliche Schärfentiefe, also dafür wie viel im Bild scharf oder unscharf wird (siehe Kapitel „Schärfentiefe im Bild“).
 |
WICHTIG: KLEINE NUMMER – GROSSER BLENDER |
Um schon mal die Konsequenzen für die Schärfentiefe, die sich aus der Blende ergeben vorwegzunehmen, einen etwas frechen, aber einprägsamen Merksatz: Kleine Nummer (= kleine Blendenzahl), großer Blender (= weit geöffnete Blende), nichts dahinter (= wenig Schärfentiefe).
Schärfentiefe im Bild
Die Schärfentiefe ist das Ausmaß des Bereichs, der im Foto scharf wird. Bei geringer Schärfentiefe hat man einen kleinen Schärfenbereich im Bild, bei viel Schärfentiefe ist der Bereich größer. Das Ausmaß der Schärfentiefe wird durch die eingestellte Blende und durch den Abbildungsmaßstab festgelegt. Auf den beiden folgenden Fotos können Sie vergleichen, wie verschieden der Schärfentiefenbereich bei geöffneter und bei geschlossener Blende ist und wie sich dadurch die Bildwirkung verändert.

Schärfentiefe bei offener
Blende.

Schärfentiefe bei
geschlossener Blende.
Die Schärfentiefe dehnt sich nach vorne und nach hinten aus, und zwar in den Ebenen, die parallel zur Kamerarückwand vor dem Fotografen liegen, ausgehend von der Ebene, auf die fokussiert wurde. In der Makrofotografie dehnt sich die Schärfe ausgehend vom fokussierten Bereich gleichermaßen nach vorne und nach hinten aus. Das ist etwas anders als in der Landschaftsfotografie, bei der die Ausdehnung im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel verläuft.
 |
WICHTIG: DIE SCHÄRFENTIEFE IST UMSO GRÖSSER |
• je geschlossener die Blendenöffnung (also je größer die Blendenzahl),
• je größer der Abstand zwischen Kamera und Motiv,
• je kleiner der Abbildungsmaßstab (also mehr Schärfentiefe, wenn Sie Ihr Motiv etwas kleiner ausnehmen, z. B. 1:2 statt 1:1).
Dies hat Konsequenzen dafür, wohin Sie die Schärfe legen, wenn bestimmte Elemente in Ihrem Bild scharf abgelichtet werden sollen. Als Faustregel gilt z. B. in der Makrofotografie, dass man die Schärfe etwa in die Mitte dessen legt, was im Bild scharf werden soll. Das ist in der Praxis – gerade bei sich bewegenden kleinen Motiven – natürlich leichter gesagt als getan, aber Sie sollten es sich auf jeden Fall merken und wenn möglich bewusst anwenden.
Noch etwas zum Thema „Schärfe“. Die beste Schärfe hat ein Objektiv, wenn man 2 – 3 ganze Blendenstufen von der Anfangsblende des Objektivs abblendet, also weiter schließt. Damit ist nicht die Schärfentiefe gemeint, bitte verwechseln Sie das nicht, sondern die Schärfequalität des Objektivs. Wenn also Ihr Objektiv seine größte Blendenöffnung (kleinste Zahl) bei ƒ2,8 hat, liegt die beste Schärfequalität des Objektivs bei Blende ƒ5,6 oder ƒ8. Startet Ihr Objektiv bei ƒ5,6, dann hat es seine beste Schärfe bei Blende ƒ11 oder ƒ16.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783869102498
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (November)
- Schlagworte
- Nahaufnahme Makrofotografie Grundlagen Fotografie fotografieren lernen Bildidee Blitzfotografie Fotopraxis Fotorezept Fotoschule Hobby-Fotografen Landschaftsfotografie Langzeitbelichtung Naturfotografie Spiegelreflex Tierfotografie Belichtung Blende Digitale Fotografie Digitalkamera Foto Fotobuch Fotografie Fotokurs Fototasche Fototheorie Fotowissen Foto-Workshop Kamera Menschen Anfänger Anleitungen Einstieg Photoshop