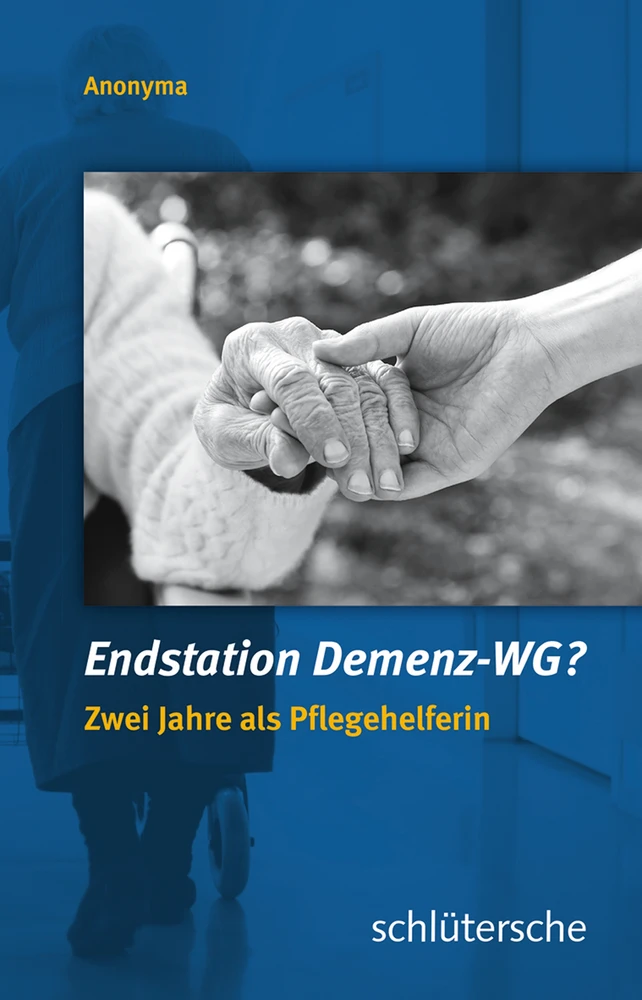Zusammenfassung
Zwei Jahre arbeitete die Autorin, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, auf einer Demenz-WG. Sie wurde Erfüllungsgehilfin in einem rigiden System: unfreiwillig, verzweifelt und hilflos. Die Autorin ist keine Pflege-Expertin, keine examinierte Fachkraft, sondern nur eine Pflegehelferin, die nachlässig vermittelt und rücksichtslos ausgebeutet wurde. Sie klagt nicht an, sie stellt lediglich fest, was ihr widerfahren ist. Ein weiteres Plädoyer für eine andere Art der Pflege in Deutschland. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Anonyma
Endstation Demenz-WG?
Zwei Jahre als Pflegehelferin
Vorwort
Der Begriff »Endstation« im Buchtitel weckte in mir verschiedene Assoziationen: Einerseits erschien mir das Bild einer ausweglosen Sackgasse, andererseits auch die Vorstellung vom Ende einer Reise – endlich angekommen! Beim Lesen des Textes wurde mir schnell klar, dass wohl ersteres gemeint war. Die Autorin schildert in drastischen Bildern ihre Erlebnisse in einer sogenannten Demenz-Wohngemeinschaft, eine von einem ambulanten Pflegedienst betreuten Wohngruppe von Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Die Erfahrungen in der Wohngemeinschaft sind geradezu körperlich nachzuempfinden, gehen mitunter buchstäblich unter die Haut. Insoweit bestätigen sie unser aller Vorurteile über die Altenpflege in Deutschland: mehr oder weniger lieblos, mit zu wenig und schlecht ausgebildetem Personal ausgestattet, werden alte pflegebedürftige Menschen verwahrt.
Nur Vorurteile? Die Pflege alter Menschen leidet in Deutschland nach wie vor unter einer Reihe von unzureichenden Rahmenbedingungen – trotz vieler Errungenschaften des Sozial- und Gesundheitssystems. Angefangen bei dem mangelnden gesellschaftlichen und politischen Interesse, über die fehlende Anerkennung der Pflegeberufe (vor allem durch adäquate Bezahlung!), bis zu einer zunehmenden Kommerzialisierung des Gesundheits- und Pflegesektors. Als wäre dies nicht alles bereits schlecht genug, erleben wir derzeit – und wohl auch zukünftig – einen eklatanten Mangel an Menschen, die bereit und in der Lage sind, einen Pflegeberuf auszuüben.
Die Auswirkungen all dieser Rahmenbedingungen findet man in dem beschriebenen Mikrokosmos der Demenz-Wohngemeinschaft wieder: Einen offenkundig an Profitmaximierung interessierten ambulanten Pflegedienst, der primär schlecht oder gar nicht ausgebildete Hilfskräfte für die Pflege und Betreuung einsetzt, und diese nicht in der notwendigen Anzahl.
Also alles zum Verzweifeln? Ich meine nicht. Denn gerade in den letzten beiden Jahrzehnten hat die Altenpflege in Deutschland enorme Fortschritte gemacht – vor allem konzeptionell. Nach jahrzehntelanger Orientierung an Krankenhäusern, hat man – nicht zuletzt gefördert durch alternative Pflegeangebote, wie zum Beispiel Wohngemeinschaften – die Wohnlichkeit in Pflegeheimen (wieder) entdeckt. Kleinere Wohneinheiten – gerade für Menschen mit Demenz –, mehr Einzelzimmer und Präsenzkräfte auf den Etagen, sind heutzutage keine Einzelfälle mehr. Auch die Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz sind – wenn sie gut gemacht sind – eine segensreiche Alternative zur Pflege zu Hause oder im Pflegeheim. Leider konstatieren wir aber in den letzten Jahren eine Entwicklung bei den Wohngemeinschaften, die wenig Anlass zur Freude bietet. Waren es anfänglich vor allem die an Qualität orientierten Pflegedienste, die gemeinsam mit Angehörigen und rechtlichen Betreuern solche Wohngemeinschaften ins Leben gerufen hatten, sind es heute zunehmend solche, die Menschen mit Demenz als lukrative Zielgruppe entdeckt haben und häufig weder über Erfahrungen noch über geeignetes Personal verfügen, um die Menschen in den Wohngemeinschaften entsprechend zu versorgen.
Fast gänzlich auf der Strecke geblieben ist der ursprüngliche Ansatz der Wohngemeinschaften, ein nutzergesteuertes Konstrukt zu sein, bei dem der ambulante Dienst als Gast auftritt und die WG-Mitglieder die wesentlichen Teile des Alltagslebens selbst bestimmen. Kritisch betrachtet handelt es sich z. B. bei Berliner Pflege-Wohngemeinschaften zu 90% (Prof. Dr. Thomas Klie) um Kleinstheime, die allerdings weitgehend unreguliert und unkontrolliert ihre Dienste auf dem Pflegemarkt anbieten.
Zudem ist beispielsweise der WG-Markt in Berlin mittlerweile überhitzt: Es herrscht ein Überangebot an WG-Plätzen und ein dramatischer Mangel an geeigneten Mitarbeitern, um die vielen Wohngemeinschaften personell adäquat auszustatten. Was das in Berlin und anderswo bedeutet, wird in diesem Buch deutlich. Umso mehr hervorzuheben ist der Einsatz der Mitarbeiter in solchen WG’s, wie sie hier geschildert werden, die – häufig auf sich allein gestellt – bis an die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen Belastungsgrenzen arbeiten.
Wie gut die Versorgung in einer Wohngemeinschaft sein könnte, blitzt immer mal wieder in kleinen Episoden auf: Wenn zufällig einmal zwei Kollegen mit einem hohen fachlichen und ethischen Anspruch zusammen Dienst haben und erkennbar wird, wie die demenzkranken Bewohner aufblühen, sobald ausreichend motiviertes und mit sozialer Kompetenz ausgestattetes Personal vorhanden ist. In solchen Momenten wird deutlich, was Endstation auch bedeuten könnte: Einen Ort gefunden zu haben, wo man behütet alt werden kann und in einer würdigen Umgebung auch sterben darf.
Es muss einiges passieren, damit Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz (wieder) das werden, was sie vorgeben zu sein: Orte, an denen die Bewohner die »Herren im Haus« sind, an denen sich der Pflegedienst mit Respekt und Kompetenz bewegt und die Einnahmen aus der Pflege und Betreuung zum höchstmöglichen Teil, in Form von ausreichender Personalausstattung, an die Bewohner zurückgibt.
Nach nunmehr 17-jähriger Erfahrung mit dieser Wohnform glaube ich nicht mehr daran, dass der Markt dafür sorgt, dass ausreichende Qualität bei Pflege-Wohngemeinschaften gewährleistet werden kann. Ob Profitinteresse, Naivität oder Überschätzung der eigenen Fähigkeiten dafür verantwortlich sind, kann den sorgebedürftigen WG-Bewohnern letztendlich egal sein. Ihr Interesse ist es, vernünftig und liebevoll versorgt zu werden. Wenn dies offenkundig vielen Anbietern nicht gelingt, müssen Qualitätsstandards vonseiten der Kostenträger und Aufsichtsbehörden etabliert und durchgesetzt werden, die speziell auf Pflegewohngemeinschaften für Menschen mit Demenz zugeschnitten sind. Das würde nicht nur zukünftig einen besseren Schutz für die Bewohner bedeuten, sondern auch für die Mitarbeiter in den Wohngemeinschaften die Chance beinhalten, unter erträglicheren Rahmenbedingungen ihre harte Arbeit zu verrichten.
Wenn unsere Gesellschaft aber auch in Zukunft ihre alten Mitmenschen von geschulten und motivierten Menschen versorgen lassen will, wird sie um höhere Investitionen in die Altenpflege nicht herum kommen. Eine Beitragssteigerung von 1% im Rahmen der letzten Pflegereform, des Pflegeneuausrichtungsgesetzes – was für ein Wortungetüm! –, kann da nur als schlechter Witz erscheinen.
Die Mehrzahl der Menschen in Deutschland – davon bin ich überzeugt – wird eine Mehrbelastung durch einen höheren Pflegeversicherungsbeitrag akzeptieren, zumal das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, für jeden erkennbar und erschreckend real ist. Vielleicht heißt das nächste Buch der Autorin dann ja: »Paradies Demenz-WG«. Das würde ich uns allen wünschen.
Klaus Werner Pawletko,
Geschäftsführer »Freunde alter Menschen e. V.«, Berlin
Einleitung
Bevor ich auf Hartz IV angewiesen war, betrieb ich eine kleine Praxis mit physiotherapeutischem und ernährungsmedizinischem Angebot. Ich kümmerte mich um die Organisation, Werbung und Marketing, musste jedoch erkennen, dass die Arbeitszeit und die Verantwortung für mein Personal mehr Kraft forderten, als ich geben konnte. Als alleinerziehende Mutter zweier Töchter stieß ich an meine Grenzen und schloss Ende 2007 meinen Betrieb. Bis dahin verfügte ich über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Einzelhandel und ein selbstfinanziertes Fernstudium zur Gesundheitstherapeutin.
Vom Jobcenter gab es flugs ein Angebot. Ich war erfreut und gleichzeitig gespannt, was sich hinter dem Vorschlag verbarg: Die Stellenausschreibung trug den klangvollen Namen »Mobile in Teilzeit«. Ich rief sofort die zuständige Sachbearbeiterin an und erfuhr, dass es sich um eine Arbeitsgelegenheit nach § 16d Satz 2 SGB II mit Mehraufwandsentschädigung handelte. MAE-Kraft könnte man sagen, im Volksmund besser bekannt als »Ein-Euro-Jobber«.
Vier Wochen lang saß ich nun von montags bis freitags mit 15 Damen zwischen 20 und Anfang 50 im Stuhlkreis. Wir verständigten uns in allen möglichen Sprachen, manchmal auch in Deutsch. Wie meine zukünftigen Kolleginnen in der Altenpflege kamen auch einige dieser Damen aus Handwerks-, Gastronomie- oder kaufmännischen Berufen. Viele waren langzeitarbeitslos oder alleinerziehende Mütter wie ich. Frau S., unsere Ansprechpartnerin, erinnerte uns immer wieder daran, dass in den Gesundheits- und Pflegeberufen händeringend nach Mitarbeitern gesucht würde. »Unser Ziel ist, mit Ihnen gemeinsam den ersten Arbeitsmarkt zu erklimmen. Die Aussichten in der Altenpflege sind dafür besonders gut.« Ob wir denn nicht auch in anderen Berufen …? Nein, eigentlich nicht … Ich sah mein Ziel zunächst in Bereichen, von denen ich Ahnung hatte. Doch es kam anders als ich dachte.
Nach wenigen Wochen machte ich mich auf in die Arbeitserprobung. Für 1,50 Euro/Stunde beschäftigte ich nun in einer Tagesstätte jeden Tag bis zu zehn pflegebedürftige Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen. Ich machte die Arbeit gern. Die Menschen waren nett und in ihrer ganz eigenen Art sehr faszinierend. Offensichtlich fiel es auch meiner Vorgesetzten auf, dass ich gern zur Arbeit kam. Keine zwei Monate später vermittelte sie mich an einen Pflegedienst, der mich für eine Wohngemeinschaft einteilte. Der erste Arbeitsmarkt hatte mich wieder!
1
An meinem ersten Arbeitstag stand ich morgens, kurz vor sechs Uhr vor einer Wohnungstür in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses und zögerte. Die letzte Nacht hatte ich schlaflos in meiner Küche verbracht. Wie würden die Bewohner auf mich reagieren? Funktionierten alle Absprachen mit meinen Kindern? Die letzten beiden Tage hatte ich versucht, alles zu organisieren, um den Job und meine Kinder unter einen Hut zu bringen.
Ich klingelte entschlossen an der Wohnungstür. Eine Pflegerin öffnete. »Wusste gar nicht, dass heute jemand Neues kommt«, sagte sie knapp. »Klopf beim nächsten Mal gegen die Tür. Aber leise! Man hat Dir doch sicherlich gesagt, dass die Bewohner um diese Zeit noch schlafen.« Ich schüttelte den Kopf – außer der Adresse hatte ich nichts erhalten – und trat ins Foyer. Zwei voll beladene Wäscheständer bildeten den Blickfang. Es roch nach Reinigungsmitteln und feuchter Wäsche. Der Fliesenboden war kalt, die Wände kahl. Etwas zögerlich folgte ich der Frau in die Wohnküche. Ein junger Mann saß dort und stellte sich freundlich vor. »Ich bin Kai1, Dein Teamleiter. »Das«, er zeigte auf die Frau, die mich begrüßt hatte, »ist Bea, Pflegerin hier.« Wir setzten uns auf eine wackelige Eckbank. Kai goss Kaffee ein und Bea erzählte, dass ich die Dienste einer vor Kurzem gekündigten Kollegin übernehmen sollte. »Wir waren schockiert, dass die einfach so gefeuert wurde. Keiner weiß, warum. Aber das ist hier normal.«
In der Wohnküche stand ein großer Esstisch. Eine durchgehende Fensterfront sorgte für ausreichend Licht. Neben der Küchenzeile war eine kleine Tür, offensichtlich eine Abstellkammer. Ich ließ meinen Blick schweifen, trank einen Schluck Kaffee und atmete allmählich ruhiger. Als sich jedoch die Tür zur vermeintlichen Abstellkammer öffnete und ich erstaunt zu Bea sah, sagte sie lapidar: »Jetzt kommt Herr J. und will zur Toilette. Wenn Du da nicht gleich springst, regt der sich sofort auf.« Ein zierlicher Mann schob sich im Zeitlupentempo durch die Tür. Er blinzelte zu uns herüber und robbte, immer schön an der Küchenzeile lang, an uns vorbei. Eine Stimme in mir sagte: »Nun sag doch wenigstens ›Guten Morgen‹«, aber ich bekam keinen Ton heraus. Herr J. schlurfte derweil weiter, in durchnässtem Inkontinenzmaterial, mit herunterhängender Pyjamahose. Mit einer Hand hielt er den Bund seiner Pyjamahose fest. Kai und Bea tranken ihren Kaffee. Offensichtlich war es nicht ernst gemeint, dass man bei Herrn J. »gleich springen« müsse, denn beide ignorierten den alten Mann. Erst als Herr J. es bis in den Flur geschafft hatte, stand Kai seufzend auf und ging hinterher. Auch Bea hatte es jetzt eilig. Sie trank ihren Kaffee aus, verschwand flotten Schrittes im Flur, kehrte kurze Zeit später in Hut und Mantel zurück, griff nach ihrer Tasche und wünschte mir viel Spaß. »Herr M. schleicht bereits im Flur herum«, sagte sie, »hörst Du das nicht?« Tatsächlich war ein eigenartiges Geräusch zu hören. Als würde etwas Metallenes irgendwo gegen schlagen. »Ich habe jetzt Feierabend«, bemerkte Bea. »Herr M. ist mit Vorsicht zu genießen – aber mach’ Dir keinen Kopf und warte lieber auf Kai.« Beiläufig verriet sie mir noch, dass Herr M. ganz gern mal handgreiflich würde, wenn es nicht nach seinem Kopf ginge. Dann verschwand sie.
Zögernd verließ ich den sicheren Hafen der Wohnküche und ging auf den Flur. Im schmalen Lichtkegel einer offenen Tür stand ein Mann. Wahrscheinlich Herr M. Er klopfte mit einer Hand auf seinen Kopf, mit der anderen hielt er irgendetwas fest. Dabei trippelte er auf der Stelle und drehte sich immer wieder um die eigene Achse. Ein Hosenträger seiner Jeans schlug auf den Fußboden. Das war das metallene Geräusch, das ich zuvor gehört hatte. Zwischen Türrahmen und Flur lag etwas auf dem Boden, eine Decke oder ein Kissen, vermutete ich. Herr M. stupste gelegentlich mit dem Fuß dagegen.
Aus dem Badezimmer hörte ich Herrn J. ein lang gezogenes »Meeensch« schreien, kurz darauf ein tröstendes Gemurmel von Kai. Das konnte noch dauern! Also entschied ich mich trotz Beas Warnung, Herrn M. zu begrüßen und mich vorzustellen. Der hatte zwischenzeitlich das Trippeln aufgegeben und sich in meine Richtung in Marsch gesetzt. Je näher er kam, desto besser konnte ich ihn sehen. Er trug nur einen Schuh und ein langes Hemd, an dem er sich die Hände abwischte. Sein Unterleib war nackt. Er war überall mit Kot beschmiert, selbst sein Haar war mehr bräunlich als grau. Was ich vorher für eine Decke oder ein Kissen gehalten hatte, war sein Inkontinenzmaterial, das er offenbar schon mal »gewechselt« hatte.
Ich riss mich zusammen. »Ich bin Anja«, sagte ich. »Kann ich Ihnen helfen?« Mir war angst und bange. Es waren noch keine 30 Minuten vergangen, seit ich angekommen war. Ich hatte keinen Plan, was ich machen sollte. Aber ich musste eine Entscheidung treffen. Herr M. schmierte den ganzen Boden voll. Er schwankte beim Gehen, drohte zu stürzen. Also klopfte ich an die Badezimmertür. Kai guckte raus und sah sofort mein Problem. »Traust Du Dir zu, mit Herrn M. ins andere Bad zu gehen?«, fragte er mich. Ich nickte – was blieb mir übrig? Kai reichte mir noch ein paar Einmalhandschuhe, sagte: »Ich bin gleich fertig«, und kehrte zurück zu Herrn J., der inzwischen lauthals schimpfte.
Plötzlich ging eine weitere Zimmertür auf. Die Bewohnerin würdigte mich keines Blickes, sondern spazierte mit einem Bündel Kleidungsstücke flink in die Küche. Dort legte sie ihr Bündel auf den Esstisch und verschwand im Zimmer von Herrn J. Da sie die Tür offen gelassen hatte, erwartete ich, dass sie gleich wieder herauskommen würde. Tat sie aber nicht. Ich schaute abwechselnd zu Herrn M. und zum Zimmereingang. Kai kam mit Herrn J. aus dem Badezimmer, nickte mir aufmunternd zu, gab mir ein Bündel Wäsche – »Für Herrn M.« – und machte sich davon.
Mit Wechselwäsche und Einmalhandschuhen ausgerüstet, bugsierte ich Herrn M. ins Badezimmer. Mir war übel. Ich versuchte gründlich und schnell zu arbeiten, ohne mich zu übergeben. Herr M. ließ sich widerstandslos die Haare reinigen und am ganzen Körper waschen. Er wirkte zerbrechlich, aber willensstark. Mir wurde schnell klar, dass ich ihm zeigen musste, was ich von ihm wollte. Also sagte ich immer deutlich, wann ich ihn berühren musste und wo. Dann nickte er oder gab zustimmende Laute von sich, wirkte am Ende der Aktion fast zufrieden. Als wir das Badezimmer verließen und in sein Zimmer gingen, nahm er sogar meine Hand.
Sein Bett war bereits abgezogen, der Boden gereinigt und gewischt. Danke, Kai! Nur der Wischeimer stand noch vor der Tür. Herr M. setzte sich auf die Bettkante und klopfte sanft auf seine Oberschenkel. Ich legte seine mittlerweile sauberen Hosenträger neben ihm aufs Bett. »Ich bringe Ihnen gleich Ihre Hose und den zweiten Schuh«, erklärte ich. Er nickte, griff sich seine Hosenträger und sah mich an. Auf der Suche nach dem Schuh öffnete ich Schubfächer – »Wenn es Ihnen recht ist, Herr M.?« – und schaute unterm Bett nach. Schließlich fand sich der Schuh in einem Schrank gegenüber vom Bett. Also kehrte ich Herrn M. den Rücken zu, um nach dem Schuh zu greifen. Da schimpfte Herr M. plötzlich laut, stampfte mit den Füßen und im selben Moment verspürte ich einen stechenden Schmerz im Rücken. Ich drehte mich um und sah, dass Herr M. seine Hosenträger ein weiteres Mal in meine Richtung schwang. Ich reagierte instinktiv und verließ fluchtartig das Zimmer. Hinter mir schimpfte Herr M. wie ein Rohrspatz.
Ich brauchte dringend einen Ort, um einen Moment allein zu sein. Kai war nicht in Sicht und ich wollte auch nicht nach ihm suchen. Bis auf Herrn M. und mich schien es niemanden mehr in der Wohngemeinschaft zu geben. Ich verstand den plötzlichen Stimmungswechsel von Herrn M. nicht. Hatte er mein Suchen als unerlaubtes Eindringen in seine Privatsphäre interpretiert? Hatte er mich geschlagen, weil er mich für einen Eindringling hielt, der ihn bestehlen wollte? Wo war ich hier hingeraten? Wieso war ich eigentlich ganz allein? Ich versuchte ruhig zu atmen und biss die Zähne zusammen. Ich konnte doch jetzt nicht einfach aufgeben! – Auszeit im Badezimmer. – Zehn Minuten später ging ich mit Herrn M. in Richtung Küche. Er war angekleidet, trug Schuhe, seine Hose wurde ordentlich von Hosenträgern gehalten. Und während er neben mir herlief, nahm er wieder meine Hand.
Dennoch: Der Schreck saß mir im Nacken. Ich wollte gar nicht darüber nachdenken, wie ich die nächsten Wochen, gar Monate durchhalten sollte. Dieser Tagesablauf, so viel war mir klar, würde sich ab jetzt immer wieder wiederholen. Kai war mir immerhin trotz der Pleiten, Pech und Pannen sehr sympathisch. Dafür, dass ich sofort, ohne auch nur einen einzigen Satz zu den einzelnen Bewohnern gehört zu haben, drauflos arbeiten musste, brachte ich den weiteren Tag ganz gut hinter mich. Die Situation mit Herrn M. lehrte mich, dass die Bewohner, mit denen ich viel Zeit verbringen würde, nicht berücksichtigen, ob ich mit ihnen umzugehen weiß oder nicht. Wenn ich solche Situationen künftig vermeiden wollte, musste ich mich auf die Bewohner einstellen.
Als ich Feierabend hatte, fuhr ich noch ins Büro des Pflegedienstes, holte meinen Arbeitsvertrag ab, absolvierte die ersten Stunden eines Gerontopsychiatrie-Basiskurses und war um 21:00 Uhr endlich zu Hause. Ich war müde, irritiert, fühlte mich wie in einer fremden Welt. Dass ich morgen früh wieder um 4:00 Uhr aufstehen musste, entsetzte mich.
_______________
1 Alle Namen in diesem Buch sind geändert.
2
Bevor es mich in eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz verschlug, verband ich mit Wohngemeinschaften wunderbare Erfahrungen. Als junge Frau wohnte ich mit zwei Freunden unter einem Dach und genoss deren Gesellschaft mindestens genauso wie meine Unabhängigkeit. Die Kosten wurden geteilt, jeder hatte zusätzlich zu den Gemeinschaftsräumen sein eigenes Reich. Ich war gerade 20 Jahre alt, ungebunden, selbstständig und fühlte mich geborgen. Meine Bedürfnisse und Entscheidungen wurden respektiert. Alles war perfekt. Wahrscheinlich war diese schöne Erinnerung einer der Gründe, warum ich mir das Leben in einer Demenzwohngemeinschaft ähnlich vorstellte.
Heute, mehr als vier Jahre nach meinem ersten Einsatz auf der Demenz-WG, weiß ich mehr über Wohngemeinschaften für Demenzkranke. Dazu beigetragen hat Klaus-Werner Pawletko, den ich 2011 kennenlernte. Er ist Geschäftsführer des Vereins »Freunde alter Menschen e. V.« Die Idee zu diesem Verein stammt aus Frankreich, wo sich 1946 eine Organisation namens »Les petits frères des Pauvres« gründete. »Die kleinen Brüder der Armen«, so die deutsche Übersetzung, kümmern sich vor allem um arme, einsame Menschen. Sie tun das freiwillig und ehrenamtlich und seit 1991 auch in Deutschland. Außerdem beraten sie rund um das Thema »Wohnen im Alter«. 1995 gründeten sie z. B. die erste ambulante Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz in Berlin.
Klaus-Werner Pawletko erklärte mir, wie viele Vorteile eine solche Wohngemeinschaft hat. Ein wesentlicher Punkt: Der Vermieter einer Demenzwohngemeinschaft ist nicht gleichzeitig der Pflegedienst. Ein weiterer Vorteil einer Wohngemeinschaft ist die Selbstbestimmung. Jeder Bewohner, seine Angehörigen oder Betreuer kann seinen Pflegedienst frei wählen. Das setzt allerdings voraus, dass Angehörige oder Betreuer an den Ereignissen in der Wohngemeinschaft interessiert sind, ihnen also eine optimale Betreuung der Bewohner wichtig ist.
Außerdem: Bewohner, Angehörige oder gesetzliche Vertreter der Bewohner entscheiden, wer in die Wohngemeinschaft einzieht. Prinzipiell, so besagt es das ursprüngliche Konzept, gehört die Abstimmung untereinander zur kollektiven Wahlfreiheit, die ja die Selbstbestimmung ausmacht. Verstirbt also ein Bewohner und wird dadurch ein Zimmer in der Wohngemeinschaft frei, setzen sich alle an einen Tisch, diskutieren über Bewerber und wählen gemeinsam aus, wobei die Mehrheit entscheidet. Die Mehrheit entscheidet auch darüber, ob ein Pflegedienst, der seine Leistungen nicht wie vereinbart erbringt, ausgetauscht werden sollte.
Demenz-WGs waren zwischenzeitlich auch Gegenstand eines Bundesmodellprojekts. Gefördert wurde das Ganze vom Bundesministerium für Senioren, Familie, Frauen und Jugend.2 Ein Träger dieses Projekts war der »Verein Freunde alter Menschen e. V.« Klaus-Werner Pawletko nannte in unserem Gespräch auch die Schattenseiten der WGs. So umgingen manche Pflegedienste die Regelung, dass sie nicht gleichzeitig Vermieter der WG sein dürfen, indem sie Strohmänner engagierten, die offiziell als Vermieter auftraten. Mit der Föderalismusreform 2006 ging die Zuständigkeit für die ordnungsrechtlichen Vorschriften der Heimgesetzgebung vom Bund auf die Bundesländer über. Eine Vielzahl von Ländern hat bereits eigene Gesetze erlassen. Bei den übrigen Ländern befinden sich die Gesetze im Entwurfsstadium. Die Zuständigkeit für die vertragsrechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet des Heimrechts verbleibt dagegen weiterhin beim Bund. In Folge dessen wurde das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) geschaffen, das am 1.10.2009 in Kraft trat. Mit dem WBVG (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz) wurde ein Gesetz verabschiedet, das auf Verträge älterer, pflegebedürftiger oder behinderter volljähriger Menschen anzuwenden ist, wenn diesen Wohnraum überlassen wurde und Pflege- oder Betreuungsleistungen erbracht werden. Das WBVG trägt dem Verbraucherschutzgedanken Rechnung, indem es unter anderem eine größtmögliche Transparenz im Leistungsbereich festschreibt. So werden im WBVG beispielsweise umfassende vorvertragliche Informationspflichten für die »Unternehmer« – also Anbieter von Wohnraum und Pflege- und Betreuungsleistungen – normiert.3
§ 1 des WBVG: »Dieses Gesetz ist anzuwenden auf einen Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem volljährigen Verbraucher, in dem sich der Unternehmer zur Überlassung von Wohnraum und zur Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistungen verpflichtet, die der Bewältigung eines durch Alter oder Behinderung bedingten Hilfebedarfs dienen.«4 Aber heißt das nicht zugleich, dass Wohngemeinschaften Miniheime sind? Letztlich klingt das wie ein Freibrief für Pflegedienste (die Unternehmer), die ganz legal schalten und walten können. Es gibt ohnehin immer wieder Rechtsstreitigkeiten darüber, ob Wohngemeinschaften unter die Vorgaben und Pflichten des Heimrechts fallen oder nicht. Da es kein einheitliches Bundesheimgesetz mehr gibt, sondern unterschiedliche Landesgesetze, besteht viel Wildwuchs in den rechtsfreien Räumen. In Niedersachsen hat man gar ein Heimgesetz verabschiedet, das Demenz-WG’s gar nicht konkret definiert. Die Folge: Es gibt dort kaum noch Neugründungen.
Bei »meiner« Demenz-WG wurde das WBVG so ausgelegt: Die Bewohner hatten tatsächlich einen separaten Mietvertrag, aber bei uns entschied die Geschäftsleitung darüber, wer ein freies Zimmer bezog. Bewohner, Angehörige oder Betreuer hatten nichts damit zu tun. Sobald ein Zimmer frei wurde, rückten Klienten aus dem ambulanten Pflegebereich unseres Pflegedienstes nach.
Viele Betreuer und Angehörige zeigten auch kaum Interesse daran, ob sich der neue Bewohner mit den Mitbewohnern arrangieren konnte; ob er zu dieser Menschengruppe, zu den individuellen Krankheitsbildern und natürlich auch zu den unterschiedlichsten Biografien passte. Das hatte mitunter fatale Konsequenzen. Wir Pflegenden stellten mehr als einmal fest, dass Menschen, die anfangs geistig noch rege waren, im Laufe der Zeit regelrecht verkümmerten, weil sie sich weder zuhause fühlten noch ihrem eigenen Rhythmus gemäß leben konnten. In der Enge der WG blieb ihnen nur ein Ausweg: der allmähliche Rückzug.
_______________
3 http://www.biva.de/Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung (BIVA) e. V.
4 www.bundesgesetzblatt.de/Bundesgesetztblatt Jahrgang 2009 Teil 1 Nr. 48, ausgegeben zu Bonn am 31. Juli 2009
3
Ein Qualitätsmerkmal einer Demenz-WG ist, dass die Menschen dort so selbstbestimmt wie möglich leben. Das lernte ich auch in meinem gerontopsychiatrischen Basiskurs. Diese Weiterbildung fand vierzehntägig in den Büroräumen unseres Pflegedienstes statt. Einzelne Module, wie beispielsweise Kommunikation im Team und Beschäftigung von Menschen mit Demenz, wurden von Führungskräften unseres Unternehmens geschult. Ich sollte selbstreflektieren lernen, Ressourcen bei unseren Bewohnern erkennen und aktivieren, viel Selbstständigkeit zulassen und immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das sollte sowohl für Bewohner als auch für Kollegen gelten. »Nimm Dich selbst nicht so wichtig«, wurde gelehrt. »Behandle die alten Menschen so, wie Du selbst behandelt werden möchtest: höflich und wertschätzend. Stell Dir vor, wie es ist, an ihrer Stelle zu sein.« Doch das wollte ich lieber nicht. »Duzen oder gar Kosenamen gehören sich nicht und sind ein Zeichen von falsch verstandener Freundlichkeit.« Das lernte ich abends. Tagsüber lernte ich das wahre Leben kennen. Als in unserer Wohngemeinschaft einmal auf Anordnung der Geschäftsführung eine Qualitätsanalyse durchgeführt werden sollte, saßen alle acht Bewohner bereits um 7:30 Uhr geschniegelt am Frühstückstisch. Die Teller vor ihnen waren mit Alufolie bedeckt. Darunter verbargen sich Marmeladenbrote, in akkurate Häppchen geschnitten. Immerhin konnte Frau C. aus ihrer Lieblingskolumne vorlesen, aber Selbstständigkeit heißt: Aufstehen, wann man möchte; Anziehen, was man möchte, sich selbst Brote machen und nach Geschmack belegen.
Unsere WG erinnerte eher an ein Heim mit Strukturen der ehemaligen DDR. Die Zeiten lagen fest, die Bewohner hatten sich danach zu richten. Taten sie das nicht, waren sie aufmüpfig, aggressiv oder Nörgler. Nach ihren Befindlichkeiten, beispielsweise biografisch bedingten Gewohnheiten, verschiedenen Erkrankungen, die bei den älteren Bewohnern oft mit einer Demenz einhergingen, wurde nicht ernsthaft gefragt oder gar Rücksicht drauf genommen.
Zurück zur Qualitätsanalyse: Die beiden Damen von der Qualitätsanalyse saßen mit unserer Pflegedienstleitung Marie an einem separaten Tisch und schrieben sich die Finger wund. Marie stand offensichtlich unter Schock. Sie kommentierte nicht. Sie erklärte nicht. Sie saß einfach da. Die Blicke der beiden Damen waren kritisch und unfreundlich. Sagen taten sie nichts, aber ihr Schweigen dröhnte in unseren Ohren.
Nach dem Frühstück ergriff meine Kollegin Jutta energisch den Rollstuhl von Frau V. »Mäusezähnchen«, sagte sie, »Mäusezähnchen, wir schieben mal rüber zum Fernseher.« Ich meinte, die beiden Qualitätsprüferinnen kurz erstarren zu sehen, bevor sie umso eifriger weiterschrieben. Auf jeden Fall hörten wir nie, was die beiden Damen eigentlich zur Qualität unserer WG sagten. Wie auch immer der Bericht lautete, er verschwand im Aktenschrank. Und mit ihm auch die hehren Begriffe von Selbstständigkeit, Würde und Wertschätzung. Allerdings wurde Jutta wenige Tage danach fristlos entlassen.
Die Qualität wurde auch weiterhin geprüft. So stand eines Morgens eine Dame vom MDK mit zwei Kollegen vor der Tür unserer WG. Unangemeldet. Das darf der MDK. Ehe noch etwas gesagt werden konnte, wühlten sich die beiden Kollegen bereits durch die Unterlagen im Büro, während die besagte Dame Bewohnerinnen in unserer Wohngemeinschaft begutachten wollte. Ihren Namen erfuhr ich nicht, als ich ihr die Tür öffnete. Offensichtlich musste »Ich bin vom MDK« reichen. Die Dame marschierte forsch ins erstbeste Bewohnerzimmer, setzte sich aufs Bett und verlangte von der Bewohnerin, die verdattert im Sessel saß: »Nun ziehen Sie sich mal aus – wir machen jetzt eine Begutachtung.«
Im Internet wurden später Noten in Form des sogenannten Transparenzberichts veröffentlicht, gegen den unsere Geschäftsleitung Widerspruch einlegte.
4
Frau M. war lange die einzige Angehörige, die zu uns kam. Sie war sehr besorgt um ihren Mann. Meine Kollegin Barbara hingegen war genervt: »Frau M. verwöhnt ihren Mann von vorn bis hinten. Ist sie weg, macht er Theater. Außerdem schlägt er seine Frau laufend! Das durfte er immer schon. Und jetzt schlägt er uns, weil sie nicht immer da ist, um ihn mit Keksen zu füttern.« Barbara sprach laut aus, was auch andere Kolleginnen dachten. Sie sprach so laut, dass Frau M., die gerade über den Flur ging, es hören musste. Frau M. überging die Kritik schweigend. Mir tat sie leid und so lud ich sie spontan zu einem Kaffee in unser Wohnzimmer ein.
Barbara sah uns verblüfft zu. Thessa, eine andere Kollegin, verrührte gerade die Medikamente für Herrn M. in einem Fruchtquark. Ich starrte auf Thessa und dann auf Barbara. Barbara schaute weg, dabei hatten wir kürzlich noch vereinbart, dass wir die Medikamente für Herrn M. nicht mehr einfach im Fruchtquark unterrühren wollten. Frau M. hatte uns immer wieder gesagt, dass ihr Ehemann keinen Fruchtquark mochte. Aber seit Thessa ihren Dienst angetreten hatte, war mein Verhältnis zu Barbara gestört. Ich war Pflegehelferin, Thessa dagegen examinierte Altenpflegerin und zudem Teamleiterin einer unserer Wohngemeinschaften. Als Pflegehelferin zählte meine Meinung nicht. Auch nicht an diesem Nachmittag.
»Können Sie meinem Mann die Medikamente nicht anders geben?«, fragte Frau M. mich noch einmal, während wir mittlerweile zu fünft auf dem Sofa saßen. Die Bewohner Frau U. und Herr J. waren zu uns gestoßen. »Er mag keinen Fruchtquark«, sagte Frau M. »Ich habe das mehrere Mal ausdrücklich gesagt. Und Pudding habe ich dabei. Den mag er wirklich gern. Lässt sich da denn nichts machen?«
Frau M. erzählte, dass man sie sogar von der Verwaltung aus angerufen hatte, weil ihr Ehemann seine Medikamente nicht schlucken würde. Er spucke alles wieder aus. Schuld daran seien wohl die Kekse, die sie ihm so überreichlich geben würde. »Aber das stimmt nicht«, beharrte Frau M. »Ich gebe ihm nicht zu viele Kekse. Er mag einfach keinen Fruchtquark. Aber Pudding! Habe ich mit! Kann ich Ihnen gleich geben.« Sie griff nach ihrer Tasche. Thessa rührte weiter im Quark, Barbara schwieg.
Am Ende gab es wieder Fruchtquark mit Medikamenten, mit der üblichen Gegenwehr von Herrn M. Seine Ehefrau war zu diesem Zeitpunkt bereits weg, aber sie hatte mich zu ihrer Komplizin in Sachen »Pudding statt Fruchtquark« gemacht.
Am nächsten Tag versuchte ich mein Glück: »Thessa, nur ganz kurz: Frau M. bittet mich, Dir zu sagen, dass sie für die Medikamente Schokoladenpudding mitgebracht hatte. Er steht hier im Kühl…«
»Die schon wieder!«, unterbrach mich Thessa und schaute bedeutungsvoll zu Barbara hinüber, die gerade in die Küche kam.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842685000
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Schlagworte
- Altenpflege Ambulante Pflege Angehörige Betreuung Biografie Burnout Demente Menschen Demenz Fachkräftemangel Freiheitseinschränkende Maßnahmen Lebensqualität Mobbing Pflegealltag Pflegebedürftige Pflegehelfer Pflegekräfte Pflegenotstand Stress Wohngemeinschaft