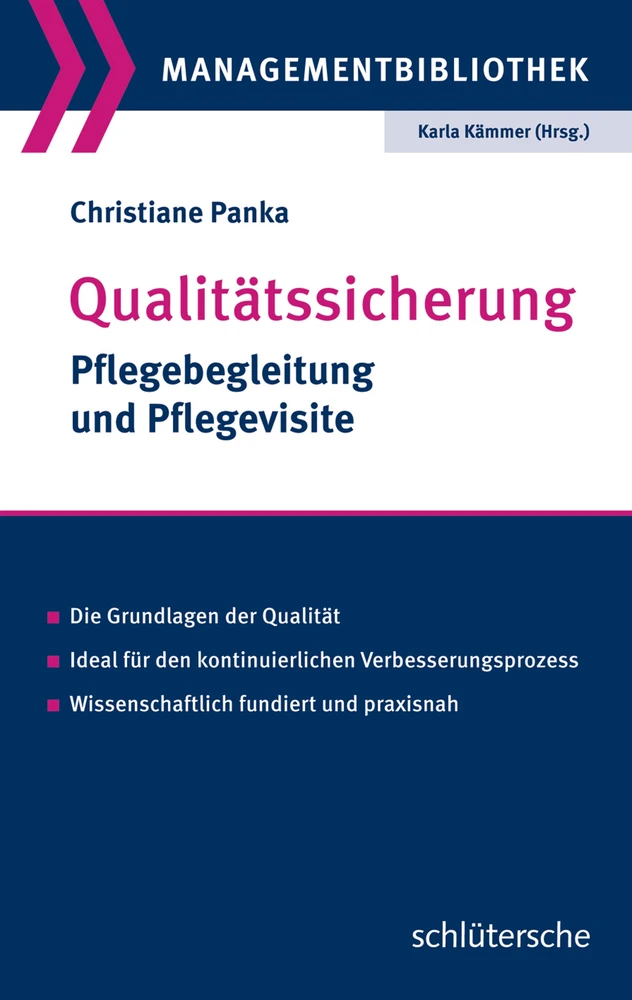Qualitätssicherung
Pflegebegleitung und Pflegevisite. Die Grundlagen der Qualität. Ideal für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wissenschaftlich fundiert und praxisnah
Zusammenfassung
In diesem Buch werden zwei zentrale Instrumente der
Qualitätssicherung vorgestellt: Pflegebegleitung und Pflegevisite.
Beide Instrumente basieren auf dem Pflegeprozess und lassen sich – zumindest in ihren Grundzügen – schnell in einer Einrichtung installieren.
Aber sie stellen auch Anforderungen: an die Kompetenz der Pflegekräfte, ihre Aus- und Fortbildung.
In diesem Buch werden beide Instrumente inhaltlich und formal dargestellt,
in ihrem Ablauf erklärt und in ihren Konsequenzen erläutert.
Schwerpunkte sind dabei Pflegecontrolling, Kommunikation und direkte Pflegebegleitung im Alltag.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Pflegebegleitung und Pflegevisite sind zwei anerkannte Instrumente im Pflegeprozess. Sie gehören zum täglichen Geschäft. Gerade ihre schon selbstverständliche Anwendung führt dazu, dass Einsatz und Wirksamkeit nicht mehr hinterfragt und die vielfältigen Möglichkeiten, die sie bieten, nicht immer effektiv genutzt werden.
Dieses Buch richtet sich an Sie als Pflegedienstleitung und Qualitätsbeauftragte in der stationären Pflege, im ambulanten Bereich, in der Tagespflege oder im Hospiz. Es behandelt nicht nur in innovativer Weise die inhaltlichen und prozessualen Aspekte von Visite und Begleitung, sondern bezieht auch die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Klienten, auf Personalentwicklung und Risikomanagement ein.
Dr. Christiane Panka beschreibt kompakt und übersichtlich Pflegebegleitung und Pflegevisite als Säulen der Qualitätssicherung. Sie »räumt auf«, grenzt ab und zeigt detailliert, was die beiden Methoden zu leisten vermögen. Die Unterteilung in jeweils 10 gut nachvollziehbare Arbeitsschritte erleichtert Ihnen als Leser(in) und Anwender(in) die Umsetzung in die eigene, individuelle Praxis. Die zahlreichen im Pflegealltag bewährten Mustervorlagen und Checklisten leisten dabei strukturelle Hilfe. Man merkt gleich, die Autorin weiß, wovon sie spricht.
Ich freue mich, Ihnen diesen neuen interessanten Band unserer jungen Reihe Managementbibliothek zu präsentieren, und bin überzeugt, dass Ihnen Lektüre und praktische Anwendung Gewinn bringen.
Essen, im Juli 2013 |
Karla Kämmer |
Einleitung
Pflegevisite und Pflegebegleitung –
zwei Säulen der Qualität
Das Thema Qualitätssicherung ist spätestens seit 1996 mit der Einführung der »Maßstäbe und Grundsätze zur Qualität« im SGB XI aktuell und wird immer wieder diskutiert. Im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses muss jede Einrichtung, stationär, teilstationär oder ambulant, Qualität leisten.
Auch wenn die meisten stationären Einrichtungen in Deutschland eine Note von 1 oder 2 bei den Pflegetransparenzkriterien1 erringen, ist mit der neuen Prüfrichtlinie (PTVS) nach § 114a SGB XI im Jahr 2014 wieder eine Veränderung in Sicht. Durch die verschobene Bewertungssystematik und die veränderten Bewertungskriterien sind die Einrichtungen in der Pflicht, ihre Pflegequalität neu zu beurteilen. Bei diesem Prozess sind die Pflegevisite und die Pflegebegleitung wertvolle Arbeitshilfen.
In diesem Buch wird in leicht verständlicher Weise die Abgrenzung der Pflegevisite von der Pflegebegleitung vorgenommen. Diese Abgrenzung hat sich als notwendig erwiesen. So wurde z. B. in der Dissertation »Die Pflegevisite als Steuerungsinstrument im Pflegeprozess«2 als Forschungsergebnis unter anderem deutlich, dass diese Begriffe oft in einem Zug genannt und ihre Inhalte vermischt werden.
Abgrenzung Pflegevisite und Pflegebegleitung
Die Pflegevisite richtet den Fokus auf den Bewohner und seine Zufriedenheit (z. B. Heering, 2006).
Die Pflegebegleitung fokussiert auf den Mitarbeiter und seine Leistungsfähigkeit. Wie vielfältig diese Fokussierungen sind und wie Leitungskräfte in der Pflege von der Pflegebegleitung und von den Pflegevisiten profitieren können, wird in den folgenden Kapiteln aufgezeigt.
Anhand von praktischen Beispielen stelle ich Ihnen die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten der beiden Instrumente dar. Aus meiner langjährigen Praxis kann ich Ihnen darüber hinaus gute und weniger gute Einsatzmöglichkeiten in allen Bereichen des deutschen Gesundheitssystems beispielhaft darstellen sowie Empfehlungen geben.
Sie können sich anhand von zehn leicht nachvollziehbaren Arbeitsschritten Ihre individuelle, flexible Pflegevisite zusammenstellen. Das Prinzip wiederholt sich auch bei der Pflegebegleitung, sodass sich für jeden von Ihnen – Pflegedienstleiter oder Qualitätsbeauftragten – sinnvolle Praxistipps ergeben.
_____________
1 Vgl. Rupsch, T. (2013). Statistiken zu den Transparenzberichten und den Pflegenoten der MDK-Prüfungen. Im Internet: www.mdk-pruefung.com/statistiken-transparenzberichte- pflegenoten/ [Zugriff am 6.10.2013]
2 Vgl. Panka, C. (2013). Die Pflegevisite als Steuerungsinstrument im Pflegeprozess. Berlin: hps media
1 Die flexible Pflegevisite
Das Ziel der flexiblen Pflegevisite ist es, die Pflegequalität möglichst effektiv und positiv zu beeinflussen. Gestatten Sie mir deshalb, Ihnen im ersten Teil die Hintergründe sowie die geschichtliche Entwicklung der Pflegevisite und deren Notwendigkeit darzustellen. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, Pflegevisiten zu erstellen. So entsteht Schritt für Schritt eine individuelle, flexible Pflegevisite, passend für Ihre Einrichtungsform.
Auf eine Definition von Qualität verzichte ich, denn es existieren viele Werke, die die Qualität im Rahmen eines Zertifizierungssystems (z. B. DIN ISO-Normen3) definieren bis zu der einfachen Definition, dass Qualität das ist, was dem Klienten gefällt.
Ich verstehe Qualität in diesem Buch als etwas Erstrebenswertes, Positives, das immer wieder weiter verbessert werden kann.
Das zentrale Arbeitsorganisationsinstrument in der Pflege ist der Pflegeprozess, der aber leider nicht immer so angewandt wird, wie er theoretisch angewendet werden sollte. Es gibt strukturelle und prozessuale Umsetzungsprobleme.4 Wenn der Pflegeprozess fachlich bereits korrekt durchgeführt würde, dürfte eine Pflegevisite als zusätzliches Instrument nicht erforderlich sein.5 Gründe für Defizite bei der Umsetzung des Pflegeprozesses6:
■ Fehlende oder mangelhaft strukturierte Pflegedokumentation, d. h. es fehlen grafisch und inhaltlich sinnvolle und ansprechend gestaltete Dokumente oder Masken (Software).
■ Die Planung der Pflege erfolgt meist klientenfern, d. h. die Klienten sind über die Pflegeziele oft nicht informiert, da die Planung ohne sie stattfindet.
■ Die Schreibarbeit hat gegenüber der praktischen Arbeit am Klienten einen geringen Stellenwert.
■ Die Überprüfung der Inhalte erfolgt nicht systematisch und ausreichend. Es werden Intervalle festgelegt, die mit den eigentlichen Veränderungen nichts zu tun haben.
■ Die Fachkraftpräsenz ist ungenügend, d. h. es bleibt nicht genügend Zeit für eine ausführliche Pflegeprozessplanung.
Einige dieser Defizite können mit der flexiblen Pflegevisite ausgeglichen werden. So können Sie z. B. während der Pflegevisite mit dem Klienten gemeinsam die Pflegeplanung überprüfen und aktualisieren. Sie können realistische, umsetzbare Ziele finden, gemeinsam formulieren und die Inhalte systematisch überprüfen. Außerdem können Sie individuelle Evaluationsintervalle festlegen und Risiken berücksichtigen.
Die flexible Pflegevisite kann Ihnen und Ihren Mitarbeiter auch den Stellenwert der meist ungeliebten Schreibarbeit verdeutlichen: Mit der flexiblen Pflegevisite lassen sich z. B. Doppeldokumentationen aufdecken und vermeiden. Es wird nur das dokumentiert, was wichtig und rechtlich relevant ist.
Pflegequalität ist etwas Flüchtiges. Sie ist von der Situation des Pflegebedürftigen abhängig, die sich kurzfristig verändern kann. Jeden Tag muss Pflegequalität aufs Neue von vielen verschiedenen Mitarbeitern erbracht werden.7 Die flexible Pflegevisite und die Pflegebegleitung können Fehler vermeiden bzw. beheben, die gerade bei mangelnder Fachkraftpräsenz entstehen können (vgl. Kapitel 2).
Fazit
Die Pflegevisite wird in der Literatur als eines der wirksamsten Instrumente in der Qualitätssicherung beschrieben.* Eine zweite Kontrollschleife (Pflegevisite als Kontrollinstrument des Pflegeprozesses) außerhalb der täglichen Routine ist sehr sinnvoll, wenn sie bewusst genutzt wird.**
* Kämper & Pinnow 2010, S. 5
** Vgl. Koch, Christian. (4. Dezember 2013). www.social-software.de. http://www.social-software.de/adb/produkte.php?idp=766
1.1 Zehn Schritte zur flexiblen Pflegevisite
1. Schritt: Definition
Visite/Visitation (lat.) wird nach Götze (1996) übersetzt als: »(prüfende) Besichtigung oder Besuch (besonders zur Untersuchung von Kranken)«.
Das Medizin-Lexikon vom Urban & Fischer Verlag (2006) beschreibt die Visite als regelmäßig am Krankenbett stattfindende Gespräche des behandelnden Arztes und/oder des Pflegepersonals mit dem Patienten. Sie dient zur Weitergabe von Beobachtungen, Darstellungen des Krankheitsverlaufs, Befragungen und Untersuchungen des Patienten, Besprechung des weiteren Vorgehens, Abstimmen der pflegerischen und medizinischen Planung.
Am häufigsten lassen sich in der Literatur zwei Definitionen der Pflegevisite finden:
1. Die Definition des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) ist die längste und ausführlichste von allen Definitionen. Sie lautet in Kurzform: »Die Pflegevisite wird als Besuch beim Pflegebedürftigen durchgeführt und dient u. a. der Erörterung des Befindens des Pflegebedürftigen, seiner individuellen Wünsche und seiner Zufriedenheit mit dem Pflegedienst sowie der Erstellung, kontinuierlichen Bearbeitung und Kontrolle der Pflegeplanung sowie der Pflegedokumentation (…). Die Pflegevisite ist ein Planungs- und Bewertungsinstrument, das kunden- oder mitarbeiterorientiert durchgeführt werden kann«.8
2. Die Definition von Heering wird am häufigsten zitiert: »Die Pflegevisite ist ein regelmäßiger Besuch bei und ein Gespräch mit der/dem KlientIn über ihren/seinen Pflegeprozess. Die Pflegevisite dient der gemeinsamen Benennung der Pflegeprobleme und Ressourcen bzw. der Pflegediagnose, Vereinbarung der Pflegeziele, Vereinbarung der Pflegeinterventionen und Überprüfung der Pflege.«9
Zu 1) Die Definition des MDS hat vor dem Hintergrund der »Pflegebenotung« einen hohen Stellenwert. Sie ist aber sehr umfassend und bedarf einer ausführlichen Erläuterung mit der sog. Prüfanleitung. Für eine hausinterne Richtlinie z. B. in der stationären Altenpflege ist sie zu lang. Außerdem vermischt sie die Pflegevisite mit der Pflegebegleitung.
Zu 2) Das Ansprechende an der Definition von Heering ist ihre Kürze und Verständlichkeit. Der Besuch beim Patienten sowie das direkte Gespräch mit ihm stehen im Mittelpunkt. Heering hat seine Definition entwickelt, um im Krankenhaus dem Patienten durch die Einführung der Pflegevisite mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen und ihn in den Pflegeprozess direkt miteinzubinden. Er hat dabei jedoch nicht den demenziell erkrankten Menschen im Pflegeheim im Blick gehabt, der seinen Pflegeprozess oder ein effektives Gespräch nicht mehr allein steuern kann.
Eine schnelle und praxisnahe Definition
Eine Definition, die für alle Einrichtungsarten im Gesundheitswesen nutzbar ist, wird vom DBfK zur Verfügung gestellt. Sie lässt sich gut in Verfahrensanweisungen übernehmen und grenzt sich deutlich von der Pflegebegleitung ab: »Die Pflegevisite ist ein inhaltlich und gestalterisch flexibles Instrument zur Überprüfung der Umsetzung des Pflegeprozesses und zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität. Die Pflegevisite erfolgt in festgelegten Abständen auf der Basis von strukturierten Gesprächen und Beobachtungen im direkten pflegerischen Umfeld von Pflegefachkräften unter Mitwirkung des Klienten und/oder seines Angehörigen/seiner Bezugsperson.«*
* Vgl. Panka, C., & Stenzel, C. (2010). Praxisheft: Leitfaden zur Pflegevisite. Eine Arbeitshilfe für die Praxis. 4. Auflage. Berlin-Brandenburg: DBfK Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.
2. Schritt: Ablauf
Der Ablauf einer Pflegevisite kann in sechs Schritten beschrieben werden (vgl. Abbildung 1). Die Phasen können bis auf eine Ausnahme (Metaanalyse anstelle einer Problem- und Ressourcenformulierung) mit dem sechsschrittigen Pflegeprozess von Fiechter und Meier (1993) verglichen werden. Die Visite beginnt mit einer Datenerhebung, oft mit Leitfaden oder Protokollvordruck. Aus den Daten werden Ziele abgeleitet, Maßnahmen festgelegt und durchgeführt. Die Evaluation kann durch eine Kontrolle oder eine neue Pflegevisite erfolgen. Übergreifend werden dann in einer Metaanalyse die Pflegevisiten insgesamt ausgewertet. Ergebnisse dieser Auswertung können die Veränderung der Pflegevisitenprotokolle oder z. B. eine Aufnahme der analysierten Schwachstellen in die Fortbildungsplanung sein. In der Metaanalyse zeigt sich die Flexibilität (daher der Name »flexible« Pflegevisite). Das Pflegevisitenprotokoll muss nicht über Jahre immer das gleiche sein. Nur die Anpassung an die Bedürfnisse macht es sinnvoll und effektiv.

Abb. 1: Der flexible Pflegevisitenprozess.
Nutzen Sie alle Phasen des Pflegevisitenprozesses
Gerade die Metaanalyse hilft Ihnen, Entscheidendes zur Effektivität der Visite beizutragen. Wenn Sie die Pflegevisiten nach der Durchführung und Bearbeitung nur abheften, verschwenden Sie wertvolle Ressourcen.
3. Schritt: Ziele
Die ersten Nachweise für die Nutzung von Pflegevisiten gab es am Anfang der 1980er Jahre.10 Zu dieser Zeit war die Pflegevisite ein reines Kontrollinstrument und wurde vor allem im Krankenhaus angewendet. Es ist anzunehmen, dass sie sich von der ärztlichen Visite ableitete. Der Vorläufer der heutigen Pflegevisite ist die Übergabe am Bett. Sie war eine Weiterentwicklung der normalen Dienstübergabe von Schicht zu Schicht im Dienstzimmer anhand der Akten. Diese Dienstübergabe fand und findet in vielen Krankenhäusern auch heute noch, mit den jeweiligen Bereichspflegekräften, direkt am Bett mit dem Patienten statt. So können die Mitarbeiter die Patienten und evtl. pflegerische Besonderheiten, wie technische Geräte oder optimale Lagerungsarten, kennenlernen. Auch der Patient kann befragt werden, wie es ihm geht und seine Anliegen vorbringen. Die Übergabe am Bett hat jedoch allein durch die zeitlichen Ressourcen seine Grenzen. Auch wird der Patient vor vielen Mitarbeitern und evtl. Mitpatienten kaum intime Probleme ansprechen.
Von 1981 bis ca. 1989 gab es mehr Erfahrungen mit Pflegevisiten im ambulanten und stationären Sektor. In den folgenden Jahren wurden Methoden der Pflegevisite diskutiert, die jedoch nur auf Erfahrungswissen beruhten. Hauptinitiator war in dieser Zeit das Ehepaar Heering in der Schweiz11, die bei den Visiten den Patienten als Partizipierenden in den Mittelpunkt stellten. Es wurden gemeinsam Ziele gesteckt und Maßnahmen festgelegt.
Der Hauptmotivator zur Verwendung von Pflegevisiten war die Einführung der Pflegeversicherung im ambulanten (1995) und stationären (1996) Sektor des Gesundheitswesens, mit der externen Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Es entstand die Prüfrichtlinie »Anleitung zur Prüfung der Qualität in der stationären Pflege nach § 80 SGB XI.« In den Qualitätsprüfungsrichtlinien (MDS 1996) wurde die Pflegevisite nun als Mittel der internen Qualitätssicherung neben Qualitätsbeauftragten, Qualitätszirkeln, Standards, Qualitätsmanagementhandbüchern, Fallbesprechungen und Fortbildungen bezeichnet. Die Qualitätsprüfrichtlinie musste aus politischen Gründen sehr zügig erstellt werden, sodass die Zeit für eine wissenschaftliche Fundierung fehlte.
Erste Schritte im Bereich des Qualitätssicherungsinstrumentes »Pflegevisite« in Richtung der wissenschaftlichen Forschung erfolgten 2002, 2007 sowie 2013. In diesen Jahren wurden im ambulanten Bereich12, im Krankenhaussektor13 und in stationären Pflegeeinrichtungen14 wissenschaftliche Studien durchgeführt: Es wurden jeweils explorativ die Ist-Stände der Pflegevisiten (Inhalt, Form und Aufbau) erhoben und teilweise Best-Practice Modelle vorgestellt. Die Ergebnisse fließen in dieses Buch mit ein.
Tabelle 1 zeigt, wie sich über der Inhalt der Pflegevisiten den Bedürfnissen der Institutionen angepasst hat. Der Einfluss, gerade der Qualitätsprüfrichtlinien des MDK, hat sich vor allem im ambulanten und stationären Bereich der Altenpflege ausgewirkt und weniger im Krankenhausbereich, da er nicht von den SGB XI Prüfrichtlinien betroffen ist.
Tabelle 1 zeigt, wie viele Aspekte eine Pflegevisite berücksichtigen könnte. Der Wunsch vieler Qualitätsbeauftragten und Pflegedienstleitungen ist es sicherlich, mit einer Pflegevisite alle Problem- und Risikobereiche zu erkennen und positiv zu beeinflussen. Doch schon Habermann & Biedermann erkannten, dass ein »Catch-all« oder »Alles auf einen Streich-Prinzip« nicht möglich ist. So wird die Pflegevisite zu einem unspezifischen und nicht effektivem Instrument verkümmern.
Aus dem Wunsch heraus, alles in eine Visitenform einzubringen, entwickelte sich die modulare Pflegevisite. Sie ist der direkte Vorgänger der flexiblen Pflegevisite. In der modularen Form werden einzelne Themenbereiche fokussiert und in Kombination oder einzeln genutzt. Als Beispiele sollen hier die K&K Pflegevisite von Kämmer15 sowie die modulare Visite von Kußmaul genannt werden. Die Inhalte dieser Visiten sind jedoch festgelegt und nicht flexibel zu verändern.
Tabelle 2: Mögliche Ziele einer Pflegevisite für spezielle Bereiche des Gesundheitswesens

Definieren Sie die Ziele
Bevor Sie sich für die Inhalte einer Pflegevisite entscheiden, sollten Sie sich über die Ziele der Visite im Klaren sein. Als Pflegedienstleitung müssen Sie sich die Frage stellen, was, wann und womit erreicht werden soll.
4. Schritt: Titel
Tabelle 2 zeigt, wie breit das Spektrum der Ziele einer Pflegevisite ist. Die Auswahl des Hauptzieles ist der erste Schritt in der Entwicklung der flexiblen Pflegevisite. Dieser Schritt sollte jedes Jahr erneut getan werden. Jede Einrichtung entwickelt sich unterschiedlich und genau auf diesen Aspekt geht die flexible Pflegevisite ein. Ist das Ziel (oder: die Ziele) erst einmal deutlich, ist der zweite Schritt die Auswahl der Inhalte. In der Literatur finden sich über 27 verschiedene Titel von Pflegevisiten, die Hinweise auf deren Inhalte geben. Teilweise werden sie in allen Bereichen des Gesundheitswesens genutzt, oder aber auch nur in einem Bereich, wie z. B. die postoperative Pflegevisite. Sie wird nur im Krankenhaus genutzt. Die verschiedenen Möglichkeiten:
1. Pflegevisiten im Krankenhaus
Übergabe am Bett: Die Übergabe am Bett ist der Vorläufer der Pflegevisite.16 Bei der Übergabe am Bett werden am Bett des Patienten die pflegerelevanten Informationen ausgetauscht. Die Mitarbeiter der nächsten Schicht erhalten so einen ersten Eindruck vom Patienten und können vor Ort Spezifika (Wunden, technische Geräte etc. ) begutachten. Der Patient hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder befragt zu werden. Eine besondere Form der Übergabe am Bett, ist die Übergabe am Bett für geriatrische Bereiche.17
Lehrvisiten: Diese Visiten werden im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung meist von den Praxisanleitern/Mentoren der Auszubildenden durchgeführt. Je nach Ausbildungsstand werden die Anforderungen angepasst. Es ist möglich, die Ergebnisse protokollarisch festzuhalten und zu bewerten (vgl. Kapitel 2).
Kurvenvisiten: Dies sind Visiten, die sich nur mit der Dokumentation (veraltet, Kurve) befassen. Es wird überprüft, ob den Anforderungen (hausintern und/oder gesetzlich) Genüge getan wird. Es kann darum gehen, nicht mit Bleistift zu schreiben, die Notierungsintervalle einzuhalten oder die Blätter/Eingabemasken am PC vollständig auszufüllen.
Pflegevisiten zu Einzelproblemen: Dies können z. B. Ernährungsprobleme, Schmerzen oder ein Dekubitusrisiko sein, die bei dieser Art von Visiten in den Fokus genommen werden.
Pflegevisiten der Pflegedienstleitung: Für die inhaltliche Gestaltung der Visiten durch die Pflegedienstleitung gibt es zwei Möglichkeiten. So wird eine 30- bis 45-minütige Vorstellung der Problempatienten anhand der Dokumentation und bei Bedarf eine anschließende Patientensichtung mit Zielvereinbarung durchgeführt.18 Müller (1984) beschreibt diese Visiten so, dass die Pflegedienstleitung an der Übergabe teilnimmt und anschließend bei drei oder vier Patienten die pflegerische Versorgung begleitet und kontrolliert.
Präoperative Pflegevisite: Dies ist ein Besuch mit Gespräch beim zu operierenden Patienten über seinen Pflegeprozess. Im Idealfall wird der Besuch durch ein evaluierendes Gespräch nach der Operation ergänzt.19
Anästhesiepflegevisite: Sie stellt das Pendant zur präoperativen Pflegevisite da, wird allerdings von Anästhesiepflegekräften durchgeführt.
Visite zur Vorbereitung der Entlassung: Im Rahmen des Entlassungsmanagements werden in Krankenhäusern Visiten zur Vorbereitung derselben durchgeführt. Die Beteiligung von Pflegekräften und Sozialarbeitern ist möglich.20
Systemische Pflegevisite: Eine weitere, aber schwer umzusetzende Idee, ist es, die Visiten der Ärzte mit denen der Pflege zu verbinden. Dazu ist es laut Kerres21 von pflegerischer Seite notwendig, die Abgrenzungsbestrebungen zu Gunsten eines integrierten Ansatzes aufzuweichen. Von ärztlicher Seite gilt es, Akzeptanz zu zeigen und die Wichtigkeit der pflegerischen Maßnahmen zu bekunden. Ziel ist ein gemeinsames Gesamtkonzept.
Hygienevisiten: Beim Auftreten von multiresistenten Keimen etc. bedarf es spezieller Visiten. In einer Hygienevisite wird der korrekte Umgang mit den Keimen und evtl. die Keimhäufung mittels Abklatschmethode überprüft. Diese Visiten werden meist von speziell ausgebildeten Hygienefachkräften durchgeführt. Die Ergebnisse werden dann mit der Geschäftsleitung kommuniziert.
2. Pflegevisiten in der stationären Altenpflege
Pflegevisiten für Menschen mit demenziellen Erkrankungen:
Häufig ist mehr als die Hälfte aller Heimbewohner an einer Demenz erkrankt. Die Betroffenen können z. B. bei Zufriedenheitsbefragungen nicht immer adäquat antworten. Oleksiw (2007) empfiehlt, die Form der Visite an den Fähigkeiten der Bewohner auszurichten. So können Beobachtungen während einer Aktivität in der Tagesgruppe vorgenommen werden.
Dokumentationsvisiten: Hier gilt das Gleich wie bei den Kurvenvisiten im Krankenhausbereich.
Lehrvisiten: Siehe oben
Visiten zu Einzelproblemen: Siehe oben
Supervidierende Pflegevisite: Vorgesetzte Mitarbeiter führen diese Visite im Sinne einer Prüfung und Beratung durch. Sie ist nach Kämmer (2001) als eine Methode der Qualitätssicherung zu sehen. Im Sinne dieses Buches gehört sie zur Pflegebegleitung.
Kollegiale Pflegevisite: Die kollegiale Pflegevisite findet unter gleichberechtigten Kollegen im Sinne eines Fachaustausches statt. Die Bewertung der Pflegeleistung steht hier nicht im Vordergrund.22
Visite zur Selbstreflexion: Die Visite zur Selbstreflexion wird in der stationären Altenpflege am häufigsten angewendet. Sie stellt eine fachliche Überprüfung der eigenen Leistungen im Bezugspflegeteam dar.23 Personell und organisatorisch ist sie einfach durchzuführen, ihre Effektivität und Objektivität ist allerdings in Frage zu stellen.
Vergleichsvisite: Diese Visitenform ist die zeitlich aufwändigste. Bei dieser Form der kollegialen Visite werden die Mitarbeiter dazu motiviert, sich und ihre Arbeit zu reflektieren, indem sie Aussagen und Beobachtungen in ähnlichen Situationen vergleichen. Die Ergebnisse werden in einen Maßnahmenplan integriert.24
Übergabe am Bett: Diese Übergabe kann z. B. bei schwerstpflegebedürftigen Bewohnern ebenso wie im Krankenhaus am Bett stattfinden. Es ist jedoch keine Pflegevisite im eigentlichen Sinne der Definition.
Visite nach Krankenhausaufenthalt: Die Inhalte einer Pflegevisite nach einem Krankenhausaufenthalt legen den Fokus auf dem aktuellen Gesundheits- und Pflegezustand. Es wird geprüft, inwieweit sich der Zustand vor und nach dem Krankenhausaufenthalt verändert hat. Vitalwerte und gegebenenfalls Fotos von Hautzuständen ergänzen das Pflegevisitenprotokoll.
Betreuungsvisiten: Die Form der Betreuungsvisiten tritt nur im Pflegeheim oder in den Tagespflegen auf, wo die Betreuung eine wichtige Rolle in der Tagesgestaltung spielt. Das Augenmerk liegt hier auf die Biografie und die Beteiligung an Einzelund/oder Gruppenangeboten der Einrichtung. Schwerpunktmäßig werden Klienten mit einem Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 87b SGB XI oder Bettlägerige mit Hospitalismusgefahr visitiert. Diese Visitenform wird meist mittels Befragung des Betroffenen durchgeführt. Sie orientiert sich oft eng an der Prüfrichtlinie des MDK.
Hygienevisiten: Siehe oben
Große/kleine Pflegevisite: Diese beiden Formen unterscheiden sich im Volumen der Items im Visitenprotokoll. Sie werden auch als Makro- und Mikrovisiten bezeichnet. Oft werden die kleinen von den Mitarbeitern des Wohnbereichs und die großen Visiten von Leitungskräften oder Qualitätsbeauftragten durchgeführt. Panka & Stenzel (2010) bezeichnen als Mikrovisite die Überprüfung von Teilbereichen mittels Checklisten oder Modulen.
3. Pflegevisiten im ambulanten Bereich
Erstvisite: Bei der Erstvisite, kurz nach der Übernahme des pflegerischen Auftrages, sind im ambulanten Bereich viele Dinge zu berücksichtigen. Es werden nicht nur die notwendigen pflegerischen Maßnahmen besprochen und geplant, auch die Beratung über Risiken und die Aufklärung über die Angebote, die evtl. über die Pflege hinausgehen (z. B. Tierbetreuung bei Krankenhausaufenthalten) kann bei einer Erstvisite besprochen werden. Auch die Festlegung der Art der Leistungsberechnung nach Pauschalen oder Minuten muss überlegt werden. Die Erstvisite eignet sich ebenfalls zur Betrachtung des häuslichen Umfeldes. Evtl. sind Umbauten notwendig oder Hilfsmittel zu beschaffen um den Alltag bewältigen zu können.
Visiten zur Pflegeeinstufung: Visiten zur Überprüfung der Pflegestufe werden nicht nur im ambulanten Bereich durchgeführt. Auch in der stationären Altenpflege sind sie verbreitet und können in zwei Formen durchgeführt werden. Ist dem Visitierenden der Klient mit seinem individuellen Pflegebedarf bekannt, ist es möglich, nur eine Dokumentationsvisite durchzuführen und das in der Pflegeplanung Notierte mit dem tatsächlichen Aufwand zu vergleichen. Hilfreich ist hier eine Zeittabelle, wie sie auch der MDK bei der Einstufung benutzt.
Ist der Klient dem Visitierenden nicht bekannt oder ist sich der Visitierende nicht sicher, ob sich der Pflegebedarf tatsächlich verändert hat, ist es sinnvoll, die Visite beim Klienten durchzuführen und evtl. mit der Uhr die pflegerischen Aufwände zu kontrollieren und mit den vorgegebenen Werten zu vergleichen. Anschließend wird die Pflegeplanung auf den aktuellen Stand gebracht und die Pflegestufenveränderung durch den Klienten oder seinen Vertreter bzw. durch die Einrichtung beantragt.
Visite zur Leistungsabsprache: Diese Visitenform entspricht der gerade erläuterten Form. Es werden aber nicht die pflegerischen Belange besprochen, sondern eher oder ergänzend die Zusatzleistungen.
Visite vor oder nach Krankenhausaufenthalt: Diese Visitenform hat sich aus einer rechtlichen Relevanz heraus entwickelt. Ein zusätzlicher Impuls ergab sich aus der Entwicklung des Expertenstandards »Entlassungsmanagement«. Es gibt zwei Themenbereiche, bei denen es nach Krankenhausaufenthalten häufig zu Diskussionen bis hin zu gerichtlichen Klagen kommt. Der eine Bereich sind Wunden und hier am häufigsten der Dekubitus, der andere ist der Bereich der Unterernährung bzw. der Dehydratation.25 Viele Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen haben es sich daher angewöhnt, vor und/oder nach einem Krankenhausaufenthalt eine Pflegevisite durchzuführen. Diese hat den Schwerpunkt der körperlichen Visite mit einer genauen Haut- und Hautfaltenbeschreibung. Einige Einrichtungen halten den Zustand auch mittels eines Fotos fest.
Visiten bei Konflikten mit Angehörigen: Es kann hilfreich sein, bei Konflikten mit Bezugspersonen in der ambulanten aber auch in der stationären Pflege sowie im Krankenhaus eine gemeinsame Pflegevisite durchzuführen. In dieser Visite können meist gemeinsam mit dem Klienten und seinen Angehörigen Probleme angesprochen werden. Anschließend wird versucht, sie unmittelbar zu lösen oder Termine zur Lösung festzulegen. Da die Inhalte sehr vielseitig sein können, ist es schwer, mit einem vorgefertigten Protokoll zu arbeiten. Betrifft es jedoch z. B. die Umgebungsgestaltung oder die Zufriedenheit, können diese Bögen genutzt werden. Ein Beschwerdeprotokoll oder ein Blankobogen sind gute Alternativen dazu.
Dokumentationsvisite: Die Dokumentationsvisite unterscheidet sich im ambulanten Bereich im Allgemeinen nicht von der im Krankenhaus. Es sind jedoch andere Vorgaben zu berücksichtigen (z. B. Ausführlichkeit der Pflegeplanung, wenn überhaupt bei Kurzaufenthalten eine erstellt wird), sowie andere Vordrucke, die evtl. in ihrer Ausfüllung überprüft werden müssen.
Mitarbeiterorientierte Pflegevisite: Die mitarbeiterorientierte Pflegevisite wird in diesem Buch unter dem Begriff Pflegebegleitung subsummiert. Sie ist ein Instrument der Personalentwicklung und hat nicht hauptsächlich den Klienten im Fokus (vgl. Kapitel 2).
Mikro-/Makrovisite: Diese Begriffe entsprechen den unter der stationären Altenpflege erläuterten großen und kleinen Pflegevisiten. Sie werden in der ambulanten Pflege ebenso durchgeführt.
Lehrvisiten: Lehrvisiten werden im Bereich Krankenhaus erläutert. Sie werden sinngemäß genauso, nur mit anderen Inhalten wie im Krankenhaus (z. B. Operationsvor und -nachbereitung entfällt hier) in der stationären und ambulanten Pflege durchgeführt (vgl. Kapitel 2).
Hygienevisiten: Auch Hygienevisiten werden ähnlich wie im Krankenhaus durchgeführt. Da die Schwerpunkte in der Häuslichkeit anders liegen als im Krankenhaus werden sie inhaltlich anders gestaltet.
4. Pflegevisiten in der Tagespflege
Ergänzend zu den oben Genannten:
Visite in der Häuslichkeit: Den Pflegenden in der Tagespflege ist oft nicht bekannt, wie der Tagespflegegast zu Hause lebt. Ein Besuch in der Häuslichkeit kann da zu mehr Verständnis und adäquaterer Biografiearbeit führen. Zu berücksichtigen sind hier die Zeitkapazitäten der Pflegenden und der Angehörigen sowie die Möglichkeit, dass es von den Angehörigen nicht gewollt sein kann, dass die Pflegenden Einblick in die Häuslichkeit erhalten. Hier ist gute Aufklärung und die Nutzung eines Merkblattes zu empfehlen. Weiterhin ist nicht geklärt, wer die Fahrtkosten übernimmt. Wird eine Visite in der Häuslichkeit abgelehnt, ist es eine gute Alternative, den Gast und seine Angehörigen zusammen zu einem Gespräch einzuladen. Auch bei dieser Form können viele zusätzliche Informationen gewonnen werden. Der Bogen mit der Befragung zur Zufriedenheit wird hier am häufigsten genutzt.
Betreuungsvisiten: Die Betreuung und Alltagsgestaltung ist das Herzstück der Arbeit in der Tagespflege. Ihre Durchführung sollte nicht vernachlässigt werden und mittels einer Pflegevisite in diesem Bereich überprüft werden.
5. Pflegevisiten im Hospiz
Ergänzend zu den oben Genannten:
Multiprofessionelle Pflegevisite (mit Fallbesprechung): Im Hospiz liegt der Schwerpunkt in der Schmerzbekämpfung und in der Erfüllung möglichst vieler individueller Wünsche in der letzten Lebensphase. Lebensqualität zu erhalten kann nur gelingen, wenn bekannt ist, was für den Betroffenen Lebensqualität bedeutet. Die Biografiearbeit, d. h. die Beschäftigung mit der Vergangenheit, reicht da nicht aus, da sich Gewohnheiten und Vorlieben mit der Zeit durchaus verändern können. Dies kann in einer speziellen Visitenform erfragt und beobachtet werden. Wenn möglich, sind alle im weiteren Umfeld betroffenen Personen miteinzubeziehen, da der Klient oft nicht mehr aussagefähig ist und auf Erfahrungswissen zurückgegriffen werden muss. Dies können Ärzte, Bezugspersonen, Ehrenamtliche, Pflegekräfte aber auch die Reinigungskräfte sein. Eine Fallbesprechung kann diese Visite ergänzen oder auch ersetzen.
Geben Sie Ihrer Pflegevisite einen aussagekräftigen Titel
Nur wenn die Pflegevisite einen aussagekräftigen Titel trägt, wissen Ihre Mitarbeiter, wofür diese Visite mit welchem Ziel genutzt werden soll. Schließlich können durchaus für verschiedene Klienten und unterschiedliche Ziele verschieden Visiten genutzt werden.
5. Schritt: Rahmenbedingungen
Die folgenden Rahmenbedingungen und Inhalte der individuellen flexiblen Pflegevisiten werden von der Pflegedienstleitung/Qualitätsbeauftragten in einer Verfahrensanweisung, die in das Qualitätshandbuch der Einrichtung integriert wird, verankert.
Dauer: Eine effektive Pflegevisite ist abhängig von einer guten Vorausplanung. Dazu gehören die Festlegung der Dauer der Visite, die unabhängig vom Anwendungsbereich, aber möglichst nicht länger als 60 Minuten dauern sollte. Die Nachbereitungszeit ist dabei nicht mit einberechnet. Variationen sind möglich, wenn z. B. ein großer Redebedarf bezüglich des Klienten herrscht. In diesen Fällen mag es notwendig sein, einen zweiten Termin nur für diesen Teil der Visite festzulegen.
Teilnehmer: Neben der Dauer ist die Teilnehmerart und -zahl festzulegen. Ist der Klient in die Visite nicht mit einbezogen (z. B. bei der reinen Dokumentationsvisite), führt nur eine Person die Visite durch. Idealerweise ist es eine Person, die nicht direkt für die Pflege des betroffenen Klienten verantwortlich ist. Sie kann die Situation objektiver einschätzen. Ob die prüfende Person eine Leitungsfunktion hat oder gleichgestellt mit der dokumentierenden Kraft, hängt von der Auswahl des Zieles der Visite und der Struktur des Hauses ab. Ist sich die Pflegedienstleitung sicher, dass das Grundprinzip des Pflegeprozesses verstanden wurde, reicht evtl. eine kollegiale Pflegevisite. Sind viele Defizite bekannt und notwendige Schulungen zu erwarten, ist es sinnvoll, eine Leitungskraft oder eine Qualitätsbeauftragte einzusetzen. Fallbezogene Schulungen können in diesem Fall gleich vor Ort durchgeführt werden.
Ist der Klient in die Visite mit einbezogen und sind evtl. noch andere Berufsgruppen oder Bezugspersonen integriert, kann eine Pflegevisite auch mit mehreren Personen durchgeführt werden. Mehr als drei bis fünf Personen sind nicht zu empfehlen, weil ansonsten die Wahrscheinlichkeit, dass der Klient seine Sorgen und Wünsche in dieser Gruppe frei anspricht, gering ist. Ansonsten ergeben sich die Teilnehmer aus den Titeln der Visite. Bei einer Lehrvisite ist z. B. die Mentorin oder die Pflegepädagogin aus der Schule anwesend.
Oft ist es aus terminlichen Gründen nicht möglich, alle Betroffenen zur selben Zeit an einen Tisch zu holen. In diesen Fällen kann auch auf das Instrument der Fallbesprechung zurückgegriffen werden, die im Anschluss an eine Pflegevisite durchgeführt wird. In dieser Besprechung können dann gleich mehrere Pflegevisitenergebnisse mit dem Arzt oder Therapeuten diskutiert werden.
Frequenz: Die Häufigkeit der Durchführung von Visiten ist in den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens sehr unterschiedlich. Sie wird hauptsächlich von den Kapazitäten beeinflusst und weniger von dem Argument der Effektivität. So wird in den stationären Altenpflegeeinrichtungen in jedem Haus nur mindestens einmal jährlich eine Visite durchgeführt26.
Oft orientiert sich die Häufigkeit der Durchführung an den Pflegestufen. Die Visiten werden dann bei den betroffenen Pflegestufen mehr als einmal im Jahr durchgeführt. Hier wird bspw. argumentiert, dass Klienten mit der Pflegestufe I häufiger zu visitieren sind, damit Pflegekräfte möglichst schnell eine Erhöhung des Pflegebedarfes erkennen und die Pflegestufe anpassen können (wirtschaftliche Gründe, oft z. B. in Tagespflegen). Andere argumentieren, dass man die Klienten mit den höchsten Pflegestufen häufiger visitieren solle, da dort die Risiken höher seien, Begleiterkrankungen zu bekommen und die Pflegequalität beobachtet werden solle (Gründe der Qualitätssicherung, eher in der stationären Altenpflege). Auch hier muss die Pflegedienstleitung individuell die Schwerpunkte setzen und sich evtl. mit der Geschäftsführung absprechen.
In den Krankenhäusern sind die Visitenhäufigkeiten klientenunabhängig. Durch die kurzen Verweilzeiten kommt es selten vor, dass ein Klient häufiger als einmal visitiert wird. Hier ist es eher üblich, einen festen Termin zu benennen (vgl. Tabelle 3).
Anlass: Die Häufigkeit der Pflegevisiten wird in einigen Einrichtungen von bestimmten Anlässen gesteuert. Dazu gehören gesundheitliche Veränderungen, Krankenhausaufenthalte, Beschwerden oder geplante Pflegestufenveränderungen. Diese anlassbezogenen Visiten müssen mit ihren Inhalten in der Verfahrensanweisung festgelegt werden.
Viele Einrichtungen stellen zur Vereinfachung einen Jahresplan zur Durchführung von Pflegevisiten auf. In stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen ist er klientenbezogen, in Krankenhäusern evtl. nach Mitarbeitern oder Terminen festgelegt (vgl. Anhang 1a und 1b). Wird der Jahresplan nach Mitarbeitern festgelegt, ist eine ergänzende Berücksichtigung und Notierung im Dienstplan sinnvoll. Wird die Visite nach Terminen fixiert, können diese auch im Dienstplan mit aufgenommen werden.
Tageszeit: Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die günstigste Tageszeit die Zeit ist, an dem Visitierender und Klient möglichst viel Zeit haben, wenig gestört werden und keine anderen Termine Vorrang haben. Im Heimbereich ist es eher der späte Vormittag, im ambulanten Bereich mit berufstätigen Angehörigen eher der späte Nachmittag.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842685529
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Januar)
- Schlagworte
- Altenpflege Altenpflegekräfte Controlling Kommunikation Pflegebegleitung Pflegedienstleitung Pflegeprozess Pflegevisite Qualitätssicherung Wohnbereichsleitung