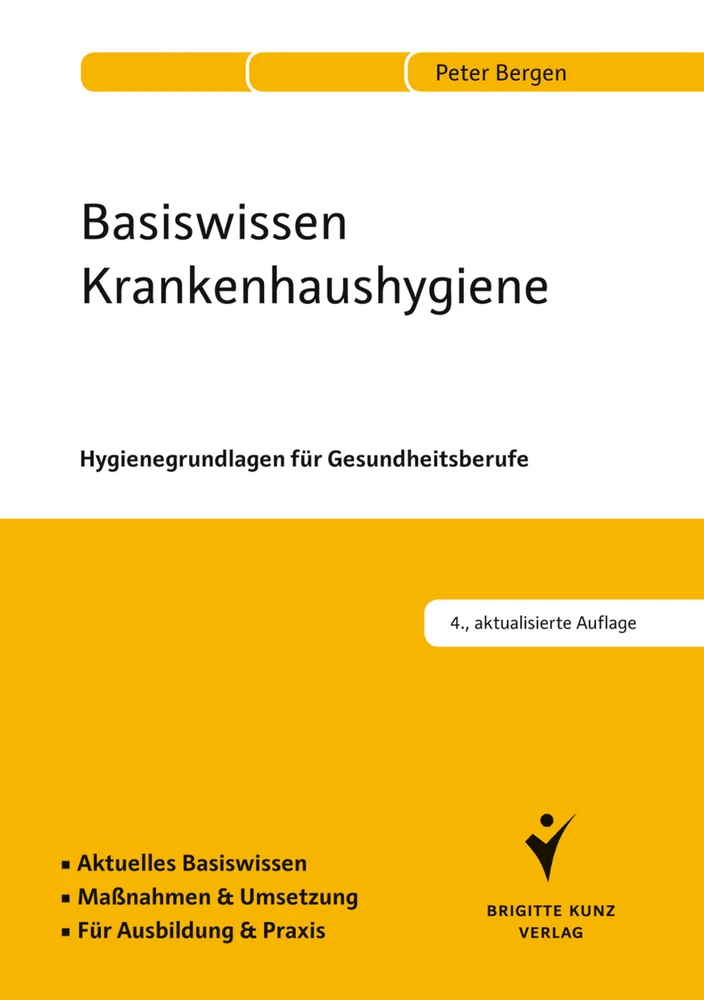Zusammenfassung
So ist das Buch ein unverzichtbarer Ratgeber im Pflegealltag.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Krankenhausinfektionen tragen dazu bei, dass Patienten zusätzliche, teilweise bleibende gesundheitliche Schäden erleiden, wobei auch die Todesfolge nicht auszuschließen ist. Die Quote vermeidbarer Krankenhausinfektionen hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die entsprechenden Hygienemaßnahmen konsequent und sachkundig umgesetzt werden. Dies verlangt von allen am Patienten tätigen Personen grundlegende Kenntnisse in Belangen der Krankenhaushygiene.
Dieses Lehrbuch will allen interessierten und in der Ausbildung befindlichen Pflegepersonen ein praktisch verwertbares Hygienewissen für den Klinikalltag vermitteln. Hierfür wurde »Basiswissen Krankenhaushygiene« neu überarbeitet und aktualisiert. Durch seinen übersichtlichen Aufbau ist dieses Werk als Lehrbuch und als Nachschlagewerk gleichermaßen nutzbar.
Ganz herzlich bedanken möchte mich bei meiner Lektorin Claudia Flöer und bei den weiteren, an diesem Buch beteiligten Mitarbeitern der Schlüterschen Verlagsgesellschaft.
Hildesheim, im Juli 2014
Peter Bergen
1 GRUNDBEGRIFFE
1.1 Gesundheit und Krankheit
Für die Begriffe »Gesundheit« und »Krankheit« gibt es je nach Betrachtungsweise unterschiedliche Auslegungen:
• »Gesundheit ist die Intaktheit des Menschen in seelisch-geistiger, körperlicher und sozialer Hinsicht.« (Medizinische Auslegung)
• »Gesundheit ist der Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens.« (Auslegung der WHO)
• »Gesundheit ist die Fähigkeit, sich an eine gegebene belebte, unbelebte und soziale Umwelt sowohl in seelischer, wie auch in körperlicher Hinsicht ständig neu und jeweils optimal anzupassen.« (Auslegung der Hygieniker Beck und Schmidt)
Gemäß letzterer Definition erkranken wir an veränderlichen Umgebungsfaktoren, wenn wir uns ihnen nicht (oder nicht mehr) anpassen (adaptieren) können. Faktoren wie Lärm, Strahlung, Umgebungstemperatur, Nahrung, Mikroorganismen oder soziale Anforderungen wirken als Exposition auf uns ein. Von unserer momentanen Verfassung, von unserer Disposition, hängt es ab, inwiefern wir diese Einwirkungen mit Hilfe unseres Nerven-, Hormon- und Immunsystems, unserer weiteren physischen Fähigkeiten, unserer Sinne und unserer intellektuellen Fähigkeiten im Sinne einer Anpassung »verarbeiten« können. Was nicht »verarbeitet« werden kann, ist mit einer Überforderung gleichzusetzen und erzeugt einen Zustand, der als Stress bezeichnet wird. Umgebungsfaktoren, die Stress erzeugen, werden Stressoren genannt.
Die Fähigkeit des Körpers, trotz aller äußeren Veränderungen das Gleichgewicht seiner Funktionen aufrechtzuerhalten, wird als »Homöostase« bezeichnet. Durch die Regelmechanismen der Homöostase befinden wir uns oft in Zuständen, die man als »relativ gesund« oder »relativ krank« bezeichnen kann.
Beispiel: An einem heißen Sommertag bei hoher Luftfeuchtigkeit kommt es schnell zur übermäßigen Erhitzung des Körpers. Die Mechanismen der Homöostase sorgen dafür, dass die übermäßige Wärme durch Schwitzen bzw. durch Verdunstungskälte abgegeben wird. Wenn die Wärme ein gewisses Maß nicht übersteigt, sorgen diese Mechanismen der Homöostase für einen Erhalt der Körperfunktionen und des Wohlbefindens. Wenn die Wärme dem noch zu kompensierenden Grenzwert näher kommt, wird sich die betreffende Person den Stressoren Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit immer weniger anpassen können, was Störungen des Wohlbefindens und ihrer Körperfunktionen zur Folge haben wird: Ihr ist zu heiß, sie fühlt sich unwohl und ist nur noch bedingt leistungsfähig. Wenn die Wärme dauerhaft diesen Grenzwert übersteigt, dekompensiert die Homöostase mit der Gefahr, dass die betreffende Person erkrankt (z. B. Hitzschlag).
1.2 Prävention
Das Bemühen, unerwünschte Zustände oder Sachverhalte (wie Katastrophen, Verarmung, Erkrankungen) zu vermeiden oder zumindest abzumildern, wird Prävention genannt, wobei drei Stufen unterschieden werden:
• Primärprävention (Krankheitsvorbeugung),
• Sekundärprävention (Krankheitsfrüherkennung),
• Tertiärprävention (Verhütung einer Krankheitsverschlechterung).
1.2.1 Primärprävention
Als »Primärprävention« bezeichnet man Maßnahmen, die eine Schädigungsgefahr abwenden sollen. Einerseits soll das Individuum vor krankheitsauslösenden Faktoren (Risikofaktoren bzw. Stressoren) geschützt (Expositionsprophylaxe) und andererseits gegenüber krankheitsauslösenden Faktoren gestärkt werden (Dispositionsprophylaxe).
Beispiel: Risikofaktoren für den Bluthochdruck sind u. a. Übergewicht, Stress oder Genussgifte. Primärprävention wäre z. B. eine Aufklärung über die Risikofaktoren, Vermeidung von Stress, Meidung von Genussgiften, Stärkung und Gegenlenkung, z. B. durch Sport oder sinnvolle Freizeitgestaltung.
1.2.2 Sekundärprävention
Die Sekundärprävention will vorhandene Risikofaktoren erfassen, beherrschen und beseitigen, um so das Eintreten einer Schädigung zu verhindern.
Beispiel: Zu den sekundärpräventiven Maßnahmen bei Bluthochdruck zählen die Gewichtsreduktion, Stressreduktion (z. B. autogenes Training) oder Entwöhnung von Genussgiften.
1.2.3 Tertiärprävention
Maßnahmen der Tertiärprävention werden ergriffen, wenn eine Schädigung bereits eingetreten ist und ein Fortschreiten, eine Verstärkung oder der Eintritt unerwünschter Folgen vermieden werden soll.
Beispiel: Komplikationen des Bluthochdrucks wären u. a. Arterienverkalkung, Durchblutungsstörungen, Gefahr des Herzinfarktes oder des Schlaganfalls. Verhindern ließe sich dies durch tertiärpräventive Maßnahmen wie die medikamentöse Behandlung des Bluthochdrucks, eine angepasste Ernährung (kalorien- und natriumarm) oder evtl. Veränderungen im Arbeitsleben (z. B. Umschulung oder Frührente)
1.3 Hygiene
Das Wort »Hygiene« leitet sich ab von »Hygiea« (griechische Göttin der Gesundheit). Hygiene lässt sich mit Begriffen wie »Gesunderhaltung« oder »Gesundheitsvorsorge« oder »medizinischer Primärprävention« übersetzen.
1.3.1 Expositions- und Dispositionsprophylaxe
Die Hygiene kennt zwei grundsätzliche Präventionsprinzipien:
• Expositionsprophylaxe, d. h. die unbelebte, belebte und soziale Umwelt so zu beeinflussen, dass aus ihr eine möglichst geringe Gefahr für den Menschen hervorgeht und er sich ihr anpassen kann.
Beispiel: Um einer Grippe-Ansteckung durch Atemtröpfchen vorzubeugen, ist es sinnvoll, einen Mundschutz zu tragen und erkrankte Personen von gesunden zu trennen.
• Dispositionsprophylaxe, d. h. den Menschen so zu fördern und zu beeinflussen, dass er sich den Anforderungen seiner Umwelt anpassen kann.
Beispiel: Um einer Grippe-Erkrankung vorzubeugen ist es sinnvoll, sich gegen die mutmaßlichen Infektionserreger impfen zu lassen.
1.3.2 Hygienezweige
Weil Gesundheit sehr unterschiedliche Aspekte und Dimensionen hat (siehe Kap. 1.1), ergeben sich auch unterschiedliche Hygienezweige:
• Individualhygiene = Förderung der Eigenverantwortlichkeit des Menschen zur Wahrnehmung seiner eigenen Gesundheitsvorsorge.
• Umwelthygiene, soweit hier die belebte oder unbelebte Umwelt gemeint ist.
• Sozialhygiene, wenn es sich um die menschliche Gesellschaft handelt (= soziale Umwelt).
• Psychohygiene, wenn es darum geht, psychischen und seelischen Störungen vorzubeugen.
1.3.2.1 Individualhygiene
Die Individualhygiene soll den einzelnen Menschen befähigen, die Sorge um die eigene Gesundheit selbst übernehmen zu können, um seine Leistungsfähigkeit zu steigern und zu erhalten. Dies betrifft Aspekte wie Körperpflege, Ernährung, Kleidung, Freizeitgestaltung und allgemeine Gesundheitsvorsorge.
Beispiele für Wirkungsfelder: Sportunterricht, Ernährungsberatung, Gesundheitserziehung und Mütterberatung.
1.3.2.2 Umwelthygiene
Die Umwelthygiene will Risikofaktoren aus der unbelebten und belebten Umwelt vermeiden, mindern oder ausschalten. Als Umwelthygiene bezeichnet man vor allem den Umweltschutz in Form des Luft-, Wasser oder Bodenschutzes.
Beispiele für Wirkungsfelder: Erfassung der Ozonwerte, Abgasuntersuchung, Pollenwarndienst, Abfallbeseitigungsgesetz, Recycling
1.3.2.3 Sozialhygiene
Die Sozialhygiene wendet sich gegen Schädigungen und Gefahren, die aus der sozialen Gemeinschaft entstehen können. Sie will bewirken, dass die soziale Gemeinschaft in Frieden und Wohlstand miteinander leben kann.
Ihre Aufgaben liegen
• in der Erforschung der Krankheits- und Todesursachen, durch die Epidemiologie;
• in der Regelung des menschlichen Miteinanders, durch entsprechende Gesetzgebung;
• im Schutz vor Krankheit, Arbeitslosigkeit oder -unfähigkeit oder Unfällen durch die Sozialversicherungen;
• in der Gewährleistung von Bildung, Gesundheit und Sicherheit;
• im Erhalt und der menschengerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes.
Beispiele für Wirkungsfelder: Verkehrsplanung, Jugendschutz, Schulbildung, Suchtberatung, Rentenversicherung und Schutz vor Berufskrankheiten.
1.3.2.4 Psychohygiene
Die Psychohygiene ist bemüht, schädigende Einflüsse für die Psyche des Individuums fernzuhalten; bzw. das Individuum befähigen mit diesen Einflüssen angemessen umgehen zu können. Psychohygiene wirkt erfassend, aufklärend und beratend.
Beispiele: Lenkung der Medien, Kranken- und Sterbebegleitung, Hilfe zur Selbstverwirklichung.
1.3.3 Krankenhaushygiene
1.3.3.1 Definition
Mit »Krankenhaushygiene« werden alle prophylaktischen Maßnahmen bezeichnet, die der Verhinderung von im Krankenhaus und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens erworbenen (nosokomialen, von griechisch Nosokomeion = Krankenhaus) Krankheiten dienen. In einem Definitionsvorschlag des Robert-Koch-Institutes (RKI) von 1999 wird dies weiter präzisiert: »Unter Krankenhaushygiene soll die Wissenschaft und Lehre von der Verhütung, Erkennung und Kontrolle von Gesundheitsrisiken, insbesondere von Infektionen von Patienten und medizinischen Personal, im Krankenhaus und sonstigen medizinischen Einrichtungen verstanden werden, wobei systematische Risikoanalyse und Entwicklung von Präventionsund Kontrollstrategien wesentliche Arbeitsfelder sind. Die Krankenhaushygiene erarbeitet Kriterien, wie Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens geplant, gebaut, mit den Mitarbeitern in effizienter Weise organisiert, betrieben und unterhalten werden können, um sicherzustellen, dass
• keine Gesundheitsschäden, insbesondere Infektionen, auftreten (Prävention);
• auftretende Gesundheitsschäden und Infektionen so zeitnah wie möglich erkannt werden;
• diese so rasch wie möglich unter Kontrolle gebracht werden, sodass ihre Weiterverbreitung verhindert wird.«
1.3.3.2 Aufgaben- und Anwendungsgebiete
Gemäß der RKI-Definition sind die Aufgabengebiete und Wirkungsfelder der Krankenhaushygiene vielfältig:
• Auf Patienten bezogen kann es sich u. a. um die Erkennung, Verhütung und Kontrolle von Infektionen, allergischen Reaktionen, Immobilitätsfolgen (wie z. B. Kontrakturen), psychischen Schädigungen (z. B. psychischer Hospitalismus) oder Strahlenschäden (vor allem Röntgenstrahlen) handeln, die mit dem Aufenthalt in Einrichtungen des Gesundheitswesen bzw. mit der Durchführung medizinisch-pflegerischer Maßnahmen im Zusammenhang stehen.
• In Hinblick auf das Personal stehen Gefahren und Gesundheitsrisiken in Form von Verletzungen (z. B. Kanülenstichverletzungen), Infektionen, Rückenschäden, Allergien (z. B. Desinfektionsmittel) oder Strahlenschäden im Vordergrund.
Personen, die sich beruflich mit Krankenhaushygiene befassen, wie z. B. Krankenhaushygieniker oder Hygienefachkräfte, deuten den Begriff »Krankenhaushygiene« jedoch nahezu ausschließlich unter mikrobiologischen bzw. infektiologischen Aspekten. Daher ist es allgemein üblich, die Krankenhaushygiene mit der Erkennung, Verhütung und Kontrolle von Krankenhausinfektionen (nosokomialen Infektionen) gleichzusetzen. Die anderen Teilgebiete werden gewöhnlich separat betrachtet (z. B. als Unfallverhütung, Strahlenschutz, pflegerische Prophylaxen usw.).
Es ist hervorzuheben, dass sich der Begriff »Krankenhaushygiene« nicht nur auf Krankenhäuser, sondern auch auf andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, wie z. B. Alten- und Pflegeheime, Reha-Einrichtungen, Tageskliniken oder Arztpraxen bezieht.
1.3.3.3 Aspekt der Prävention
In Hinblick auf nosokomiale Infektionen gibt es für den Patienten (von allgemeinen gesundheitsfördernden Maßnahmen abgesehen) wenig Möglichkeiten zur Dispositionsprophylaxe, sodass es sich bei krankenhaushygienischen Maßnahmen zum Schutz des Patienten fast ausschließlich um Expositionsprophylaxe handelt, wie z. B.:
• hygienegerechte Gestaltung der baulichen Umgebung und der Einrichtung,
• hygienisch zuverlässige Aufbereitung von Medizinprodukten, wie chirurgischem Instrumentar und medizinisch-technischer Geräte,
• präventionsorientierte Regelung von Betriebs- und Arbeitsabläufe oder
• Schutz vor infizierten Mitpatienten und anderen Keimpotenzialen.
Das Personal kann sich dagegen durch Impfungen (z. B. gegen Hepatitis B), Aufklärung (z. B. vor Kanülenstichverletzungen) oder Einübung unfallvermeidender Betriebsabläufe (z. B. im Zuge der Instrumentenaufbereitung) schützen. Hinzu kommen wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz vor Expositionen (z. B. durch Schutzkleidung), sodass das Pflegepersonal allgemein ein geringeres Infektionsrisiko, als der Patient trägt.
1.3.3.4 Aspekt der Surveillance
Unter Surveillance im Sinne der Krankenhaushygiene versteht man die fortlaufende Kontrolle, Beobachtung und Datenauswertung einer bestimmten Patientengruppe unter bestimmten Fragestellungen (z. B. Pneumoniehäufigkeit im Hinblick auf die Beatmungstage der Patienten einer Intensivstation). Das Ziel der Surveillance besteht darin, Qualitätsparameter im Sinne der Krankenhaushygiene zu schaffen, also Maßstäbe zu setzen, an denen Infizierungstendenzen abgelesen werden können.
1.3.3.5 Aspekt der Kontrolle
Krankenhausinfektionen sind zu einem Großteil unvermeidbar und gehören damit zum Alltagsgeschehen in Akutkrankenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich im Krankenhaus epidemische Geschehen, sog. »Infektionsausbrüche« entwickeln können. Über Kontrollmaßnahmen versucht man, dieser Gefahr entgegenzutreten. Hierzu zählen:
• routinemäßige mikrobiologische Untersuchungen von Geräten und Einrichtungen,
• indizierte mikrobiologische Untersuchungen von Patienten und evtl. ihrer Umgebung,
• Isolierungsmaßnahmen im Infektionsfall und
• das wertende Beobachten (= Auditieren) von Arbeitsabläufen.
1.3.3.6 Sichtweisen der Krankenhaushygiene
Vor allem in Deutschland basierten Hygienemaßnahmen bis in die 1990er-Jahre fast ausnahmslos auf Empfehlungen von Arbeitskreisen oder Experten in Ableitung von traditionellen Vorstellungen, logischen Rückschlüssen, mikrobiologischen Nachweisen oder Qualitätsansprüchen. Thematisch beschäftigte man sich vorwiegend mit der baulichen Gestaltung bestimmter Krankenhausbereiche, mit Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen sowie mit betriebsorganisatorischen Fragen. Diese Arbeits- und Sichtweise wird als traditionelle Krankenhaushygiene bezeichnet.
Über die Effizienz der traditionellen Krankenhaushygiene lassen sich nur indirekte Aussagen treffen (z. B. anhand der Verringerung von Keimpotenzialen). Ob sich durch die Einhaltung der empfohlenen Hygienemaßnahmen der erhoffte Effekt erzielen lässt (z. B. ob sich Infektionsquoten dadurch wirklich senken lassen) bleibt jedoch weit gehend offen.
In den 1980er-Jahren begann man in den USA auf Initiative des Centers for Disease Control (CDC) mit Hilfe von z. T. groß angelegten kontrollierten Studien zu erforschen, welche Hygienemaßnahmen und Arbeitsabläufe die Gefahr von nosokomialen Infektionen vermindern. Über eine Kategorieneinteilung wurde klargestellt, welche Hygieneempfehlungen sich belegen und beweisen (evident) lassen und auf welche das weniger oder gar nicht zutrifft. Die in Deutschland für die Krankenhaushygiene maßgeblichen KRINKO-Empfehlungen (siehe Kap. 7.2.7 und Anhang D, Pos. 1) wurden einer solchen Kategorieneinteilung unterzogen.
Die Arbeits- und Sichtweise, Hygieneempfehlungen stets mit einem Effizienznachweis zu verbinden, nennt sich evidenzbasierte Krankenhaushygiene. Eng verbunden mit der evidenzbasierten Krankenhaushygiene ist die Durchführung einer fortlaufenden Infektionserfassung und -auswertung (Surveillance, siehe Kap. 8.4) als Grundlage und zur Ausrichtung effizienter Hygienemaßnahmen.
1.4 Geschichtliche Entwicklung der Krankenhaushygiene
1.4.1 Erste Ansätze
Die Gewährleistung einer ausreichenden Ernährung, die Sorge um die Erhaltung der Gesundheit, der Umgang mit Kranken, die Versorgung von Kriegsverletzten oder die Beseitigung von Leichen waren seit jeher gesellschaftliche Probleme, die es zu bewältigen galt. Um den Fortbestand der Gemeinschaft und die Gesundheit des Einzelnen zu sichern, wurden Gesetze und Regelungen geschaffen sowie infrastrukturelle Maßnahmen in Angriff genommen:
• Man kannte schon in der Antike Zusammenhänge zwischen Verwesung und Krankheitsentstehung und wusste um die Ansteckungsfähigkeit infizierter Personen. Die »12 Tafeln Roms« verboten z. B. die Bestattung innerhalb der Stadt, die Bibel berichtet über die Isolation Leprakranker. Die antiken Städte des Mittelmeerraumes besaßen bereits eine hoch entwickelte Wasserversorgung, durch die fäkal-orale Kreisläufe unterbunden werden sollten.
• Die im Mittelalter grassierenden Seuchen (Pest, Pocken, Lepra) erforderten in Verbindung mit einer immer dichteren Bevölkerung neue Regeln für das Zusammenleben. Neben der Einführung von Hafensperren, Quarantäne oder Anzeigepflicht für ansteckende Erkrankungen entstanden in dieser Zeit in Europa Leprosorien (Siedlungen, in denen Leprakranke isoliert von der Außenwelt lebten) und Hospitäler bzw. Lazarette, die als Vorläufer heutiger Krankenhäuser betrachtet werden können (ohne mit ihnen direkt vergleichbar zu sein).
Bis ins 18. Jahrhundert hinein glaubte man jedoch, dass Infektionen durch schlechte Gerüche (Miasmen) und ansteckende Substanzen (Kontagien) übertragen werden. Wundeiterungen und Fieber hielt man für einen normalen Abschnitt des Heilungsverlaufes. Die einzig wirksame Methode zur Infektionsverhütung war die Isolierung.
Ein Krankenhausbetrieb im heutigen Sinne war bis kurz vor 1900 kaum möglich. Hierzu fehlten wesentliche Errungenschaften, wie das Wissen um die Übertragung und Verhütung von Infektionskrankheiten, die Erfindung der Narkose oder die Etablierung von Sozialversicherungen. Die Diagnostik, Therapie und Pflege von Kranken erfolgte daher – wenn irgend möglich – im eigenen Heim.
1.4.2 Entdeckung der Asepsis und Antisepsis
Die moderne Krankenhaushygiene gewann ihren Ursprung aus logischen Schlussfolgerungen bestimmter Beobachtungen; zunächst unabhängig von mikrobiologischen Erkenntnissen.
1.4.2.1 Entdeckung der Asepsis
Die wichtigste Beobachtung machte in dieser Hinsicht Ignaz Philipp Semmelweis um 1847. Er stellte fest, dass Gebärende, die von Ärzten untersucht wurden, wesentlich häufiger an Kindbettfieber (lebensbedrohliche Infektion der Gebärmutter) erkrankten, als jene, die von Hebammen untersucht wurden. Er schlussfolgerte richtig, dass der wesentlichste Unterschied darin bestand, dass die Ärzte im Gegensatz zu den Hebammen sezierten und nahm an, dass die Ärzte Kontagien (»Leichengift«) auf die Gebärenden übertragen konnten.
Zur Bekämpfung führte Semmelweis Waschungen durch Chlorwasser ein (desinfizierende Substanz), die schnell zur Senkung der Infektionsrate beitrugen. Semmelweis’ Methode basierte also auf der Erkenntnis, dass eine Infektion vermieden wird, wenn die Übertragung von infektionsauslösenden Substanzen bzw. Mikroorganismen verhindert wird.
Dieses Prinzip, eine Infektionsübertragung durch Hygienemaßnahmen zu verhindern, wird als Asepsis bezeichnet. Zu den aseptischen Maßnahmen gehört neben der Händedesinfektion u. a. der Gebrauch steriler Instrumente und Abdeckmaterialien bei Operationen oder die Nutzung von Schleusensystemen zur Trennung reiner und unreiner Krankenhausbereiche.
1.4.2.2 Entdeckung der Antisepsis
Joseph Lister begann um 1865 Operationen unter einem Karbolnebel (Karbol ist ein phenolhaltiges Desinfektionsmittel) durchzuführen. Lister ging davon aus, dass Infektionserreger in der Operationswunde unvermeidbar vorhanden sind und daher bekämpft werden müssen.
Das Prinzip, vorhandene Infektionserreger zur Vermeidung bzw. zur Bekämpfung einer Infektion abzutöten bzw. zu reduzieren, nennt man Antisepsis. Zu den antiseptischen Maßnahmen zählen u. a. die Hautdesinfektion vor invasiven Eingriffen, wie Operationen oder Punktionen, die desinfizierende Behandlung infizierter Wunden oder desinfizierende Waschungen zur Beseitigung multiresistenter Krankheitserreger (z. B. MRSA, siehe Kap. 15.3.3.1).
1.4.3 Entdeckung der Antibiotika
Asepsis und Antisepsis waren lange Zeit die einzig wirksamen Waffen gegen Krankenhausinfektionen. Schon um 1900 waren aseptische Operationen unter Verwendung steriler Instrumente allgemein etabliert. Infizierte sich jedoch ein Patient trotz dieser Maßnahmen, waren die therapeutischen Möglichkeiten sehr begrenzt. Dies änderte sich, als Alexander Flemming 1928 das Penizillin und Gerhard Domagk 1935 das Sulfonamid entdeckte. Mit diesen Substanzen war es erstmals war es möglich, Patienten zu behandeln, die an einer bakteriellen Infektion erkrankt waren.
Leider wurden diese als Antibiotika bezeichneten Medikamente in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und teilweise bis heute ohne eine angemessene Indikationsstellung angewandt. Die Folge war eine ausgeprägte Entwicklung sekundärer Resistenzen (siehe Kap. 2.2.2 und 2.2.3) bei verschiedenen Krankheitserregern, wie z. B. Staphylokokken oder Streptokokken, mit dem Ergebnis, dass die einstmals sehr wirksamen Antibiotika zunehmend versagten. Diese Entwicklung wird als infektiöser Hospitalismus bezeichnet. Die Antwort bestand (und besteht) darin, wirksamere Medikamente zu entwickeln, die aber erfahrungsgemäß wiederum durch Resistenzen an Wirksamkeit verlieren.
1.5 Qualität
1.5.1 Definition
Die Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung (DGQ) definiert Qualität als „die Gesamtheit der Merkmale, die ein Produkt oder eine Dienstleistung zur Erfüllung vorgegebener Forderungen geeignet macht«.
Die DIN EN ISO 9000 stellt mit der Definition »Qualität ist das Verhältnis zwischen realisierter und geforderter Beschaffenheit« einen Zusammenhang zwischen Erwartung und Realität her.
1.5.2 Qualitätsforderungen
Die in der Industrie und der freien Wirtschaft etablierten Maßnahmen zur Schaffung und Sicherung von Qualität werden seit dem Gesundheitsreformgesetz von 1988 auch von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens in den maßgeblichen Regelwerken gefordert.
• Nach SGB V haben Krankenkassen und Leistungserbringer eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. § 137 befasst sich explizit mit der Qualitätssicherung bei zugelassenen Krankenhäusern und fordert u. a. einen zweijährig vorzulegenden Qualitätsbericht.
• Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) verpflichtet Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen zur Ergreifung infektionspräventiver Maßnahmen und zur Durchführung einer Surveillance (siehe Kap. 8.4). Die damit verbundene fortlaufende Erfassung und Auswertung nosokomialer Infektionen ermöglicht eine Aussage zur Hygienequalität eines Krankenhauses.
• Auch das Medizinproduktegesetz (MPG) und die damit verbundene Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) ist darauf ausgerichtet, hinsichtlich der Betriebssicherheit und der Bedienung medizinischtechnischer Geräte und Medizinprodukte Qualität zu schaffen und zu sichern.
1.5.3 Qualitätsmerkmale
Als Qualitätsmerkmale werden Anforderungen an die Struktur, den Prozess und das Ergebnis einer Leistung bezeichnet:
• Als Strukturqualität bezeichnet man die Rahmenbedingungen einer Leistung, d. h. die organisatorischen, personellen, informativen, baulich-funktionellen und bildungsbezogenen Merkmale.
• Die Prozessqualität bezieht sich auf den Ablauf einer Leistung, der z. B. in Form von Standards, aber auch im Hygieneplan oder in Reinigungs- und Desinfektionsplänen festgelegt sein kann.
• Die Ergebnisqualität misst den Zustand nach Erbringung einer Leistung, also am Pflege- oder Behandlungsergebnis bzw. an der Zufriedenheit der Patienten.
1.5.4 Qualitätsmanagement
Die Erbringung einer stetigen bzw. sich fortwährend steigernden Qualität ist ein prozesshaftes Geschehen (so wie der Pflegeprozess), der ein entsprechendes Management verlangt. Als Hilfestellung für solche Prozesse gibt es normative Regelungen, wobei die EN ISO 9000 (bzw. 9001, 9004) am bekanntesten ist. Vereinfacht gesagt geht es beim Qualitätsmanagement nach EN ISO 9000 darum, die Strukturqualität und die Regeln zur Erbringung der Prozessqualität zu erfassen, zu bewerten, nach entsprechender Korrektur im Hinblick auf Vollständigkeit und Korrektheit zu überprüfen und anschließend in regelmäßigen Abständen zu überwachen.
So wird sichergestellt, dass die jeweilige Einrichtung für ihre Betriebsabläufe korrekte (d. h. den geltenden Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften entsprechende) Regelungen hinsichtlich der Zielvorgaben, Verantwortlichkeiten, Dokumentationen, Korrekturmaßnahmen, Fehlervermeidung etc. erarbeitet hat und diese auch einhält. Durch systematische Beobachtung und Einsichtnahme in die Dokumentation (Zertifizierungsaudit) wird durch ein unabhängiges Institut (z. B. TÜV) überprüft, ob dies auch tatsächlich zutrifft. Über ein erfolgreiches Audit wird dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung ein Zertifikat ausgestellt; die Einrichtung gilt dann als »zertifiziert«.
1.5.5 Qualität und Krankenhaushygiene
Durch angewandte Hygiene sollen unerwünschte Geschehnisse so selten wie möglich vorkommen. Eine gute Hygiene ist somit Qualitätsbestandteil jeder medizinisch-pflegerischen Leistung und muss durch zahlreiche Überprüfungsmaßnahmen fortlaufend sichergestellt werden. Dies erfolgt in Form von:
• Begehungen und Audits durch krankenhausinterne und -externe Personen und Institutionen,
• festgelegte Messungen und Checklisten, z. B. im Rahmen der Lebensmittelverarbeitung oder der lnstrumentenaufbereitung,
• regelmäßige mikrobiologische Untersuchungen hygienerelevanter Einrichtungen, Geräte und Instrumente, wie z B. Desinfektionsautomaten, Sterilisatoren, Dialysegeräte, Endoskope usw. durch das Hygienefachpersonal und
• fortwährende Erfassung und Auswertung von Infektionsfällen (Surveillance).
Von Qualität im Sinne der Krankenhaushygiene kann gesprochen werden, wenn die am Patienten erbrachten Leistungen nachweislich so durchgeführt werden, dass alle dem heutigen Wissensstand entsprechenden Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen wurden, um nosokomial bedingte Erkrankungen zu vermeiden. Der Erfolg der Krankenhaushygiene misst sich in erster Linie daran, wie sich das Vorkommen nosokomialer Schädigungen (speziell Infektionen) vor Ort zu den Referenzdaten verhält (siehe Anhang D, Pos. 2). Die Erbringung effizienter Hygienemaßnahmen muss inner- und außerhalb des Krankenhauses nachvollziehbar sein. Daher müssen Arbeitsabläufe in Standards dokumentiert und überprüfbar (validierbar) erbracht werden.
1. Worin unterscheiden sich Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention?
2. Welches Ziel hat die Expositions- und welches die Dispositionsprophylaxe?
3. Was bedeutet der Begriff »Hygiene« und welche Hygienezweige werden allgemein unterschieden?
4. Wie wird der Begriff »Krankenhaushygiene« definiert und mit welchen Aspekten ist er verbunden?
5. Welchen Gefahren und Gesundheitsrisiken sind Patienten und Personal im Krankenhaus ausgesetzt?
6. Wie erklärte man sich bis ins 18. Jahrhundert hinein die Entstehung von Infektionen?
7. Welche Entdeckung machte Ignaz Philipp Semmelweis und welche Joseph Lister?
8. Welches Prinzip und welche Hygienemaßnahmen sind mit dem Begriff »Asepsis« und welche mit dem Begriff »Antisepsis” verbunden?
9. Was bezeichnet man als infektiösen Hospitalismus?
10. In welcher Weise steht der Begriff »Qualität« mit der Krankenhaushygiene in Verbindung?
2 MIKROBIOLOGISCHE GRUNDKENNTNISSE
2.1 Definitionen
Medizinische Mikrobiologie ist die Lehre und Wissenschaft von den Mikroorganismen, die für den Menschen als Krankheitserreger von Bedeutung sind.
Innerhalb der medizinischen Mikrobiologie gibt es Untergruppen wie:
• Bakteriologie = Lehre von den Bakterien
• Virologie = Lehre von den Viren
• Mykologie = Lehre von den Pilzen
Hiervon abzugrenzen ist die Parasitologie, die sich mit Lebewesen befasst, deren Existenz mit der Schädigung des Wirtes einhergeht (z. B. Würmer, Flöhe oder Läuse).
Mikroorganismen sind Kleinstlebewesen in Form von Bakterien, Viren, Pilzen und Protozoen, die teilweise in der Lage sind, Infektionserkrankungen im menschlichen Körper zu erzeugen.
2.2 Bakterien
2.2.1 Aufbau
Bakterien sind einzellige Mikroorganismen, die sich in Größe, Form und Eigenschaften erheblich voneinander unterscheiden. Ihr grundsätzlicher Aufbau besteht aus (Abb. 2.1):
• einer Zellwand, die dem Bakterium eine äußere Stabilität verleiht,
• einer Zytoplasmamembran, die als Pufferzone gegen Druckschwankungen schützt, die Aufnahme von Nahrung und die Abgabe von Ausscheidungen steuert und am Aufbau der Zellwand beteiligt ist sowie
• einem Kernäquivalent, das als Zellkernersatz fungiert.
Einige Bakterien können höchst widerstandsfähige Dauerformen (»Sporen«) bilden.
Darüber hinaus kann ein Bakterium über zusätzliche Anlagen verfügen wie:
• eine Kapsel, die es vor äußeren Einflüssen schützt,
• eine oder mehrere Geißeln, die eine gewisse selbstständige Fortbewegung ermöglichen,
• Fimbrien und Pili, die dem Bakterium ein besseres Anhaftvermögen verleihen und evtl. auch den Austausch ringförmiger Partikel (Plasmide) mit Erbinformation gestatten.
Als wichtiger ergänzender Faktor kommt die Fähigkeit einiger Bakterien hinzu, krankheitsauslösende Gifte (Toxine) oder Eiweiß spaltende Stoffe (Enzyme) bilden zu können. Man unterscheidet Gifte, die vom Bakterium aktiv abgesondert werden (Exotoxine) und Gifte, die erst beim Zerfall des Bakteriums frei werden (Endotoxine).

Abb. 2.1: Allgemeiner Aufbau von Bakterien.
2.2.2 Eigenschaften und Einteilung
• Vermehrung: Bakterien vermehren sich durch Zellteilung, wobei zwei gleiche Kopien entstehen. Varianten sind durch Mutation (Veränderung von Erbgut) oder Transformation (Übertragung von Erbgut) dennoch möglich.
• Umgebungstemperatur: Die für den Menschen bedeutsamen Bakterien bevorzugen Körpertemperatur.
• Nahrungsbedarf: Bakterien brauchen ebenso wie andere Lebewesen gewisse Grundnahrungsmittel, wie Kohlenstoff, Wasser, Vitamine usw., wobei jedoch die Bedürfnisse von Art zu Art stark variieren.
• Färbeverhalten: Um Bakterien unter dem Lichtmikroskop sichtbar zu machen, werden sie eingefärbt. Routinemäßig findet die sog. »Gramfärbung« Anwendung, die eine Einteilung in grampositiv (mit einer einschichtigen dicken Zellwand) und gramnegativ (mit einer mehrschichtigen dünnen Zellwand) erlaubt.
• Form und Anlagerung: Die Form (kugel-, stäbchen- oder schraubenförmig) und das Anlagerungsverhalten (in Haufen, Paaren oder Ketten) geben Anhaltspunkte über die Art des Bakteriums.
• Sauerstoffbedarf: Bakterien, die auf das Vorhandensein von Luftsauerstoff (O2) angewiesen sind, werden als »obligat aerob« bezeichnet. Bakterien, die keinen Luftsauerstoff vertragen, als »obligat anaerob« und Bakterien, die sich beiden Zuständen anpassen können, als »fakultativ aerob« bzw. »anaerob«.
• Wirtsverhältnisse: Ein Bakterium kann auf Grund seiner Bedürfnisse (z. B. Temperatur, Nährstoffe) eine wirtsgebundene oder ungebundene Lebensweise entwickeln. Diesbezüglich unterscheidet man:
– Saprophyten = wirtsungebundene Bakterien, die überall (ubiquitär) in der Natur verbreitet sind.
– Kommensalen = wirtsgebundene Bakterien, die von einem Wirtsstoffwechsel leben, ohne ihn zu schädigen.
– Symbionten = wirtsgebundene Bakterien, die dem Wirt nützlich sind, z. B. indem sie Verdauungsarbeit leisten oder durch ihr Vorhandensein die Ansiedlung von Parasiten verhindern.
– Parasiten = wirtsgebundene Bakterien, die den Makroorganismus schädigen.
• Pathogenität: Die weitaus meisten Bakterien sind für den Menschen ungefährlich und damit apathogen. Wenn eine Bakterienart bei einem ungeimpften Menschen in der Regel eine Infektion hervorruft, gilt sie als »obligat pathogen«. »Fakultativ pathogene« Bakterien verursachen nur unter ganz bestimmten Umständen, speziell bei einer Abwehrschwäche eine Infektion.
• Virulenz: Das Ausmaß einer Pathogenität wird mit dem Begriff »Virulenz« gekennzeichnet, das auf vier Eigenschaften von Bakterien Bezug nimmt:
| – Infektiosität | = Übertragbarkeit |
| – Adhärenz | = Anhaftvermögen |
| – Gewebsaffinität | = Vorliebe für bestimmte Gewebsarten |
| – Toxizität | = Giftigkeit |
• Resistenz: Bakterien können eine »angeborene« (= primäre) und/oder »erworbene« (= sekundäre) Widerstandskraft gegen antibakteriell wirkende Medikamente (= Antibiotika) besitzen bzw. entwickeln. Ein großes Problem sind vor allem die zunehmenden sekundären Resistenzen, die u. a. für Erreger nosokomialer Infektionen typisch sind (siehe Kap. 3.3.3).
2.2.3 Therapie
Bei bakteriellen Infektionen werden bakterienabtötende (bakterizide) oder vermehrungshemmende (bakteriostatische) Arzneimittel verordnet, die als Antibiotika bezeichnet werden. Zu den Antibiotika gehören die Penicilline, Cephalosporine, Tetracycline, Makrolide, Gyrasehemmer und zahlreiche Kombinationen dieser Substanzen.
Jedes Antibiotikum wirkt nur gegen bestimmte Gruppen oder Arten (selektive Wirkung). Wenn ein Mittel nur gegen wenige Bakteriengruppen und -arten einsetzbar ist, spricht man von einem Schmalspektrumantibiotikum – ist es gegen viele einsetzbar, von einem Breitspektrum- oder Breitbandantibiotikum. Auf Grund ihrer primären Resistenz bieten bestimmte Bakterienarten für einige antibiotische Wirkstoffe von vornherein kein Angriffsziel, andererseits versagen einstmals wirksame Arzneimittel, weil die betreffende Bakterienart eine sekundäre Resistenz gebildet hat. Dies hat dazu beigetragen, dass in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ein Sockel stets wiederkehrender, schwer therapierbarer Bakterien im Sinne einer Endemie (ständiges Auftreten einer Erkrankung in einem begrenzten Gebiet) anzutreffen ist. Die Ursachen sind vor allem in der falschen bzw. missbräuchlichen Anwendung der Antibiotika zu suchen:
• mangelnde Empfindlichkeitsprüfung der Erreger (Kultur und Resistenzuntersuchung) im Infektionsfall und im Zuge einer antibiotischen Therapie,
• Unterdosierung antibiotischer Medikamente,
• Anwendung wenig geeigneter Präparate gegen den betreffenden Mikroorganismus,
• zu frühes Beenden einer antibiotischen Therapie und
• Vorkommen antibiotischer Rückstände in Lebensmitteln (Fleisch).
Bei einigen bakteriellen Erkrankungen (z. B. Pneumokokken-Infektionen oder Diphtherie) sind Impfungen möglich.
Hinsichtlich der Desinfizierbarkeit gibt es bei Bakterien erhebliche Unterschiede: Nicht sporenbildende Bakterien oder Bakterien, die sich nicht in Sporenform befinden, lassen sich mit den üblichen Desinfektionsmitteln in der Regel gut abtöten. Als Sporen sind Bakterien dagegen so resistent, dass einige Bakterienarten, z. B. der Gasbranderreger, nicht durch Desinfektionsmittel bekämpft werden können.
Hinweis
Im Anhang A finden Sie Beispiele von Erkrankungen, die durch Bakterien verursacht werden.
2.3 Pilze
Pilze im Sinne der Mikrobiologie sind einzellige Lebewesen (Mikrophyten), die gegenüber Bakterien größer sind, einen differenzierteren Aufbau haben und grundsätzlich unbeweglich sind.
2.3.1 Aufbau und Morphologie
Hinsichtlich des Aufbaus unterscheidet man folgende Anteile:
• Kern, durch eine Zellmembran abgegrenzt, besitzt einen Chromosomensatz;
• Zytoplasma, in dem sich neben Ribosomen auch Zellorganellen zur Energiegewinnung (Mitochondrien) befinden;
• Zellwand, die aus Chitin und Polysacchariden aufgebaut ist.
Pilze können zwei Strukturen aufweisen (morphologische Erscheinungsformen) (Abb. 2.2):
• Hyphe = Grundelement (filamentöser Pilze), das verzweigt und fadenförmig wächst (Strauchform). Ein Geflecht von Hyphen wird als Myzel bezeichnet, die Gesamtheit eines Myzels als Pilzthallus oder Pilzkolonie.
• Hefe = Grundelement der unizellulären Pilze, die blasenförmig (Sprosswachstum) wachsen. Z. T. können Hefen lang gestreckte Blasenzellen erzeugen, die kettenförmig aneinanderhängen und ein Pseudomyzel bilden.
• Einige Pilze können in Abhängigkeit von Umgebungsfaktoren sowohl in der Hyphen-, als auch in der Hefenform vorkommen (Dimorphismus).

Abb. 2.2: Aufbau und Morphologie von Pilzen.
2.3.2 Eigenschaften
• Vermehrung: Die Vermehrung von Mikrophyten und das Wachstum von Pilzkolonien ist von ihrer morphologischen Struktur abhängig:
– Hyphen wachsen in die Länge. Parallel bilden sich mehrere Zellkerne, die mit dem anwachsenden Zellplasma mitwandern. Durch Querwandbildung entstehen neue Hyphen.
– Hefen bilden Ausstülpungen, die mit Zytoplasma gefüllt werden. Parallel bilden sich mehrere Zellkerne, die in die Ausstülpungen einwandern. Bei einer gewissen Größe bildet die »Tochterblase« eine Abschnürung zur Mutterzelle (ohne Querwand).
• Verbreitung: Viele Pilze können sich mit Hilfe von Reproduktionsorganen über große Entfernungen vermehren. Bei diesen Verbreitungsformen werden Fortpflanzungspartikel (»Sporen«) gebildet (nicht zu verwechseln mit den Dauerformen von Bakterien, die ebenfalls Sporen genannt werden).
• Umgebungstemperatur: Mikrophyten bevorzugen allgemein einen Temperaturbereich zwischen 30 und 37 °C.
• Nahrungs- und Sauerstoffbedarf: Alle Pilze benötigen Kohlenstoff, den sie meist aus totem organischem Material gewinnen. Es gibt es aerobe (sauerstoffabhängige) und anaerobe (sauerstoffunabhängige) Lebensformen.
• Pathogenität: Es gibt einen großen Artenreichtum an Mikrophyten, von denen aber nur sehr wenige humanpathogen sind, indem sie z. B. Allergien auslösen oder Toxine bilden. Die Infektabwehr des gesunden Menschen erweist sich als sehr effektiv gegenüber Mikrophyten, sodass meist begünstigende Faktoren vorliegen müssen, ehe es zu einer Pilzinfektion kommt:
– abwehrschädigende (immunsupprimierende) Erkrankungen, wie AIDS oder Leukämie,
– immunsupprimierende Therapiemaßnahmen, wie Zytostase, Strahlentherapie, Transplantation,
– vorgeschädigte, wunde Haut,
– unphysiologische Kleidung, wie Turnschuhe oder Kunststoffgewebe.
2.3.3 Therapie
Die medikamentöse Therapie lokaler (d. h. auf bestimmte Körperzone begrenzte) Pilzinfektionen ist mit Ausnahme der Behandlung pilzbefallener Nägel unproblematisch. Substanzen wie Amphotericin B, Nystatin oder Clotrimazol können als Salben, Cremes oder Lösungen relativ nebenwirkungsfrei gegeben werden.
Problematisch ist dagegen die Therapie systemischer (d. h. den Gesamtorganismus betreffende) Pilzinfektionen. Medikamente wie Amphotericin B, Flucytosin, Imidazole oder Griseofulvin können bei oraler oder intravenöser Gabe zu erheblichen Nebenwirkungen führen. Z. T. kann es zu sekundären Resistenzen kommen.
Impfungen gegen Pilzerkrankungen gibt es nicht.
Eine gute Desinfizierbarkeit ist bei allen Mikrophyten gegeben.
Hinweis
Im Anhang A finden Sie Beispiele von Erkrankungen, die durch Mikrophyten verursacht werden.
2.4 Protozoen
Protozoen sind einzellige, relativ große, hoch entwickelte Einzeller, deren humanpathogene Vertreter den Parasiten zugerechnet werden. Sie sind meist mit einer Vielzahl von Organellen ausgestattet, die zur Energiegewinnung, zur Fortbewegung oder zur Herstellung von Enzymen und Toxinen dienen.
Die Vermehrung erfolgt meist ungeschlechtlich durch Zwei- oder Vielfachteilung. Humanpathogene Protozoen durchlaufen häufig komplizierte Entwicklungszyklen, teilweise mit wechselnden Wirtsorganismen. Die Lebensgewohnheiten und Übertragungsformen von Protozoen sind sehr individuell.
Einige Protozoen sind in der Lage Dauerformen, sog. »Zysten« zu bilden, die gegen Umwelteinflüsse besonders widerstandsfähig sind und die bei oraler Aufnahme in einen Wirtsorganismus zur Infektion führen können.
Hinweis
Im Anhang A finden Sie Beispiele von Erkrankungen, die durch Protozoen verursacht werden.
2.5 Viren
2.5.1 Aufbau
Viren sind eigenständige, infektiöse Gebilde, die sich in ihrem Aufbau und ihren Eigenschaften grundlegend von anderen Mikroorganismen unterscheiden.
Viren bestehen aus zwei, einige aus drei Komponenten (Abb. 2.3):
• der Nukleinsäure (Erbsubstanz = Genom), die eigentliche infektiöse Substanz, die als DNA oder RNA vorliegen kann,
• dem aus Proteinen bestehenden Kapsid, das aus Einzelbausteinen (Kapsomeren) aufgebaut ist, unterschiedliche Formen haben kann und die Nukleinsäure umschließt und schützt,
• einer Hülle (Envelope), die die Kapsel umgibt und ihr ein leichteres Anhaften an die Wirtszelle erlaubt (nur bei einigen Viren vorhanden).
2.5.2 Vermehrung und Eigenschaften
Viren benötigen für ihre Vermehrung zwingend eine Wirtszelle. Eine typische Virusvermehrung (Virusreplikation) vollzieht sich in folgenden Schritten (Abb. 2.4):
• Adsorption: Ein Virus trifft mit einer Zelle zusammen, die über Oberflächenstrukturen Rezeptoren) verfügt, an das das Kapsid oder die Hülle des Virus anhaften kann.
• Penetration: Das Virus wird in die Zelle aufgenommen. Bei umhüllten Viren »verschmilzt« dabei die Hülle mit der Zellwand.
• Uncoating: Die Einheit aus Kapsid und Nukleinsäure (Nukleokapsid) löst sich im Innern unter Einwirkung von Enzymen der Wirtszelle auf.
• Replikation der Nukleinsäure: Die so freigewordene Nukleinsäure wird anstatt der zelleigenen Erbinformation bzw. in Verbindung mit zelleigener Erbinformation abgelesen (Translation). Die Kodierung der fremden Nukleinsäure bewirkt, dass die Wirtszelle ihre Eigenversorgung aufgibt, stattdessen Virus-Kapsomere produziert und unter Beteiligung viraler und zellulärer Enzyme auch die Nukleinsäure des Virus nachbildet.
• Zusammenbau (oder Reifung): Die Kapsomere verbinden sich. Bestandteile der Nukleinsäure lagern sich den Kapsomeren an. Der Kapsomerverbund formt sich zum Kapsid und schließt die Nukleinsäure ein.
• Freisetzung: Die fertigen Viren werden von der Zelle ausgestoßen oder es bilden sich so lange neue Viren, bis die Wirtszelle platzt. Teilweise nehmen Viren bei der Freisetzung Zellwandpartikel der Wirtszelle mit, die für das Virus eine Hülle bilden (Knospung), sodass ein umhülltes Virus entsteht.

Abb. 2.4: Schematischer Ablauf einer Virusvermehrung (Beispiel)
Da diese Replikationsform den Tod der Wirtszelle zur Folge hat, wird von einer »zytoziden Virusreplikation« gesprochen. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, dass die Virusvermehrung nicht mit dem Absterben der Wirtszelle einhergeht, bzw. dass ein Virusgenom zwar in der Wirtszelle vorhanden ist, sich aber (vorerst) nicht vermehrt. Auch können Schwächen des Immunsystems bzw. die Vermehrungsstrategien der Viren dazu führen, dass Viren im Körper verbleiben (persistieren) und nicht restlos bekämpft werden können (z. B. Herpes).
Ähnlich wie bei Bakterien gibt es auch bei Viren Möglichkeiten zur genetischen Variabilität:
• Schon kleine Abweichungen bei der Replikation können als Mutation neue Virus-Eigenschaften bewirken.
• Wenn in ein und derselben Wirtszelle zwei oder mehr unterschiedliche Viren vermehrt werden, kann genetisches Material zwischen den Stämmen neu verteilt werden. Auch ein Austausch mit genetischem Material der Wirtszelle ist möglich.
2.5.3 Therapie
Die medikamentöse Bekämpfung von Viren ist schwierig, weil Viren keinen Stoffwechsel besitzen und eine Schädigung viraler Strukturen auch die Wirtszellen in Mitleidenschaft ziehen kann. Die Wirkung virenwirksamer Medikamente (Virustatika) besteht in der Hemmung der DNA- bzw. RNASynthese. Bekannte Virustatika sind
• Acyclovir (z. B. Zovirax® gegen Herpes-simplex, Varizellen/Zoster-Viren)
• Ganciclovir (z. B. Cymevene® gegen Zytomegalieviren)
• Zidovudin (z. B. Retrovir® gegen HIV)
• Vidarabin und Ribavirin (z. B. Virazol® gegen Influenza, Parainfluenza, HIV)
• Amantadin (Infex® und Oseltamivir, Tamiflu® gegen Influenza)
• Foscarnet (Foscavir® gegen Retroviren (HIV))
Weil bei den meisten Virusinfektionen eine medikamentöse Therapie nicht oder nur bedingt möglich ist, kommt der Impfung eine besonders große Bedeutung zu.
Hinweis
Im Anhang A finden Sie Beispiele von Erkrankungen, die durch Viren verursacht werden.
2.6 Viroide, Prionen und Bakteriophagen
2.6.1 Viroide
Viroide sind infektiöse, zirkulär geschlossene RNA-Stränge; sozusagen »reduzierte Viren«. Die Vermehrungsweise von Viroiden ist bislang unbekannt. Der einzige wichtige humanmedizinische Erreger, der zumindest strukturell mit Viroiden verwandt ist, ist das Hepatitis D-Virus.
2.6.2 Prionen
Prionen sind keine Lebewesen, sondern infektiös wirkende Proteine, die in bestimmten Nervenzellen fortwährend gebildet und mit Hilfe von Enzymen wieder abgebaut werden. Der pathogene Faktor besteht darin, dass veränderte (modifizierte) Prionen in den Körper gelangen können, deren Form zwar nachgebaut, aber nicht abgebaut werden kann. Die nicht abbaubaren Prionen sammeln sich im Zellinnern an und führen zu Hirnschädigungen (Enzephalopathien). Bei Tieren gibt es mehrere bekannte Enzephalopathien, die durch Prionen hervorgerufen werden: Scrapie (Schafe und Ziegen), TME (Nerze), wasting disease (Hirsche) und vor allem BSE (Rinder).
Die bekannteste Form beim Menschen ist in diesem Zusammenhang die Creutzfeld-Jacob-Erkrankung (CJD), die auch als »humane spongiforme Enzephalopathie« bezeichnet wird. Obwohl CJD erblich bedingt ist, können die veränderten Prionen durch kontaminierte Transplantate (Hirnhaut) und kontaminiertes Instrumentar (z. B. Hirnelektroden) auf andere Menschen übertragen werden und bei ihnen ebenfalls CJD erzeugen. Bei Tieren können Erkrankungen dieser Art nachweislich auch durch Aufnahme von Prionen über die Nahrung ausgelöst werden. Es gibt deutliche Hinweise dafür, dass diese Variante von CJD (= vCJD) auch beim Menschen existent ist.
Prionen widerstehen den normalen Desinfektions- oder Sterilisationsmaßnahmen. Sie lösen keine Immunantwort aus und lassen sich nicht anzüchten oder direkt nachweisen. Die Diagnose wird bei CJD meist anhand der Symptome gestellt. Ein Erregernachweis kann nach dem Tod des Patienten histologisch erbracht werden. Gegen CJD bzw. vCJD gibt es keine kausale Therapie und keine Impfung. vCJD ist bei Verdacht, Erkrankung oder Tod meldepflichtig gemäß § 6 Infektionsschutzgesetz.
Hinweis
Umfangreiche Informationen zum Thema CJK und vCJK bietet das RKI (siehe Anhang D, Pos. 1)
2.6.3 Bakteriophagen
Bakteriophagen sind DNA-Viren, die sich auf Bakterien spezialisiert haben. Sie sind komplex aufgebaut und darauf ausgerichtet, ihr Genom in die Bakterienzelle zu injizieren. Die Phagenvermehrung verläuft in zytozider Form, ähnlich wie in Kapitel 2.5.2 beschrieben.
Eine besondere Bedeutung haben Bakteriophagen in Forschung und Industrie, da mit ihrer Hilfe Gen-Manipulationen vorgenommen und Diagnostik betrieben werden kann.
Überprüfen Sie Ihr Wissen!
1. Welche Arten von Mikroorganismen werden grob unterschieden?
2. Wie sind Bakterien grundsätzlich aufgebaut und welche zusätzlichen Anlagen können bei Bakterien vorhanden sein?
3. In welche vier Gruppen können Bakterien hinsichtlich ihrer Wirtsverhältnisse unterteilt werden?
4. Was sind »fakultativ« und was »obligat« pathogene Bakterien?
5. Was unterscheidet eine primäre von einer sekundären Resistenz?
6. Was sind Merkmale einer falschen bzw. missbräuchlichen Anwendung von Antibiotika?
7. Wodurch unterscheiden sich Hyphen und Hefen?
8. Welche Faktoren können die Entstehung von Pilzinfektionen begünstigen?
9. Was sind Protozoen?
10. Aus welchen Komponenten besteht ein Virus?
11. Welche Funktion hat das Kapsid und welche die Hülle bei Viren?
12. In welchen Schritten vollzieht sich eine »zytozide Virusreplikation«?
13. Wie und wodurch lassen sich Viren medikamentös bekämpfen?
14. Welche Erkrankungen können durch Prionen ausgelöst werden?
15. Welche besonderen Probleme bestehen bei CJD bzw. vCJD?
3 INFEKTIOLOGISCHE GRUNDKENNTNISSE
3.1 Definitionen
3.1.1 Infektion, Kolonisation und Kontamination
Im Sprachgebrauch der Hygiene ist der Begriff Infektion mit drei Merkmalen verbunden:
• Aufnahme von Krankheitserregern
• und deren Vermehrung in einem Wirt,
• sowie die damit verbundene Auslösung von Reaktionen (Symptomen).
Wenn trotz Eindringen und Vermehrung keine Symptome ausgelöst werden, spricht man von einer Kolonisation. Der wesentliche Unterschied zwischen Infektion und Kolonisation besteht also darin, dass bei einer Infektion der betreffende Mensch Krankheitszeichen aufweist, bei einer Kolonisation dagegen nicht.
Die Begriffe »Infektion« und »Kolonisation« nehmen auf bestehende Wirtsverhältnisse Bezug. Sind Gegenstände (z. B. Flächen, Instrumente oder Abfälle), Materialien (z. B. Lebensmittel, Flüssigkeiten oder Medikamente) mit Krankheitserregern oder anderen Mikroorganismen behaftet, wird von einer Kontamination gesprochen.
3.1.2 Epidemiologische Begriffe
Im Zusammenhang mit Infektionsübertragungswegen, -ausbreitungen und -auswirkungen werden Fachbegriffe aus dem Bereich der Epidemiologie (Seuchenlehre) verwendet:
• Anthroponose = Übertragung von Mensch zu Mensch, z. B. Lepra.
• Zoonose = Übertragung von Tier zu Mensch, z. B. Pest.
• Epidemie = eine im zeitlichen und örtlichen Zusammenhang stehende Häufung einer bestimmten Infektionskrankheit (z. B. zehn Fälle von Cholera infolge Wasserverunreinigung innerhalb eines Dorfes).
• Pandemie = über Länder und Kontinente verbreitete Infektionskrankheit (z. B. AIDS).
• Endemie = Dauerverseuchung, d. h. innerhalb eines bestimmten geografischen Gebietes ständig vorhandene Infektionskrankheit, bei meist gleich bleibenden Ansteckungsbedingungen (z. B. Borreliose).
• Morbidität = Krankheitshäufigkeit = Häufigkeit einer Krankheit bezogen auf die gesamte Bevölkerung (Maßstab sind meist 10.000 Einwohner pro Jahr).
• Mortalität = Sterblichkeit = Zahl der Todesfälle, bezogen auf eine bestimmte Krankheit (z. B. AIDS) in Relation zur Gesamtbevölkerung.
• Letalität = Zahl der Todesopfer, bezogen auf die Zahl der an einer bestimmten Erkrankung Erkrankten (wird meist in Prozent angegeben).
3.2 Entstehung und Übertragung von Infektionen
Infektionen können durch körpereigene (endogene) oder körperfremde (exogene) Erreger verursacht werden.
3.2.1 Entstehung endogener Infektionen
3.2.1.1 Resident- und Transientflora
Durch die unbelebte, belebte und soziale Umwelt werden Mikroorganismen in immens großer Stückzahl an den Menschen herangetragen. Somit sind Körperstellen, wie die Haut, der Verdauungstrakt oder die Vagina mit Mikroorganismen dauerhaft besiedelt. Diese dauerhafte und natürliche Besiedelung wird als Resident- oder Standortflora bezeichnet.
Wenn zur Residentflora andere, körperfremde Mikroorganismen hinzukommen bzw. wenn »untypische« Keime die normale Flora ersetzen, spricht man von einer Transientflora. Eine Transientflora ist somit unphysiologisch und stellt eine potenzielle Gefahr dar, indem über sie im Falle einer Abwehrschwäche oder einer Übertragung auf andere Körperareale Infektionen ausgelöst werden können.
Die Residentflora leistet für den Körper wertvolle Arbeiten (z. B. Verdauungshilfe im Darm) oder erfüllt eine Schutzfunktion, indem sie die Ansiedlung krankheitsverursachender (pathogener) Mikroorganismen im Sinne einer Platzhalterfunktion erschwert. Ihre gesunderhaltende (physiologische) Wirkung kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden:
• Die körpereigene Abwehr muss funktionieren.
• Das umgebende Milieu (z. B. Feuchtigkeit, pH-Wert, Luftzirkulation) muss stimmen.
• Das jeweilige Gewebe (z. B. Haut) bzw. Organ (z. B. Darm) muss intakt sein.
3.2.1.2 Störung der Residentflora
Bei einer Veränderung dieser Faktoren besteht die Möglichkeit, dass sich die Residentflora uferlos ausbreitet oder dass sich ihre Zusammensetzung zu Ungunsten des Wirtes ändert. Auf diese Weise kann ohne Ortsveränderung des Infektionserregers, allein durch die Störung der Residentflora, eine endogene, durch die »eigenen« Mikroorganismen hervorgerufene, Infektionserkrankung entstehen.
3.2.1.3 Verschleppung von Floraanteilen
Neben den dauerhaft mit Mikroorganismen besiedelten Körperstellen gibt es auch zahlreiche Orte im menschlichen Körper, die normalerweise keimfrei sind. Hierzu zählen z. B. die Lungenbläschen (Alveolen), die Gelenkhöhlen, der obere Anteil des Dünndarms, die Harnblase und alle innere Organe wie die Leber oder die Nieren. Teilweise befinden sich dauerhaft besiedelte Gebiete direkt neben keimfreien Lokalitäten (z. B. obere Atemwege besiedelt, untere unbesiedelt), sodass es durch Verschleppung von Floraanteilen zu einer Infektion kommen kann.
3.2.2 Entstehung exogener Infektionen
Grundsätzlich gibt es vier Übertragungswege, um körperfremde Mikroorganismen in einen Wirtsorganismus gelangen zu lassen:
• Alimentäre Übertragung, d. h. über den Verdauungstrakt, indem mikrobiell verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel konsumiert werden. Beispiele: Salmonellose, Typhus, Hepatitis A.
• Aerogene Übertragung, d. h. über den Atmungstrakt durch erregerhaltige Tröpfchen, Stäube oder Luft. Beispiele: Tuberkulose, Windpocken, Masern.
• Kontakt-Übertragung, d. h. durch Kontakte zwischen Mensch und Mensch (homolog) oder Mensch und Tier (heterolog). Als Eintrittspforten kommen Haut, Schleimhaut, Wunden sowie alle Körperöffnungen in Frage. Bei der Kontakt-Übertragung wird unterschieden, ob es sich um eine direkte Berührung (direkter Kontakt, z. B. Hand in Wunde) oder um einen kontaminierten Zwischenträger (indirekter Kontakt, z. B. über ein Handtuch) handelt. Beispiele: Tetanus, Wundinfektionen, Zystitis nach Katheterismus.
• Wichtige Untergruppen der Kontaktinfektionen sind die Geschlechtsinfektionen (Übertragung durch Sexualkontakte, wie bei Syphilis oder Gonorrhoe) und die Schmierinfektionen (Verschleppung von erregerhaltigen Sekreten oder Fäkalrückständen).
• Transmissive Übertragung, d. h. über Zwischenwirte (Vektoren), wie z. B. Säugetiere oder Insekten. Häufig handelt es sich um Infektionserreger, die verschiedene Entwicklungszyklen durchlaufen, wobei der Mensch Endwirt oder ebenfalls Zwischenwirt sein kann. Beispiele: Malaria, Gelbfieber.
3.2.3 Infektionsabwehr
3.2.3.1 Keim- und Immunpotenzial
Nach einer endo- oder exogenen Übertragung von Krankheitserregern kommt es innerhalb des Körpers zu einer Konfrontation zwischen den Erregern und der körpereigenen Abwehr. Im Falle von Mikroorganismen unterscheidet man Keim- und Immunpotenzial:
• Als Keimpotenzial bezeichnet man die Menge und die Virulenz der übertragenen Mikroorganismen, als Virulenz die Summe infektionsauslösender Eigenschaften wie Übertragbarkeit, Anhaftvermögen und Giftigkeit.
• Dem steht ein Immunpotenzial entgegen, das aus Barrieren, unspezifischer und spezifischer Abwehr besteht:
– Barrieren sind Schutzmechanismen, wie die unverletzte Haut, das Flimmerepithel der Luftwege, die Magensäure oder die Platzhalterfunktion der Residentflora.
– Bei der unspezifischen Abwehr handelt es sich um körpereigene, keimschädigende Substanzen wie Interferon oder Lysozym, die im Blut gelöst sind (humoral), sowie um spezielle Fresszellen (Granulocyten und Makrophagen), die begrenzt in der Lage sind, Eindringlinge, Fremdkörper und Zelltrümmer zu beseitigen.
– Das Wirkprinzip der spezifischen Abwehr besteht darin, Fremdkörper und Eindringlinge (Antigene) mit im Blut gelösten (humoralen) Antikörpern zu markieren, um sie anschließend durch T-Lymphozyten vernichten zu lassen, die durch die Verbindung des Antigens mit dem Antikörper (Antigen-Antikörper-Komplex) aktiviert werden. Dieser Mechanismus bedingt, dass zunächst eine Auseinandersetzung mit einem Infektionserreger stattfinden muss (d. h. Markierung mit Antikörpern), ehe die Vernichtung erfolgen kann. Dies ist auch das Funktionsprinzip der aktiven Impfung.
3.2.3.2 Impfungen
Mängel der spezifischen Abwehr lassen sich z. T. durch aktive oder passive Impfungen beseitigen:
• Bei der aktiven Impfung werden Hüllen, Bestandteile oder apathogene bzw. abgeschwächte »Kollegen« von Infektionserregern in den Wirtsorganismus gebracht. Dieser bildet daraufhin Antikörper, was jedoch Wochen dauern kann.
• Bei einer passiven Impfung werden dagegen fertige Antikörper gegeben, die den Wirt aber nicht sofort dauerhaft schützen, da sie vom Körper wieder abgebaut werden.
3.2.4 Reaktionen des Körpers bei einer Infektion
3.2.4.1 Infektionsausbreitung
Für das Überleben eines in den Wirt eingedrungenen Erregers ist entscheidend, wie umfangreich und wie schnell er sich innerhalb des Wirtsorganismus vermehren und über das Blut (hämatogen), über die Lymphbahnen (lymphogen), über das Nervengewebe (neurogen), innerhalb des Gewebes oder innerhalb von Körperflüssigkeiten ausbreiten kann.
3.2.4.2 Krankheitserzeugende Faktoren
Im Zuge der Ausbreitung eines Krankheitserregers können mehrere krankheitserzeugende Faktoren wirksam werden:
• Es werden Abwehrreaktionen ausgelöst (Fieber, Gefäßweitstellungen, Einkapselung), die sich auf den Körper schädigend auswirken (z. B. abwehrbedingte Gelenkschädigung bei Rheuma).
• Es kommt zu einer Schädigung oder Zerstörung von Geweben, Organen oder Organsystemen, z. B. indem der Erreger Zellen zur eigenen Vermehrung missbraucht oder sie zur Nährstoffgewinnung nutzt.
• Der Erreger sondert Gifte (Exotoxine) ab, die als Enzyme wirken oder ihn vor Angriffen schützen können. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass sich Erregerbestandteile (z. B. im Falle einer Keimabtötung) wie ein Gift auswirken können (Endotoxine).
3.2.4.3 Infektionsverlauf
• Bei einer Beschränkung des Infektionsgeschehens auf einen Körperbezirk (z. B. auf einen Finger), spricht man von einer lokalen Infektion, wie z. B. im Falle von Abszessen, Wundinfektionen oder Nagelwalleiterungen. Die Symptome einer lokalen Infektion sind Rötung, Schwellung, Schmerz und eingeschränkte Funktion.
• Wenn sich der Infektionserreger dagegen im ganzen Körper (z. B. hämatogen) ausbreitet, ist dies eine allgemeine oder systemische Infektion (z. B. Masern, Malaria), die inapparent (d. h. ohne erkennbare Symptome) oder manifest (d. h. mit erkennbaren Symptomen, wie z. B. Fieber) verlaufen kann.
• Von der Aufnahme eines Infektionserregers bis zur Auslösung von Reaktionen (Symptomen) ist eine unterschiedlich große Zeitspanne notwendig, die als Inkubationszeit bezeichnet wird. Wenn der Beginn der Erkrankung mit relativ uncharakteristischen Symptomen (wie z. B. Mattigkeit) einhergeht, wird die Dauer dieser Symptome Prodromalstadium genannt.
3.2.4.4 Ausscheidung von Krankheitserregern
Bei systemischen Infektionen kann es über Ausscheidungen, Körperflüssigkeiten, Atemluft oder Wundsekreten zur Ausscheidung von Krankheitserregern kommen, sodass der Erkrankte zur Erregerquelle wird und somit ein Infektionskreislauf zustande kommen kann. Je nach Art der Erkrankung, können die Erreger während der Inkubationszeit, während der Erkrankungszeit oder nach der Erkrankung ausgeschieden werden.
Um die Gefahr einzudämmen, dass auf diesem oder anderen Wegen aus einer vereinzelten Infektion ein epidemisches Geschehen wird, gibt es gesetzliche Regelungen, die im Infektionsschutzgesetz (IfSG, siehe Kap. 7.2.2) und in weiteren Verordnungen und Gesetzen hinterlegt sind.
3.3 Entstehung und Übertragung nosokomialer Infektionen
3.3.1 Definition und Auslegung des Begriffes
In § 2 IfSG (siehe Anhang D, Pos. 3) wird der Begriff »nosokomiale Infektion« wie folgt definiert:
»Eine nosokomiale Infektion ist eine Infektion mit lokalen oder systemischen Infektionszeichen als Reaktion auf das Vorhandensein von Erregern oder ihrer Toxine, die im zeitlichen Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme steht, soweit die Infektion nicht bereits vorher bestand.«
Nosokomiale Infektionen werden auch als Krankenhausinfektionen bezeichnet. Gemäß der obigen Definition ist der Begriff aber nur bedingt an einen Klinikaufenthalt gebunden. Wenn eine in Tageskliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Arztpraxen oder Pflegeheimen durchgeführte medizinische Maßnahme (z. B. eine Injektion oder eine transurethrale Katheterisierung) eine Infektion nach sich zieht, wird auch dies als nosokomiale Infektion bezeichnet.
3.3.2 Ursachen und Verteilung
Typische nosokomiale Infektionen kommen dadurch zustande, dass im Zuge von Diagnostik- und Therapiemaßnahmen Mikroorganismen verschleppt, übertragen oder begünstigt werden und damit die Immunkompetenz der Patienten überfordert wird. Die Ursache ist somit meist iatrogen, d. h. durch einen ärztlichen Eingriff bedingt.
Die häufigsten nosokomialen Infektionen, wie Harnweginfektionen, Infektionen der unteren Atemwege, postoperative Wundinfektionen und primäre Sepsiserkrankungen, sind in der Regel Folgeerscheinungen von krankenhaustypischen Maßnahmen, wie transurethrale Harnableitungen, künstliche Beatmungen, Operationen und Infusionstherapien.
Begünstigend kommt hinzu, dass etliche der betroffenen Patienten gravierende Vorschwächungen (Prädispositionen), wie z. B. hohes Alter, Exsikkose, Abwehrschwäche, Vorerkrankungen) aufweisen.
Die Anzahl und Art nosokomialer Infektionen innerhalb einer Einrichtung bzw. einer Abteilung hängt also maßgeblich davon ab, welche Patienten sich dort aufhalten und welche Maßnahmen in welcher Häufigkeit und unter welchen Bedingungen an ihnen durchgeführt werden.
So erklärt es sich, dass Intensivstationen innerhalb einer Klinik die höchsten Infektionsraten haben. In der größten deutschen Prävalenzstudie zur Häufigkeit nosokomialer Infektionen (NIDEP-I-Studie, Rüden et al.) hatten 1994 15,3 % der Patienten auf Intensivstationen eine oder mehrere nosokomiale Infektionen aufzuweisen, wobei die Beatmungspneumonie deutlich im Vordergrund stand.
3.3.3 Erreger nosokomialer Infektionen
3.3.3.1 Allgemeine Eigenschaften
Im Prinzip kann jeder Infektionserreger auch nosokomiale Infektionen verursachen. Betrachtet man aber die Mehrheit, kommt man zu folgenden Aussagen:
• Meist sind es Bakterien, die aus der Residentflora des Menschen stammen und/oder Bestandteil einer Transientflora sein können.
• Als fakultativ pathogene Mikroorganismen führen sie nur unter bestimmten Bedingungen zur Infektion, z. B. wenn der Wirt eine Abwehrschwäche hat oder künstlich geschaffene Eintrittspforten (z. B. Katheter, Venenzugang) aufweist.
• In der Umwelt sind sie lange überlebensfähig, da sie meist geringe Nährstoffansprüche haben und sehr anpassungsfähig sind.
• Sie entwickeln relativ schnell umfassende sekundäre Antibiotikaresistenzen.
• Es kommen verschiedene endogene und exogene Infektionsmechanismen in Frage. Fast alle Erreger nosokomialer Infektionen können unterschiedliche Krankheitsbilder auslösen.
• Infektionen durch Krankenhauserreger können bis auf wenige Ausnahmen (Pneumokokken) nicht durch passive und/oder aktive Impfungen verhindert werden.
Darüber hinaus gibt es weitere Infektionserreger, die im Krankenhaus ein Problem darstellen können, indem sie:
• von erkrankten Patienten stammen und aufgrund ihrer Gefährlichkeit (z. B. Tuberkuloseerreger) oder ihrer extrem leichten Übertragbarkeit (z. B. Rota- oder Noroviren) umfangreiche Isolierungsmaßnahmen notwendig machen;
• durch Instrumente übertragen werden können und daher einen hohen Aufwand bei der Instrumentenaufbereitung erfordern (z. B. Hepatitis B-oder C-Viren);
• über hausinterne Einrichtungen, Arzneimittel oder Lebensmittel verschleppt werden können (z. B. Legionellen über Wasserleitungen oder Salmonellen über die Lebensmittelversorgung);
• durch erkrankte Mitarbeiter (z. B. Streptokokken bei OP-Personal) verschleppt werden.
3.3.3.2 Erreger nosokomialer Infektionen im Detail
Hinweis
Der nachfolgende Abschnitt beschreibt stichwortartig und komprimiert die Eigenschaften bestimmter Infektionserreger und setzt die Kenntnis der in Kapitel 2 erläuterten Fachbegriffe voraus.
• Staphylokokken = grampositive, sporenlose, unbewegliche, fakultativ anaerobe, bakterielle Kommensalen oder Parasiten, die sich in Haufen- oder Traubenform anordnen. Sie sind anspruchslos und gegenüber Umwelteinflüssen widerstandsfähig.
– Staphylococcus aureus kann sich in der Oropharyngeal-, der Darmund der Hautflora befinden. Dieser Keim produziert eine Vielzahl an Exotoxinen und Enzymen (u. a. Koagulase, sodass man auch von »Koagulase-positiven Staphylokokken« spricht). Staphylococcus aureus verursacht u. a. Furunkel, Abszesse, Wundinfekte, Mittelohrentzündungen, Pneumonien, Lebensmittelvergiftungen und Septitiden. In Kliniken sind multiresistente Stämme, wie MRSA (siehe Kap. 15.3.3.1), ein häufiges und schwer beherrschbares Problem.
– Staphylococcus epidermidis gehört zur normalen Hautflora und produziert keine Toxine (Koagulase-negative Staphylokokken), kann aber Kunststoffmaterialien wie Implantate oder Katheter besiedeln und auf ihnen Biofilme bilden. Staphylococcus epidermidis kann vor allem bei abwehrgeschwächten Patienten und Neugeborenen im Rahmen einer Infusionstherapie eine Sepsis erzeugen.
• Streptokokken = grampositive, sporenlose, unbewegliche, fakultativ anaerobe, bakterielle Kommensalen oder Parasiten, die sich in Ketten oder als Pärchen anordnen und z. T. in der Lage sind, blutauflösende (hämolysierende) Substanzen zu bilden. Sie können ein Bestandteil der Oropharyngealflora, aber auch der Genital- oder Darmflora sein.
– Streptokokkus pyogenes (auch A-Streptokokkus genannt) besitzt Exotoxine und Enzyme, wie Streptolysin und Streptokinase, die hämolysierend und fibrinauflösend wirken. A-Streptokokken können Fieber, Schock und spezielle Krankheitsbilder, wie Erysipel, Scharlach oder akutes rheumatisches Fieber, auslösen.
– Streptococcus agalactiae (B-Streptokokkus) ist toxinärmer, kann aber bei abwehrgeschwächten Personen und Neugeborenen Haut-, Lungenund Harnwegsentzündungen oder Septitiden verursachen.
– Streptococcus pneumoniae (Pneumokokkus) ist in der Lage, eine Kapsel zu bilden, die ihn vor dem Zugriff der körpereigenen Abwehr schützt. Pneumokokken können auf meist endogenem Wege Pneumonien, Meningitiden und Septitiden auslösen. Gegen Pneumokokken gibt es eine aktive Impfung.
• Enterococcus faecium ist ein zur Darmflora gehörendes grampositives Bakterium, das ähnliche Eigenschaften wie Streptokokken vorweist, aber nur gering pathogen ist. Dennoch ist Enterococcus faecium ein häufiger Erreger nosokomialer Infektionen, der oft im Verbund mit weiteren Infektionserregern vorwiegend Harnwegsinfektionen verursacht und in der multiresistenten Variante VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) schwer therapierbar ist.
• Clostridium difficile = grampositives, Sporen bildendes, anaerobes Bakterium, dessen Toxine unter bestimmten Umständen schwere Durchfallerkrankungen verursachen können. Dieses als CDI (Clostridium difficile Infektion) oder CDAD (Clostridium diffizile assoziierte Diarrhoe) bezeichnete Krankheitsbild kann mit z. T. tödlichen Komplikationen (wie dem toxischen Megacolon) einhergehen. Für das Entstehen einer CDI sind die Disposition (Empfänglichkeit) des Patienten, eine vorausgegangene Antibiotikatherapie und die Virulenz (krankheitsauslösende Eigenschaften) des Erregerstammes maßgeblich. Clostridium difficile hat eine besonders ausgeprägte Desinfektionsmittelresistenz.
• Pseudomonas aeruginosa = gramnegativer, aerober, beweglicher, begeißelter, anspruchsloser und widerstandsfähiger bakterieller Saprophyt. Er ist ein feuchtigkeitsliebender Umgebungskeim, der auch in der Darmflora zu finden ist. Pseudomonas aeruginosa dringt meist über kleine Verletzungen ins Gewebe ein, haftet sich mit Fimbrien an, sondert Toxine und Enzyme ab und führt so zur Zerstörung von Zellen oder Geweben. Die Folgen können Beatmungspneumonien, Wundinfektionen (speziell bei Verbrennungen), Harnwegsinfektionen und Septitiden sein.
• Acinetobacter baumanii und Stenotrophomonas maltophilia = gramnegative Bakterien, die in ihren Eigenschaften und Auswirkungen Pseudomonas aeruginosa ähneln.
• Escherischia coli = gramnegativer, fakultativ anaerober, begeißelter bakterieller Saprophyt des Darmes. Bei einer Übertragung oder einer endogenen Verschleppung kann Escherischia coli Infektionen in Form von Harnwegsinfekten, Wundinfekten, Septitiden usw. auslösen. Einige spezielle Stämme (Pathovare) verfügen über hochwirksame Toxine und/oder über besondere Anhaft- und Durchdringungseigenschaften, die lebensgefährliche Erkrankungen wie HUS (Hämolytisch-urämisches Syndrom) auslösen können. Bekannte Pathovare sind EHEC, EPEC, ETEC und EIEC.
• Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens und Proteus mirabilis haben ähnliche Eigenschaften wie Escherischia coli und sind ebenfalls Darmflorabestandteile. Als gering pathogene Kommensalen und Symbionten lösen sie Harnwegs-, Atemwegs- oder Wundinfektionen vor allem bei stark abwehrgeschwächten Patienten aus. Teilweise sind diese Keime dieser Art in der Lage, die Substanz ESBL (Extended-Spectrum-beta-Lactamase) zu bilden, welche eine umfassende Antibiotika-Resistenz bewirkt und über ringförmige Plasmide zwischen den unterschiedlichen Bakterienarten weitergegeben werden kann.
• Legionella pneumophila = gramnegatives, aerobes Bakterium, das sich bei einem Temperaturoptimum zwischen 35 und 45 °C im Wasser vermehrt (siehe Kap. 10.1.4.1). Legionella pneumophila kann Pontiac-Fieber, eine relativ harmlose, erkältungsähnliche Erkrankung und Legionellose, eine häufig tödlich verlaufende Art der Lungenentzündung verursachen.
• Candida albicans ist ein ubiquitärer Hefepilz, der häufig als Kommensale der Mund-, Haut- oder Darmflora vorzufinden ist. Candida-Infektionen wie Soorbefall, Pneumonie oder Sepsis haben somit meist einen endogenen Ursprung. Betroffen sind in erster Linie stark abwehrgeschwächte Patienten.
• Aspergillus fumigatus ist ein ubiquitärer Schimmelpilz, der im Falle einer Abwehrschwäche eine Infektion der Atmungsorgane (betroffen sind vor allem onkologische Patienten) oder von Verbrennungswunden auslösen kann. Davon abgesehen ist Aspergillus fumigatus in der Lage, auch bei »gesunden« Menschen Intoxikationen und Allergien auszulösen.
3.3.4 Allgemeine Entstehung nosokomialer Infektionen
In der Regel stehen nosokomiale Infektionen mit invasiven Zugängen, operativen Eingriffen und weiteren krankenhausspezifischen Maßnahmen in Verbindung, die die Entstehung endogener Infektionen begünstigen und die »normalen« exogenen Übertragungsmöglichkeiten (siehe Kap. 3.2) um zusätzliche Varianten erweitern.
3.3.4.1 Endogene nosokomiale Infektionen
Immunsupprimierende Maßnahmen, wie z. B. eine Zytostatikatherapie oder eine Bestrahlungsbehandlung, aber auch der Einsatz bestimmter Medikamente, wie z. B. Cortison oder Breitbandantibiotika, stören die Rahmenbedingungen einer physiologischen Residentflora. Als Folge können sich einzelne Anteile der Flora uferlos ausbreiten, sodass sich ihre mikrobielle Zusammensetzung zu Ungunsten des Wirtes ändert. Das Resultat kann eine endogene nosokomiale Infektion durch Störung der Residentflora sein.
Beispiel: Zur Therapie einer Krebserkrankung werden Zytostatika appliziert, welche u. a. physiologische Bestandteile der Mund-Rachenflora reduzieren, was die Ausbreitung von Soorpilzen begünstigt, die sich schon zuvor in geringer Menge in der Mundhöhle befanden. Es kommt zur Entstehung von Mundsoor.
Ebenso können nosokomiale Infektionen durch eine Verschleppung von Floraanteilen verursacht werden.
Beispiel: Beim Einlegen eines transurethralen Dauerkatheter gelangen Mikroorganismen der physiologischen Perianal- und Genitalflora in Harnröhre und -blase. Von dort ausgehend kolonisieren sie die Harnleiter und führen zu einer aufsteigenden Harnwegsinfektion.
3.3.4.2 Exogene nosokomiale Infektionen
Wenn körperfremde Mikroorganismen in das Körperinnere eingebracht werden (exogener Übertragungsweg), sind die Stationen Infektionsquelle, Infektionsweg, Eintrittspforte und Empfänger zu unterscheiden.
Als Infektionsquellen (oder Keimreservoire) kommen in Frage:
• Menschen (Personal, Patienten oder Besucher),
• Gegenstände (z. B. Instrumente, medizinisch-technische Geräte, Einrichtungsgegenstände),
• Umgebungen (z. B. Einrichtungen des OP oder Intensivstationen) oder
• Substanzen (z. B. Infusionen, Spüllösungen oder Nahrungsmittel).
Die bei der Erbringung krankenhausspezifischer Maßnahmen möglichen Infektionswege sind zwar vielfältig, die weitaus meisten nosokomialen Infektionen werden jedoch durch direkte und indirekte Kontaktübertragungen verursacht:
• Infektionsübertragungen durch direkte Kontakte kommen zustande, wenn Floraanteile vom Personal (z. B. durch Defekt im Operationshandschuh) durch Berührung einer Eintrittspforte (z. B. Operationswunde) übertragen werden.
• Zu Infektionsübertragungen durch indirekte Kontakte kann es kommen, wenn Instrumente, medizinische Geräte, Utensilien oder Einrichtungen nach ihrer Nutzung nicht entsprechend aufbereitet wurden oder vor ihrer (invasiven) Nutzung kontaminiert wurden.
Durch direkte und indirekte Kontakte kann es leicht zu sog. »Kreuzinfektionen«, d. h. zu einem Erreger-Austausch von einem Patienten zum anderen kommen.
• Aerogene Infektionsübertragungen können sich ergeben, wenn bei bestimmten Operationen (z. B. orthopädischen Eingriffe) Keimpotenziale über die Raumluft in Wundgebiete übertragen werden. Einer ähnlichen Gefahr sind auch extrem abwehrgeschwächte Patienten (z. B. Verbrennungspatienten) ausgesetzt. Ebenso kann die Einatmung kontaminierter befeuchteter Luft (z. B. bei künstlicher Beatmung) zur aerogenen Infektionsübertragung führen.
• Inkorporative Infektionsübertragungen finden statt, wenn keimbesiedelte Nahrung oder Flüssigkeit (u. a. Injektions-, Infusions- und Transfusionsgaben) in den Körper gelangt oder wenn kontaminiertes Material (Implantat, Katheter usw.) in den Körper eingebracht wurde.
Als Eintrittspforte für Infektionserreger eignet sich im Prinzip jede Körperöffnung und jede Wunde. Ein besonderes Problem sind jedoch dauerhafte Zugänge (Divices) wie Blasenverweilkatheter, Endotrachealtuben, Drainagen oder zentrale Venenkatheter, die die Entstehung intra- oder extraluminaler Übertragungen begünstigen oder sogar provozieren (Abb. 3.1).

Abb. 3.1: Intraluminale und paraluminale Infektions- übertragung.
• Die intraluminale Übertragung erfolgt exogen durch das Schlauchinnere (Lumen). Dies kann z. B. auf undichte Verbindungsstellen, Manipulationen am Schlauchsystem, Rückfluss kontaminierter Flüssigkeiten oder Sekretstau zurückzuführen sein.
• Paraluminale Übertragungen sind endogen bedingte Übertragungen, die in der Zone zwischen körperfremder und -eigener Struktur stattfinden. Meist handelt es sich hierbei um ein nahezu unausweichliches Geschehen, das umso wahrscheinlicher eintritt, je länger der künstliche Zugang belassen wird.
Empfänger nosokomialer Infektionen sind vornehmlich Patienten, die entsprechende Prädispositionen aufweisen, weil sie:
• sehr alt sind und sich in einem reduzierten Allgemein- und/oder Ernährungszustand befinden;
• belastende Operationen bzw. massive Traumata (z. B. ausgedehnte Verbrennung) oder langzeitige, häufige Klinikaufenthalte hinter sich haben;
• an einer immunschädigenden Erkrankung leiden (z. B. Anämie, Stoffwechselstörungen oder Krebs) oder
• Massentransfusionen bekamen.
Darüber hinaus ist auch das Personal gefährdet. Eine besondere Gefahr stellen Infektionserreger dar, die über Blut oder Wundsekrete im Zusammenhang mit Verletzungen übertragen werden können (z. B. Hepatitis B oder C infolge einer Nadelstichverletzung). Die Pflege infizierter Patienten birgt natürlich auch das Risiko einer Ansteckung. Hervorzuheben sind hier virale Infektionen des Verdauungstraktes (z. B. Noro-Infektionen), Fälle von Scabies oder offene Lungentuberkulose.
Überprüfen Sie Ihr Wissen!
1. Was unterscheidet eine Kolonisation von einer Infektion und was versteht man unter einer Kontamination?
2. Wie werden die Begriffe »Epidemie«, »Pandemie« und »Endemie« definiert und welche Aussagen sind mit den Begriffen »Morbidität«, »Mortalität« und »Letalität« verbunden?
3. Was unterscheidet eine Transientflora von einer Residentflora?
4. Welche Bedingungen benötigt eine physiologische Residentflora und wie kann es zu Störungen der Residentflora kommen?
5. Welche vier Übertragungswege werden bei exogenen Infektionen unterschieden?
6. Welche körpereigenen Schutzmechanismen dienen als Infektionsbarrieren?
7. Was ist der Unterschied zwischen der spezifischen und der unspezifischen körpereigenen Abwehr?
8. Was bewirkt eine aktive und was eine passive Impfung?
9. Auf welche Weise können sich Infektionserreger innerhalb eines Wirtsorganismus ausbreiten?
10. Was sind Endo- und was Exotoxine?
11. Was versteht man unter einer lokalen und was unter einer systemischen Infektion?
12. Wie ist die Inkubationszeit und wie das Prodromalstadium definiert?
13. Wie wird der Begriff »nosokomiale Infektion« definiert und wodurch werden typische nosokomiale Infektionen verursacht?
14. Welches sind die häufigsten nosokomialen Infektionen und mit welchen medizinischen Maßnahmen stehen sie im Zusammenhang?
15. Was kennzeichnet typische Infektionserreger nosokomialer Infektionen und welches sind die typischen Erreger?
16. Wie können endogene nosokomiale Infektionen entstehen?
17. Welche Infektionsquellen und welche -wege werden bei exogenen nosokomialen Infektionen unterschieden?
18. Warum haben dauerhafte invasive Zugänge bei der Entstehung nosokomialer Infektionen eine große Bedeutung?
19. Welche Prädispositionen sind bei nosokomial infizierten Patienten häufig vorzufinden?
20. Welchen Infektionsgefahren ist das pflegerisch-medizinische Personal ausgesetzt?
4 GRUNDLAGEN ZUR MIKROBIOLOGISCHEN DIAGNOSTIK
4.1 Nachweis und Identifizierung von Bakterien
4.1.1 Ausgangssituation und Fragestellungen
Im Krankenhaus liegt für den Nachweis und die Bestimmung von Mikroorganismen meist folgende Ausgangssituation zugrunde: Aufgrund bestimmter Symptome vermutet der Arzt, dass bei einem Patienten eine Infektion vorliegt. Er entnimmt (vermutlich) erregerhaltiges Material und schickt es ins bakteriologische Labor.
• Um zu einer Diagnose zu kommen und Aufschluss über die mögliche Therapie zu gewinnen, soll herausgefunden werden, ob das Material Mikroorganismen enthält und, wenn ja, um welche es sich handeln könnte (Frage nach Art und evtl. Typ) und welche Medikamente zur Bekämpfung eingesetzt werden können (Frage nach Resistenz).
• Evtl. wird auch nach der Erregeranzahl gefragt, z. B. um abzuklären, ob es sich um eine Infektion oder lediglich um eine Kontamination handelt.
• In anderen Fällen ist abzuklären, ob der betreffende Patient infiziert ist bzw. ob eine Infektion stattgefunden hat.
4.1.2 Der Laborauftrag
Zur Abklärung seiner Fragen erteilt der Arzt dem Labor einen Laborauftrag und vermerkt auf einem Antragsformular:
• wie die Personalien des Patienten lauten (Name, Vorname, Geburtsdatum), um welche Anforderungsstelle es sich handelt und wer die Untersuchung in Auftrag gibt;
• um was für ein Untersuchungsmaterial es sich handelt (z. B. Punktat), wo (z. B. aus dem Liquorraum) und wann (Datum, evtl. Uhrzeit) es entnommen wurde;
• welche Untersuchungen durchgeführt werden sollen, bzw. welche Fragestellung vorliegt (z. B. Bestimmung der Keimzahl und -art);
• welche Verdachtsdiagnose besteht (z. B. Meningitis) und
• evtl. welche Begleitumstände (z. B. Gabe von Antibiotika) vorliegen.
Für das bakteriologische Labor ist es zur Wahl der Untersuchungsmethode und zur Festlegung der Untersuchungsabläufe wichtig, dass diese Angaben möglichst lückenlos vorliegen.
4.1.3 Entnahme und Transport von Untersuchungsmaterial
• Die Entnahme und der Transport von erregerhaltigem Material muss so erfolgen, dass die Erreger möglichst optimale Bedingungen vorfinden, dass das Untersuchungsmaterial nicht durch Hinzukommen weiterer Mikroorganismen verunreinigt wird und dass keine Erreger in die Umgebung verschleppt werden.
• Dies wird erreicht, indem z. B. mit Hilfe eines Stieltupfers (Abstrich), einer Spritze oder eines Skalpells erregerhaltiges Material unter sterilen Bedingungen entnommen und in ein steriles Transportgefäß deponiert wird.
• Für die bakteriologische Untersuchung ist es notwendig, dass die im Untersuchungsmaterial befindlichen Erreger möglichst rasch in bzw. auf ein geeignetes Nährmedium gelangen. Hierbei kann es sich um Böden (Agar) oder Flüssigkeiten (Bouillon) handeln, wobei je nach Bakterium verschiedene Substanzen verwendet werden. Teilweise befindet sich das Nährmedium bereits im Transportgefäß (z. B. im Uricult-Test), meist erfolgt die Übertragung des erregerhaltigen Materials auf das Nährmedium aber erst im Labor.
Gewinnung von Untersuchungsmaterialien im Detail:
• Operations- und Biopsiematerial: Das Gewebe wird in einen sterilen Becher mit etwas physiologischer Kochsalzlösung gegeben.
• Blut: Jeweils 5 ml Blut werden mit einem speziellen Entnahmebesteck in zwei Flaschen mit Bouillon (eine für aerobe, eine für anaerobe Bakterien) gegeben. Bei Kindern wird weniger Blut abgenommen und eine spezielle Bouillon-Flasche verwendet.
• Liquor und andere Punktate: Ca. 1 bis max. 5 ml Punktat werden in ein steriles Röhrchen gegeben oder in der verschlossenen Entnahmespritze belassen.
• Eiter, Wundsekret, Genitalsekret, Spülflüssigkeit, Material aus dem Respirationstrakt: Die erregerhaltige Flüssigkeit wird in ein steriles Röhrchen gegeben, in der verschlossenen Entnahmespritze belassen oder mit einem Stieltupfer als Abstrich entnommen, wobei der Tupfer unmittelbar danach in ein steriles Röhrchen mit einer Nährsubstanz gesteckt wird.
• Magensaft, Duodenalsaft, Galle: Die betreffende Flüssigkeit wird mit Hilfe einer Sonde entnommen (1 bis 5 ml genügen) und in ein steriles Röhrchen gefüllt oder in der verschlossenen Entnahmespritze belassen.
• Stuhl: Eine bohnengroße Portion pro Untersuchung wird in ein sauberes Gefäß (evtl. mit einem Nährmedium) gefüllt. Z. T. werden auch Rektalabstriche mit Hilfe eines Stieltupfers vorgenommen, wobei der Tupfer unmittelbar danach in ein steriles Röhrchen gesteckt wird.
• Urin: Verunreinigungen durch Keime der Harnröhrenöffnung lassen sich bei der Urinentnahme nur schwer ausschließen. Als zuverlässigste Methode gilt die Blasenpunktion oder die Gewinnung von Katheterurin. In den meisten Fällen genügt jedoch der Mittelstrahlurin, bei dem der Patient den ersten Harnstrahl in die Toilette ablässt, einen weiteren in einen sterilen Becher und den Rest wieder in die Toilette.
In jedem Fall ist zu beachten:
• Beim Umgang mit potenziell erregerhaltigen Materialien müssen Vorgaben zur Arbeitssicherheit und Transportbestimmungen beachtet werden.
• Erregerhaltiges Material soll sicher verschlossen und möglichst unverzüglich der Untersuchung zugeleitet werden.
• Wenn aus dem Material eine Kultur angezüchtet werden soll, wird eine Lagerung bei möglichst 36 °C bis zur Untersuchung empfohlen. Für eine Keimzahlbestimmung ist eine dagegen kühle Lagerung bei ca. 4 bis 6 °C notwendig.
• Beim Versand von Untersuchungsmaterialien per Post sind spezielle, austrittssichere Versandbehältnisse zu verwenden.
4.1.4 Laboruntersuchungen
Im bakteriologischen Labor wird im Regelfall eine Kultur- und Resistenzuntersuchung durchgeführt (Abb. 4.1):
• Vom Untersuchungsmaterial wird am Tag des Materialeinganges eine Kultur angelegt: Das Material wird auf ein geeignetes Nährmedium übertragen und ca. ein bis zwei Tage bei 36 °C bebrütet. Sind Bakterien vorhanden und ist das Medium geeignet, vermehren sie sich massenhaft und bilden eine Kolonie, die im Labor als »Kultur« bezeichnet wird.
• Von dieser Kultur werden am zweiten Tag Bakterien entnommen, zur mikroskopischen Untersuchung eingefärbt und mikroskopisch hinsichtlich Färbeverhalten, Form und Anlagerung begutachtet.
• Die dadurch gewonnene grobe Zuordnung des Bakteriums wird unter zusätzlicher Begutachtung der gewachsenen Kultur bestätigt bzw. durch die Anlage zusätzlicher Kulturen auf speziellen Medien und/oder der Ermittlung von Stoffwechselleistung weiter differenziert.
• Beim Vorliegen verschiedener Bakterienarten (Mischkultur) werden Reinkulturen angelegt, die erst nach einem weiteren Tag untersucht werden können.
• Parallel hierzu wird die Resistenzuntersuchung vorgenommen, die ebenfalls einen Tag benötigt. Bei dieser Untersuchung wird eine Kultur mit verschiedenen Antibiotika konfrontiert. Daraufhin misst oder beurteilt man, inwiefern es dem Medikament gelungen ist, die Bakterien in ihrem Wachstum zu stoppen und erhält dadurch Rückschlüsse zur medikamentösen Therapie.
• Im Normalfall weiß man also nach ca. zwei, drei Tagen, um welchen Erreger es sich handelt und welche Medikamente wirksam sind.
Bei speziellen Fragestellungen, bestimmten Erregern oder bei sehr geringer Erregeranzahl werden weitere Untersuchungen vorgenommen:
• Molekularnachweis: Mit »Gensonden« und spezieller Techniken (wie der PCR = Polymerasekettenreaktion) werden erregerspezifische Sequenzen im Erbgut nachgewiesen, was auch bei sehr geringer Erregeranzahl eine zuverlässige Zuordnung erlaubt.
• Antigennachweis: Wenn konkrete Hinweise auf einen ganz bestimmten Erreger bestehen, kann mit Hilfe einer künstlich herbeigeführten Antigen-Antikörper-Reaktion der Nachweis erbracht werden.
• Antikörpernachweis: Bei einem Antikörpernachweis ist es umgekehrt: Mit Hilfe bekannter Erreger (also Antigene) werden vorhandene Abwehrstoffe in Form von Antikörpern nachgewiesen. Die nachgewiesene Menge wird als Titer bezeichnet. Je nachdem, welche Art von Antikörper man in welcher Menge nachgewiesen hat, erlaubt dies Rückschlüsse auf akut bestehende bzw. bereits durchgemachte Infektionen sowie über den Erfolg aktiver Impfungen.
4.2 Nachweis und Identifizierung von Mikrophyten und Protozoen
Hinsichtlich des Nachweises und der Identifikation von Mikrophyten (Pilzen) ähnelt die Ausgangssituation der von bakteriellen Infektionen. Ein großer Unterschied besteht darin, dass es zuverlässig wirksame Medikamente gegen Pilzerkrankungen (Antimykotika) gibt. Die Bildung sekundärer Resistenzen gegen diese Substanzen ist zwar prinzipiell möglich, aber wenig verbreitet, sodass sich eine Resistenzuntersuchung meist erübrigt.
Bei lokalen Pilzerkrankungen (Mykosen) reicht meist eine mikroskopische Untersuchung aus. Zur genauen Bestimmung einer Pilzart ist jedoch das Anlegen einer Kultur auf Selektivmedien und eine biochemische Differenzierung notwendig. Bei bestimmten Mykosen kann der Ursprung mit Hilfe von gefiltertem UV-Licht (Wood-Licht) ermittelt werden.
Bei systemischen Mykosen ist das Anlegen einer Kultur möglich. Darüber hinaus können spezielle Antikörper gegen Pilzantigene im Blut des Patienten nachgewiesen werden. Auch ein Nachweis pilzlicher Antigene in Untersuchungsmaterialien ist durchführbar.
Der Nachweis von Protozoen erfolgt mikroskopisch oder über einen Antigen- bzw. Antikörpernachweis.
4.3 Nachweis und Identifizierung von Viren
4.3.1 Ausgangssituation und Fragestellungen
Der labordiagnostische Nachweis von Viren ist häufig zeitaufwändig, teuer und in der Therapie nicht zielführend. In vielen Fällen belässt man es daher bei der Bewertung von Symptomen. Die Gründe zur Durchführung virologischer Untersuchungen sind daher andere als die bei bakteriologischen:
• Differentialdiagnostische Ausschlüsse oder Nachweise (z. B. Frage nach Coxsackieviren bei Meningitis, wenn die Liquoruntersuchung keinen bakteriellen Nachweis erbrachte).
• Rückblickender Nachweis darüber, ob eine Virusinfektion stattgefunden hat (z. B. bei Röteln oder AIDS).
• Erfolgsüberprüfung aktiver Impfungen (z. B. Titernachweis nach Hepatitis B-Impfung).
• Nachweise, um Aufschlüsse über epidemiologische Geschehen zu bekommen (z. B. Influenzaepidemie) oder im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien.
4.3.2 Laboruntersuchungen
• Virusisolierung: Das Virus wird in geeigneten Wirtszellen (meist Zellkultur, seltener Versuchstier oder Hühnerembryo) angezüchtet.
• Direkter Virusnachweis: Viren lassen sich auch ohne Anzüchtung mit einem Elektronenmikroskop, über eine Antigenermittlung (mit Hilfe fluoreszierender Antikörper) oder über einen Erbgutnachweis (PCR) ermitteln.
• Serodiagnose: Mit Hilfe bekannter viraler Antigene werden im Blut Antikörper nachgewiesen, die darauf rückschließen lassen, dass eine bestimmte Virusinfektion vorliegt bzw. vorlag. In der Medizin kommt dieser Methode bei Viruserkrankungen die größte Bedeutung zu, da im Infektionsfalle anhand einer Blutprobe einfach und kostengünstig die wichtigsten Aussagen erbracht werden können.
Überprüfen Sie Ihr Wissen!
1. Wie sind die Entnahme und der Transport erregerhaltigen Materials durchzuführen?
2. Was ist beim Umgang mit erregerhaltigem Material zu beachten?
3. Welche Untersuchungen werden im Regelfall im bakteriologischen Labor zum Nachweis und zur Identifizierung von Bakterien durchgeführt?
4. Welche Laboruntersuchungen werden zum Nachweis lokaler Pilzinfektionen durchgeführt?
5. Welche Fragen stehen beim Nachweis und bei der Identifizierung von Viren im Vordergrund?
5 GRUNDLAGEN ZU REINIGUNG, DESINFEKTION UND STERILISATION
5.1 Definitionen
5.1.1 Fachbegriffe
Zur Bezeichnung einer keimschädigenden Wirkung finden folgende Fachbegriffe Verwendung:
Begriffe mit der Endung »zid« beziehen sich auf die Abtötung:
• Mikrobizid = abtötende Wirkung für Mikroorganismen
• Bakterizid = abtötende Wirkung für Bakterien
• Sporizid = abtötende Wirkung für bakterielle Sporen
• Fungizid = abtötende Wirkung für Pilze
• Levurozid = abtötende Wirkung für Hefepilze
• Viruzid = inaktivierende Wirkung für Viren
Begriffe mit der Endung »statisch« beziehen sich auf eine Wachstumshemmung, z. B.
• bakteriostatisch,
• virustatisch
usw.
5.1.2 Wirkungsbereiche
Keimabtötende Maßnahmen beziehen sich gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (RKI) auf vier Wirkungsbereiche:
A Abtötung vegetativer Keime einschließlich Mykobakterien (u. a. TBC), Pilze und Pilzsporen
B Inaktivierung von Viren
C Abtötung von Milzbrandsporen
D Abtötung der Erreger von Gasbrand, Gasödem und Wundstarrkrampf
Diese Einteilung berücksichtigt nicht, dass unbehüllte, »nackte« Viren in der Regel sehr viel schwerer zu inaktivieren sind, als umhüllte, obwohl beide Gruppen dem Wirkungsbereich B zugeordnet werden. Daher wird beim Wirkungsbereich B unterschieden, ob es sich um eine »begrenzt viruzide« (wirksam gegen umhüllte Viren) oder um eine »viruzide« Wirkung handelt (auch wirksam gegen nackte Viren).
5.1.3 Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
Die Begriffe Reinigung, Desinfektion und Sterilisation stehen in erster Linie stellvertretend für bestimmte Ansprüche:
• Mit dem Begriff Reinigung wird der Anspruch auf Rückstandsreduktion zum Ausdruck gebracht. Es besteht kein Anspruch auf Keimabtötung. Das bei der Reinigung geltende Prinzip der Abtragung wird auch als Elution bezeichnet.
• Bei der Desinfektion wird der Anspruch erhoben, Mikroorganismen der Wirkungsbereiche A und B in einer Größenordnung von fünf 10er-Potenzen abzutöten (von 100.000 überlebt max. einer. Das bei der Desinfektion geltende Prinzip der Abtötung wird auch als Elimination bezeichnet.
• Bei der Sterilisation besteht der Anspruch einer Abtötungsleistung von sechs 10er-Potenzen, die sich auf alle Wirkungsbereiche (A bis D) erstreckt. Auch hier handelt es sich um Elimination. Nach einer Sterilisation sind zwar keinerlei lebende Mikroorganismen mehr vorhanden, wohl aber bakterielle Rückstandsprodukte, sog. Endotoxine oder Pyrogene, die ggf. durch spezielle Maßnahmen beseitigt werden müssen. Erst dann ist das Sterilgut keim- und pyrogenfrei.
Zur Bedeutung der Begriffe »Elution« und »Elimination«:
• Bei Elution und Elimination handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Wirkprinzipien, bzw. Techniken, die sich zwar ergänzen, aber nicht ersetzen können. Insbesondere stellt die Desinfektion keine erweiterte Reinigung dar, wogegen die Sterilisation durchaus als Steigerung der Desinfektion gedeutet werden kann.
• Da Eliminationstechniken keine Abtragung von Rückständen bewirken, muss zur Erlangung einer Desinfektion oder Sterilisation meist eine Reinigung vorausgehen.
• Daneben kann auch eine Kombination beider Wirkprinzipien, eine »Sanitation«, vorteilhaft sein, indem Reinigungsmittel eine desinfizierende oder Desinfektionsmittel eine reinigende Wirkung vorweisen.
5.2 Der Sinnersche Kreis
Reinigung und Desinfektion sind zwei ähnliche Vorgänge, die sich jedoch durch den Anspruch an das Ergebnis (Rückstandsfreiheit bei der Reinigung und Keimreduktion bei der Desinfektion) unterscheiden. Welche Ergebnisse sich erzielen lassen, ist von folgenden vier Faktoren abhängig, die in ihrer Gesamtheit als Sinner’scher Kreis (Abb. 5.1) bezeichnet werden:
• Mittel (Wasser, Lösungsmittel und weitere Chemikalien)
• Mechanik bzw. Methode (Wischen, Bürsten, Waschen usw.)
• Temperatur
• Zeit bzw. Einwirkzeit, in welcher das Mittel, die Methode und die Temperatur einwirken

Abb. 5.1: Der Sinnersche Kreis.
Diese vier Faktoren stehen in einer Abhängigkeit zueinander. So kann z. B. eine Verlängerung der Einwirkzeit die Anwendung einer niedrigeren Temperatur oder einer materialschonenderen Mechanik oder eines anderen Mittels ermöglichen.
Die jeweilige Kombination aus Mittel, Mechanik, Zeit und Temperatur wird als Verfahren bezeichnet. Wahl und Gestaltung eines Reinigungs- oder Desinfektionsverfahrens sind abhängig von:
• dem gewünschten Ergebnis (Grad der Rückstandsfreiheit bzw. der Keimarmut)
• dem zu reinigenden bzw. desinfizierenden Material (z. B. Metall, Kunststoff, Haut),
• den jeweiligen Rückständen bzw. dem abzutötenden Keimpotential und
• Beschränkungen bzw. Erwartungen (z. B. Mittel darf nicht allergisieren, Einwirkzeit soll kurz sein usw.).
5.3 Reinigung
5.3.1 Definitionen
5.3.1.1 Dispersion, Suspension, Emulsion
• Eine Feinstverteilung von Stoffen in Wasser wird Dispersion genannt.
• Wenn es sich um die Feinstverteilung fester Stoffe handelt, spricht man von Suspension.
• Eine Feinstverteilung fett- und ölhaltiger Substanzen nennt man Emulsion. Substanzen, die eine Emulsion herbeiführen (wie z. B. Tenside) werden als Emulgatoren bezeichnet.
5.3.1.2 Schmutz
Als Schmutz bezeichnet man unerwünschte Rückstände oder Fremdstoffe, die sich auf Oberflächen (z. B. Flächen) oder in Substanzen (z. B. Nahrungsmittel) befinden bzw. ihnen anhaften. Schmutz unterscheidet sich hinsichtlich Haftung, Löslichkeit und Zusammensetzung.
5.3.1.3 Schmutzlösung, Schmutzbeseitigung
Bei einer Reinigung werden die Vorgänge Schmutzlösung und Schmutzbeseitigung unterschieden:
• Durch eine Schmutzlösung soll die Verbindung zwischen Schmutz und Oberfläche mittels mechanischer Bearbeitung (z. B. Bürsten, Ultraschall) und/oder chemischer Einwirkung aufgehoben werden.
• Dies ist eine häufige Voraussetzung, um mittels einer feuchten (z. B. durch Spülen, Feuchtwischen) oder trockenen (z. B. Fegen) Schmutzbeseitigung eine Reduktion oder Beseitigung von Schmutz bewirken zu können. Bei lose aufliegendem Schmutz kann dagegen auf eine Schmutzlösung verzichtet werden.
5.3.2 Reinigungsmittel
Für eine Schmutzlösung ist in der Regel ein Reinigungsmittel notwendig, bei dessen Auswahl einige Unterschiede und Aspekte zu berücksichtigen sind:
• Je nach Beschaffenheit des zu lösenden Schmutzes enthalten Reinigungsmittel verschiedene Inhaltsstoffe, sodass tensidhaltige, enzymatische, lösungsmittelhaltige und spezielle Reiniger zur Wahl stehen.
• Anhand des pH-Wertes können saure, neutrale und alkalische Reiniger unterschieden werden.
• Steht das Anwendungsgebiet im Vordergrund, differenziert man z. B. zwischen Haut-, Hände-, Flächen-, Sanitär- oder Instrumentenreinigern.
• Hinsichtlich des Verfahrens gibt es Reiniger für manuelle und für automatische Verfahren.
Häufig verwendete Reinigungssubstanzen sind:
• Tenside: Tenside sind chemische Verbindungen, die aus einem hydrophilen (wasserfreundlichen) und einem hydrophoben (wasserunlöslichen) Teil bestehen. Dadurch setzen Tenside die Oberflächenspannung von Wasser herab und verbessern die Emulgierbarkeit und damit die Lösbarkeit von öl- und fetthaltigen Rückständen.
• Enzyme: Enzyme (oder Fermente) wie Proteasen und Amylasen sind Eiweißmoleküle, die hochmolekulare, teilweise wasserunlösliche Stoffe, wie Stärke, Zellulose, Eiweiß, Blut usw. in niedermolekulare, wasserlösliche Stoffe aufspalten. Hierdurch werden anhaftende Rückstände ablösund dispergierbar. Die Anwendung von Enzymen ist an Temperaturen von 30–50 °C und einen neutralen bis leicht alkalischen PH-Wert gebunden.
• Säuren: Substanzen wie Salz-, Phosphor-, Amidosulfon-, Essig- und Ameisensäure oder Natriumhydrogensulfat können schwer lösbare Rückstände wie z. B. Kalk- oder Rostrückstände ab- und auflösen und alkalische Belastungen oder Rückstände neutralisieren.
• Alkalien: Alkalische Wirkstoffe wie Ammoniumhydroxid, organische Amine, Natriumkarbonate oder Natriumphosphate sind dazu geeignet, Öle, Fette, Wachse oder Kunststoffverbindungen (Polymere) zu entfernen.
• Gerüststoffe: Phosphate, Polycarbonsäuren und Polyacylate sind Begleitsubstanzen von Reinigungsmitteln, die als sog. Gerüststoffe das Wasser enthärten, die Schmutzablösung und das Dispergiervermögen verbessern und die Wirkstoffe in Reinigungsmitteln stabilisieren.
5.3.3 Wasser
Die meisten Reinigungsmittel werden in Verbindung mit Wasser eingesetzt. Somit bestimmt die Wasserhärte und -art maßgeblich das Ergebnis feuchter Reinigungsverfahren.
5.3.3.1 Wasserhärte
Entscheidend für die Reinigungseigenschaften von Wasser ist der Anteil gelöster Kalziumoxidionen, der als »Wasserhärte« bezeichnet wird. Je geringer der Härtebereich (also der Kalziumanteil) des Wassers ist, umso geeigneter ist es für die maschinelle Verarbeitung und für die Reinigung.
Die Wasserhärte wurde früher in Deutschen Härtegraden (°dH) und wird heute in Millimol/Liter (mmol/L) angegeben, wobei die Härtebereiche 1 – 4 unterschieden werden (siehe Tab. 5.1)
Härtebereich |
Millimol Gesamthärte je Liter |
°dh |
1 (weich) |
bis 1,3 |
bis 7,3 |
2 (mittel) |
1,3 bis 2,5 |
7,3 bis 14 |
3 (hart) |
2,5 bis 3,8 |
14 bis 21,3 |
4 (sehr hart) |
über 3,8 |
über 21,3 |
5.3.3.2 Wasserarten
Bei Reinigungsverfahren werden folgende Wasserarten unterschieden:
• Trinkwasser ist Wasser zum menschlichen Gebrauch, d. h. Wasser als Lebensmittel, zur Körperreinigung und zur Reinigung von Geschirr und Wäsche. Trinkwasser muss in Deutschland definierten Ansprüchen hinsichtlich mikrobiologischer und chemischer Beimengungen genügen, die in der Trinkwasserverordnung (TrinkWV) festgelegt wurden. Wegen des relativ hohen Mineralgehaltes ist Trinkwasser schlecht zur Reinigung geeignet.
• Destilliertes Wasser (Aqua destillata oder enthärtetes Wasser) ist Wasser, das durch einen Destillationsprozess, d. h. durch Verdampfen einer Flüssigkeit (Wasser) und Auffangen des Kondensates (Mineralien), gewonnen wird. Durch die Entfernung von Carbonat und Hydrogencarbonat wird relativ »weiches« Wasser erzeugt. Es verbleiben jedoch Kalzium-, Sulfat-, Chlorit- und andere Ionen.
• Voll entsalztes Wasser (VE-Wasser) ist Wasser, das über Verfahren wie Ionenaustausch, Umkehrosmose oder Elektrodialyse von allen Ionen befreit wurde.
• Sterilwasser ist Wasser, dessen mikrobielle Beimengungen durch Maßnahmen wie Filtration, Abkochen, Chlorierung oder Bestrahlung eliminiert wurden. Es ist anzumerken, dass Trinkwasser, destilliertes Wasser und voll entsalztes Wasser durchaus Mikroorganismen enthalten kann und darf.
5.3.4 Reinigungsverfahren
Grundsätzlich werden manuelle und automatische Reinigungsverfahren unterschieden:
• Bei einer manuellen Reinigung wird die Schmutzlösung und -beseitigung manuell unter Zuhilfenahme geeigneter Mittel, Geräte und Methoden durchgeführt. Beispiele: Fußbodenreinigung, Reinigung von Lagerungshilfsmitteln, Körperreinigung.
• Bei einer automatischen Reinigung wird das Reinigungsverfahren ohne manuelles Zutun in einer entsprechenden Maschine angewendet. Die Faktoren des Sinnerschen Kreises können in Automaten über Programmabläufe präzise bestimmt werden und sind dadurch reproduzierbar und dokumentierbar. Beispiele: Reinigung von Geschirr, Wäsche, chirurgische Instrumente. Reinigungsmittel zur manuellen Reinigung dürfen in der Regel nicht zur maschinellen verwendet werden und umgekehrt.
5.4 Desinfektion
5.4.1 Einteilung der Desinfektionsverfahren
Die Erbringung einer Desinfektionsleistung kann durch unterschiedliche Verfahren erfolgen:
• Physikalische Verfahren töten Keime entweder durch Hitze (thermisch) oder UV-Strahlen ab. Physikalische Verfahren erfolgen stets maschinell. Sie sind sicher, ökonomisch und mit weniger Wirkungsbeeinträchtigungen als chemische Verfahren verbunden und sind daher (wenn möglich) zu bevorzugen.
• Chemische Verfahren bewirken eine Denaturierung von Eiweiß (Eiweißgerinnung), Oxidation (Veränderung von Keimanteilen mit Hilfe von Sauerstoff) oder eine Störung des mikrobiellen Stoffwechsels. Die Durchführung erfolgt meist manuell. Als Mittel werden chemische Substanzen wie z. B. Aldehyde, Phenole, Alkohol verwendet.
• Bei chemothermischen Verfahren wird die Erkenntnis genutzt, dass viele chemische Desinfektionsmittel unter Anwendung relativ hoher Temperaturen (ca. 40–60 °C) schneller und gründlicher wirken. Die Durchführung erfolgt ausnahmslos automatisch.
5.4.2 Physikalische Desinfektionsverfahren
Physikalische Desinfektionsverfahren sind den physikalischen Sterilisationsverfahren ähnlich, erfassen jedoch nur die Wirkungsbereiche A bis B (Sterilisation dagegen A bis D). Im Einzelnen werden folgende Verfahren unterschieden:
• Abflammen ist vor allem im Laborbereich zur schnellen Desinfektion kontaminierter Instrumente üblich.
• Durch Einwirkung von heißem Wasser lassen sich sehr gute Desinfektionsergebnisse erzielen. Das dreiminütige Auskochen mit 0,5 % Sodazusatz bewirkt eine zuverlässige Abtötung der Keime in den Wirkungsbereichen A und B; bei Verlängerung der Einwirkzeit auch C. Im Krankenhaus wird u. a. Wäsche thermisch desinfiziert. Zur Reinigung, thermischen Desinfektion und Trocknung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesiezubehör oder OP-Schuhen gibt es Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG, Abb. 5.2), die programmgesteuert bei Temperaturen von 65–95 °C ein sehr zuverlässiges Desinfektionsergebnis liefern.
• Die Einwirkung von heißem Dampf ist zur physikalischen Desinfektion ideal und wird zur Desinfektion von Bettgestellen, Matratzen, Geräten, Saugern, Babyflaschen usw. angewandt. Meist lässt man strömenden Dampf von 100 °C, unter leichtem Überdruck fünf bis 15 Minuten in einem entsprechenden Desinfektionsgerät einwirken. Je nach Verfahren können die Wirkungsbereiche A bis C erfasst werden.
• Die Einwirkung von UV-Strahlen wird speziell bei der Wasseraufbereitung (z. B. in einigen Endoskopwaschmaschinen) genutzt und hat den Vorteil der kalten Anwendung.
5.4.3 Chemische Desinfektionsverfahren
Während physikalische Verfahren normalerweise vollautomatisch ablaufen, sind chemische Verfahren meist auf die manuelle Anwendung ausgerichtet. In der Praxis finden sie hohe Akzeptanz, da es für nahezu jede Indikation und jedes Material ein praktikables chemisches Verfahren gibt. Vor allem bei der Wahl chemischer Desinfektionsverfahren und -mittel müssen jedoch verschiedene Anforderungs- und Beeinträchtigungsfaktoren berücksichtigt werden.
5.4.3.1 Anforderungsfaktoren
Erwartungen an das Desinfektionsverfahren bzw. -mittel werden als Anforderungsfaktoren bezeichnet. Anforderungen bestehen hinsichtlich
• des Keimpotenzials: Je widerstandsfähiger der abzutötende Mikroorganismus und je höher die Ausgangskeimzahl ist, umso höher sind die Anforderungen an das Desinfektionsverfahren. D. h., die Auswahl der Wirkstoffe wird eingeschränkter, die Konzentration höher, die Einwirkzeit länger. Dies ist z. B. bei der Desinfektion nackter Viren (z. B. Noro-Viren) oder bakterieller Sporen zu berücksichtigen;
• der Neubesiedelung: Desinfektionsverfahren hinterlassen »Momentaufnahmen« einer drastisch reduzierten Keimbesiedelung. Je nach Verfahren bzw. Mittel kommt es früher oder später zur Neubesiedelung. Meist ist eine nachhaltige Wirkung (hohe Remanenz) bzw. eine langsame Neubesiedelung erwünscht;
• des zu desinfizierenden Materials: Chemische Verfahren sollen zu keiner Materialveränderung führen. Zu befürchten sind z. B. Oxidationen an Metallen, Ablösungen von Beschichtungen, Deformationen von Plastikartikel oder Verfärbungen von Textilien;
• einer möglichen Gesundheitsschädigung: Desinfektionsmittel sollen nicht gesundheitsschädigend in Erscheinung treten, d. h. keine Allergien auslösen, keine Haut- oder Schleimhautverletzungen hervorrufen und keine Augen- bzw. Atemwegsreizungen bewirken;
• der Umweltauswirkungen: Chemische Desinfektionsmittel können z. T. eine pH-Wert-Beeinflussung (z. B. Phenole), Überdüngung (z. B. Phosphatverbindungen) oder Vergiftung (z. B. Quecksilber) bewirken. Ferner können sie zu Geruchsbelästigungen führen;
• der Praktikabilität: Desinfektionsmittel sollen keine störenden Rückstände hinterlassen sowie schnell und einfach anzuwenden sein.
5.4.3.2 Beeinträchtigungsfaktoren
Sachverhalte, die die Qualität der Desinfektionsleistung herabsetzen, nennt man Beeinträchtigungsfaktoren. Beeinträchtigungen können bestehen hinsichtlich:
• der Umgebung bzw. einer evtl. Schmutzbelastung: Eiweißhaltige Rückstände, Talg, Fett oder Seifenreste können die Wirkung eines Desinfektionsmittels herabsetzen oder aufheben. Man spricht auch von »Eiweißfehler« bzw. »Eiweißzehrung« und »Seifenfehler«. Speziell bei Alkohol sind auch Wasserrückstände auf Grund des Verdünnungseffektes ein Beeinträchtigungsfaktor;
• der Verarbeitungstemperatur: Chemische Desinfektionsverfahren sind normalerweise auf einen Temperaturbereich von ca. 20 °C abgestimmt. Dieser Bereich kann zwar (in Grenzen) unterschritten, sollte aber nicht wesentlich überschritten werden, da sonst u. U. der Wirkstoff verdunsten kann und/oder sich schädliche Dämpfe entwickeln können;
• möglicher Handhabungsfehler: Eine Unterdosierung des Mittels, eine ungenügende Mechanik oder ein Unterschreiten der Einwirkzeit können das Desinfektionsergebnis in Frage stellen.
In der Praxis lassen sich die Anforderungen an chemische Desinfektionsverfahren selten lückenlos erfüllen, während die Beeinträchtigungsfaktoren ebenso selten vollständig ausgeschlossen werden können. Chemische Desinfektionsverfahren sind daher oft Kompromisse zwischen dem Wunsch und dem Machbaren.
5.4.3.3 Methoden
Je nach Material gilt bei der Bevorzugung der Methoden (Mechanik) die Regel, dass eine starke mechanische Einwirkung eine bessere Desinfektionsleistung bewirkt. Hieraus ergibt sich die Reihenfolge:
• Scheuern = Einarbeitung des Desinfektionsmittels mit Bürste, speziellem Lappen oder Schwamm (Sanitärbereich, Fußböden)
• Wischen = Auftragen des Desinfektionsmittels mit einem Lappen (Möbel, medizinische Geräte, Haut).
• Einmassieren = Einreiben mit Desinfektionsmittel (Hände)
• Waschen = Mechanische Bearbeitung des Gegenstandes in einer Desinfektionslösung (Textilien)
• Einlegen = Zu desinfizierenden Gegenstand in Desinfektionsmittel legen (Instrumente, Textilien)
• Benetzen = Auftragen von Desinfektionsmittel (z. B. mit Stieltupfer)
• Sprühen = Aufsprühen eines Desinfektionsmittels bis zur vollständigen Benetzung der Fläche in allen Fällen, in denen die übrigen Methoden nicht angewandt werden können
5.4.3.4 Mittel
Desinfektionsmittel können neben ihrer keimabtötenden Wirkung auch Gesundheitsschädigungen verursachen. Sie werden daher in zwei Gruppen unterteilt:
• Grobdesinfektionsmittel sind hautunverträgliche Mittel mit einem meist großem Wirkungsspektrum, die für Flächen, Fußböden, Instrumente usw. vorgesehen sind. Wirkstoffe können z. B. Aldehyde, Biguanide, Alkylaminen oder quartäre Ammoniumverbindungen (Quats, QAV) sein. Um eine Allergisierung durch Einatmen oder eine Hautschädigung durch Kontakte zu vermeiden, sollen bei manueller Anwendung von Grobdesinfektionsmittel keine warmen Lösungen verarbeitet und Schutzhandschuhe verwendet werden.
• Als Feindesinfektionsmittel bezeichnet man hautverträgliche Mittel, die meist nur ein eingeschränktes Wirkungsspektrum haben. Mit Feindesinfektionsmitteln können Haut und Hände desinfiziert werden. Als Wirkstoffe kommen hautsächlich Alkohol, Jod, Chlorhexidin und Quats zur Anwendung. Desinfizierende Substanzen zur Anwendung an Schleimhäuten oder Wunden werden als Antiseptika (siehe Kap. 5.4.3.6) bezeichnet und gehören nicht zu den Feindesinfektionsmitteln.
5.4.3.5 Häufig verwendete Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln
• Alkohole haben eine schnelle und zuverlässige Wirkung innerhalb des Wirkungsbereiches A, sind aber nur eingeschränkt viruzid. Sie hinterlassen keine unerwünschten Rückstände, sind hypoallergen und können als Haut-, Hände- und (begrenzt auf kleine Flächen) als besonders schnell wirksames Flächendesinfektionsmittel eingesetzt werden. Probleme gibt es hinsichtlich der Explosionsgefahr, der Geruchsbelästigung, der geringen Eiweißbelastbarkeit und der Beeinträchtigung durch Wasserrückstände (z. B. Sanitärbereich). Alkoholischen Desinfektionsmitteln werden oft Begleitsubstanzen, wie Rückfetter, Duftstoffe, Farbstoffe, Remanenzstoffe (Substanzen zur Steigung der Nachhaltigkeit), zugemischt, die als Rückstände verbleiben und/oder allergisieren können.
• Aldehyde sind grundsätzlich als Grobdesinfektionsmittel einzustufen. Sie haben eine zuverlässige Wirkung innerhalb der Wirkungsbereiche A und B und sind preiswert und umweltverträglich. In Gegenwart von Eiweißen verlieren sie an Wirkung und bewirken, dass eiweißhaltige Rückstände (z. B. Blut) an die zu desinfizierenden Flächen fixiert werden. Bei Hautkontakt oder Einatmung aldehydhaltiger Dämpfe kann es zu Reizungen und allergischen Reaktionen kommen (Handschuhe tragen!). Regelwerke des Arbeitsschutzes (TRGS 540) schreiben vor, dass aldehydhaltige Desinfektionsmittel wenn möglich durch andere Stoffe (z. B. Alkylamine oder Sauerstoffabspalter) ersetzt werden sollen.
• Oberflächenaktive Substanzen wie Amphotenside, Biguanide oder Quats bzw. QAV haben im Gegensatz zu den Aldehyden eine hervorragende Reinigungs-, aber nur eine mäßige Desinfektionswirkung, weshalb sie zur Wirkungssteigerung oft mit anderen Wirkstoffen kombiniert werden. Hinzu kommt eine geringe Eiweißbelastbarkeit. Auch hier gibt es Allergieprobleme, zumal oberflächenaktive Substanzen zur Erhöhung der Desinfektionsleistung meist mit anderen Substanzen, wie z. B. Aldehyden, kombiniert werden.
• Alkylamine wirken zuverlässig innerhalb des Wirkungsbereiches A, sind aber nur eingeschränkt viruzid. Durch ihre gute Reinigungswirkung und ihre Eiweißbelastbarkeit sind sie als Grobdesinfektionsmittel universell verwendbar. Nachteilig wirkt sich aus, dass sie z. T. klebrige Rückstände hinterlassen und nicht mit allen Plastikflächen materialverträglich sind. Auch Alkylamine können Allergien verursachen und sind daher als Grobdesinfektionsmittel einzustufen.
• Sauerstoffabspalter haben eine hohe und umfassende Wirksamkeit innerhalb der Wirkungsbereiche A und B, eine gute Materialverträglichkeit (Ausnahme: Metalle), eine gute Reinigungsleistung und sind hypoallergen. Als wichtigster Nachteil sind die Korrosionsförderung und die hohen Kosten zu nennen.
5.4.3.6 Antiseptika
Antiseptika sind Substanzen mit einer keimabtötenden oder keimhemmenden Wirkung, die im Zusammenhang mit Behandlungen von Wunden und Schleimhäuten im Sinne eines Desinfektionsmittels eingesetzt werden. Auf Grund der eingeschränkten Wirkung wird bei diesen Mitteln der Begriff »Dekontamination« verwendet.
Anwendungsgebiete der Antiseptika sind die Schleimhautantiseptik, (z. B. Dekontamination des Genitales zur transurethralen Katheterisierung) und die Wundantiseptik (z. B. Dekontamination von Wunden und Wundrändern im Zuge von Verbandwechseln).
Antiseptika werden meist als Arzneimittel eingestuft, unterliegen somit dem Arzneimittelrecht und verlangen eine sorgfältige Beachtung der Herstellerangaben.
Zu den modernen, leistungsfähigen und verträglichen Antiseptika zählen Substanzen wie Povidonjod (z. B. Braunol®), Octenidin (Octenisept®) und Polyhexanid (z.B. Lavasept®):
• PVP-Jod (Povidonjod) wird in wässriger (für Wunden und Schleimhaut) oder alkoholischer Lösung (für unverletzte Haut) verwendet. PVP-Jod hat ein breites Wirkungsspektrum und wirkt sehr nachhaltig. Obwohl PVPJodlösungen sehr viel schlechter als herkömmliche Jodlösungen über Häute und Wunden resorbiert werden, besteht dennoch die Gefahr einer allergischen Reaktion und einer Schilddrüsenbeeinflussung. Jodlösungen sind somit kontraindiziert bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen, bekannter Jodallergie, bei Schwangeren und Stillenden, Neugeborenen und Säuglingen, sowie vor und nach einer Radiojodanwendung.
• Polyhexanid zählt auf Grund der sehr guten Gewebsverträglichkeit und guten antibakteriellen Wirkung zu den am häufigsten verwendeten Antiseptika. Polyhexanide werden als wässrige Lösung zur antiseptischen Wundbehandlung, zur Schleimhautantiseptik und zur MRSA-Sanierung (siehe Kap. 15.3.3.5) benutzt. Sie sollen nicht im Mittel- und Innenohr, im Bereich von Knorpeln und Gelenken oder intraperitoneal verwendet werden.
• Octenidin ist ein rasch wirkendes, gut gewebsverträgliches Antiseptikum, welches eine zuverlässige Wirkung gegenüber Bakterien, Pilzen und Protozoen aufweist. Indikationen und Kontraindikationen von Octenidin sind mit denen von Polyhexaniden weitgehend identisch.
5.4.4 Chemothermische Desinfektionsverfahren
Bei chemothermischen Verfahren handelt es sich um maschinelle, programmgesteuerte Verfahren zur Desinfektion hitzeempfindlicher (thermolabiler) Geräte oder Instrumente, wie z. B. Endoskope. Meist können Automaten zur thermischen Desinfektion (siehe Abb. 5.2, Kap. 5.4.2) durch entsprechende Programmeinstellungen auch zur chemothermischen Desinfektion verwendet werden. Die Durchführung erfolgt in mehreren Phasen, wobei das Desinfektionsgut gereinigt, zwischengespült, desinfiziert, schlussgespült und evtl. auch getrocknet wird.
Die zur chemothermischen Desinfektion verwendeten Mittel basieren auf Aldehyden, Alkylaminen oder oberflächenaktiven Verbindungen, wurden aber für diesen Zweck speziell angepasst (z. B. hinsichtlich ihrer Schaumentwicklung). Manuell zu verwendende Desinfektionsmittel sind somit in der Regel nicht für Maschinen geeignet.
5.5 Organisation von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
Organisatorisch wird zwischen fortlaufender Reinigung und Desinfektion, Schlussdesinfektion und Raumdesinfektion unterschieden. Zur Auswahl der dafür erforderlichen Desinfektionsverfahren und -mittel gibt es Listen von Fachgesellschaften.
5.5.1 Fortlaufende Reinigung und Desinfektion
Bei der im pflegerisch-medizinischen Alltag praktizierten fortlaufenden Reinigung und Desinfektion handelt es sich um Routinemaßnahmen, die der Bildung von Keimreservoiren und Schmutzrückständen entgegenwirken sollen. Die Durchführung erfolgt als Händedesinfektion, Flächenreinigung und -desinfektion, Aufbereitung von Medizinprodukten usw.
Die Festlegung dieser Routinemaßnahmen erfolgt über einen Reinigungsund Desinfektionsplan (siehe Anhang B). Reinigungs- und Desinfektionspläne werden im Auftrag der Hygienekommission (siehe Kap. 8.1) erstellt, hängen zur Kenntnisnahme in den jeweiligen Stationen und Funktionsbereichen aus und entsprechen einer Dienstanweisung. Sie beschreiben, welcher Gegenstand mit welchem Mittel, mit welchem Verfahren und in welchen Fällen (Indikation) desinfiziert bzw. gereinigt werden soll und nimmt Bezug auf die erforderlichen Konzentrationen und Einwirkzeiten.
5.5.2 Schluss- und Raumdesinfektion
Im Gegensatz zur fortlaufenden Desinfektion stellt die Schlussdesinfektion eine Maßnahme dar, die nur aufgrund besonderer Veranlassungen (meist zum Abschluss einer Isolierungsmaßnahme) ergriffen und vom Hygienefachpersonal angeordnet wird. Sie wird in der Regel arbeitsteilig vom Pflegepersonal und vom Reinigungsdienst durchgeführt, um ein Patientenzimmer und seine Einrichtungsgegenstände zur Wiederbelegung vorzubereiten, nachdem es zuvor von einem Patienten mit einer ansteckungsfähigen Infektionserkrankung belegt war. Die Durchführungsvorgaben sollten im Hygieneplan (siehe Kap. 8.3.2) in Form eines Standards hinterlegt sein.
Im Zusammenhang mit seltenen meldepflichtigen Erkrankungen (z. B. Hämorrhagisches Fieber) kann vom Gesundheitsamt eine besonders durchgreifende Schlussdesinfektion, die sog. »Raumdesinfektion« mit speziellen viruziden bzw. sporiziden Desinfektionsmitteln angeordnet werden. Raumdesinfektionen werden von geschulten Desinfektoren durchgeführt.
5.5.3 Desinfektionsmittellisten
Um dem Anwender die Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel, Konzentrationen und Einwirkzeiten zu erleichtern haben es sich verschiedene Fachgesellschaften zur Aufgabe gemacht, Wirksamkeitstestungen vorzunehmen und darauf basierend Tabellen mit den betreffenden Rahmendaten als »Desinfektionsmittellisten« zu veröffentlichen.
• Die Auswahl der Desinfektionsmittel und Methoden zur fortlaufenden, routinemäßigen Desinfektion richtet sich im Klinikbereich nach der Desinfektionsmittelliste des Verbundes für angewandte Hygiene e.V. (VAH-Liste). Sie listet die für den klinischen Einsatz geeigneten Mittel, Konzentrationen, Verfahren und Einwirkzeiten zur Hände-, Haut-, Flächen-, Instrumenten- und Wäschedesinfektion auf. Hierbei ist zu beachten, dass den VAH-gelisteten Verfahren und Mitteln keine uneingeschränkte viruzide Wirkung bescheinigt wird. Die konkrete Auswahl erfolgt im Krankenhaus durch die Hygienekommission bzw. durch das Hygienefachpersonal (siehe Kap. 8.1 und 8.2). Die in den Reinigungs- und Desinfektionsplänen genannten Mittel sind in der Regel VAH gelistet.
• Zur Ergänzung der VAH-Liste wurde vom Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz eine Liste mit viruziden Mitteln, Konzentrationen und Einwirkzeiten herausgegeben (IHO-Liste), die jedoch nur bei bestimmten Sachlagen (z. B. Noro-Virus-Infektion) Anwendung findet.
• Bei bestimmten gefährlichen Infektionserkrankungen (z. B. Cholera) kommt auf Anordnung des Gesundheitsamtes die Liste der vom Robert-Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste) zum Einsatz. Da die RKI-Liste auch viruzide Verfahren und Mittel aufführt, ist die Auswahl der Mittel gegenüber der VAH-Liste begrenzter, die Konzentration meist höher und die Einwirkzeit länger.
• Speziell für den Lebensmittelbereich (Großküche etc.) gibt es eine Auflistung von betont geringtoxischen Flächendesinfektionsmitteln, die von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG-Liste) herausgegeben wird. Diese Mittel haben meist ein eingeschränktes Wirkungsspektrum und sind für den Pflegebereich nicht geeignet, wenn sie nicht auch zusätzlich in der VAH-Liste geführt sind.
5.6 Sterilisation
5.6.1 Fachbegriffe
Im Zusammenhang mit Sterilisationsmaßnahmen finden folgende Fachbegriffe Verwendung:
• Sterilisiergut |
= Material, das sterilisiert werden soll |
• Sterilgut |
= Material, das sterilisiert worden ist |
• Chargenzeit |
= Gesamter zeitlicher Ablauf einer Sterilisation |
• Abtötungszeit |
= Zeit, in der die Keimabtötung erfolgt (Teil der Chargenzeit) |
5.6.2 Sterilisationsverfahren
Grundsätzlich unterscheidet man physikalische und chemische Verfahren.
• Physikalisch = Filtration, Gamma-Sterilisation, Heißluftsterilisation und Autoklavieren
• Chemisch = Sterilisation mit Ethylenoxid oder Formaldehyd und Plasmasterilisation
Hinweis
Die Anwendung von Sterilisationsverfahren setzt eine spezielle Sach- bzw. Fachkunde des Anwenders voraus, die entsprechenden Kursen erworben werden muss. Daher wird in diesem, für den Schulunterricht gedachten Buch nur kurz auf dieses Thema eingegangen.
5.6.2.1 Sterilisation durch Filtration
Durch Filtration können Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen entfernt werden. Zum Einsatz kommt diese Methode vor allem bei der Medikamentenherstellung, der Erzeugung von sterilem Wasser, der Behandlung medizinischer Gase und der Filtrierung von Raumluft (z. B. in OP-Abteilungen).
5.6.2.2 Sterilisation mit Gamma-Strahlen
Die Sterilisation mit Gamma-Strahlen findet innerhalb der industriellen Herstellung von Sterilgut Anwendung. Sterile Einmalprodukte wie z. B. Einwegspritzen und -Kanülen, Infusionssysteme etc. wurden meist strahlensterilisiert.
5.6.2.3 Sterilisation mit trockener Hitze
Sterilisation mit trockener Hitze (Heißluftsterilisation) erfolgt bei einer Temperatur von 180 °C und 30 Minuten Abtötungszeit. Dieses Verfahren ist nur begrenzt anwendbar, da das Sterilisiergut eine hohe Temperaturstabilität haben muss. Die Heißluftsterilisation entspricht zudem nicht mehr dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik und wurde weitgehend durch die Dampfsterilisation verdrängt.
5.6.2.4 Sterilisation durch Autoklavieren
Bei der Dampfsterilisation (Autoklavierung, Abb. 5.3) wird das Sterilisiergut in einem geschlossenen Behältnis unter Luftabschluss (Vakuum) heißem, gespanntem (unter Druck stehendem) und gesättigtem (maximal feuchtem) Wasserdampf ausgesetzt. Sterilisiert wird mit 121 °C bei 20 Minuten oder mit 134 °C bei fünf Minuten Abtötungszeit. Die Abtötung wird durch das Kondensieren des Wasserdampfes an der Oberfläche des Sterilisiergutes erreicht. Bei sachgemäßer und kontrollierter Durchführung gilt dieses Verfahren im Krankenhaus und in der Praxis als beste Methode. Daher muss bei der Beschaffung sterilisierbarer medizinisch-pflegerischer Artikel auf die Autoklavierbarkeit geachtet werden, was bis auf wenige Ausnahmen auch gegeben ist.
5.6.2.5 Chemische Sterilisation
Chemische Verfahren finden zur Sterilisation thermolabiler, nicht autoklavierbarer Gegenstände Anwendung, wobei es im Krankenhaus nur sehr wenige Artikel gibt, auf die dies zutrifft (z. B. flexible Zystoskope). Die Durchführung ist im Vergleich zum Autoklavieren mit finanziellen und qualitativen Nachteilen behaftet. Gebräuchliche Sterilisationsmittel sind gasförmiges Formaldehyd und Ethylenoxid; daher wird auch von »Gassterilisation« gesprochen. Speziell beim hochtoxischen und explosiven Ethylenoxid muss beachtet werden, dass das Sterilgut am Ort der Sterilisation lange auslüften muss, ehe es zum Einsatz am Patienten kommt.
5.6.2.6 Plasmasterilisation
Bei der Plasmasterilisation werden bei einer Temperatur von 45 °C in einem Hochvakuum hochreaktive Hydroperoxy- und Hydroxyradikale erzeugt, indem Wasserstoffperoxid durch Anlegen eines hochfrequenten elektromagnetischen Feldes in den Plasmazustand (vierter Aggregatzustand) versetzt wird. Dies läuft vollautomatisch und ohne Freisetzung von Gefahrstoffen ab, sodass diese Methode immer mehr die chemische Sterilisation verdrängt.
Die Anwendbarkeit der Plasmasterilisation unterliegt jedoch Einschränkungen, da resorbierende Materialien nicht und Gegenstände mit blind endenden Innendurchmessern (Lumina) meist nicht sterilisiert werden können.
Überprüfen Sie Ihr Wissen!
1. Was kennzeichnen die Wortendungen »…zid« und »…statisch«?
2. Welche vier Wirkungsbereiche werden bei keimabtötenden Maßnahmen unterschieden und wie sind sie definiert?
3. Wann spricht man von einer »begrenzt viruziden« und wann von einer »viruziden« Wirkung?
4. Mit welchen Ansprüchen sind die Begriffe »Reinigung«, »Desinfektion« und »Sterilisation« verbunden?
5. Welche Wirkprinzipien werden durch die Begriffe »Elution« und »Elimination« vertreten?
6. Was ist der »Sinnersche Kreis« und auf welche vier Faktoren nimmt er Bezug?
7. Was bedeuten die Begriffe »Dispersion«, »Suspension« und »Emulsion«?
8. Welchen Einfluss hat die Wasserhärte auf die Reinigungseigenschaften von Wasser?
9. Welche Wasserarten werden bei Reinigungsverfahren unterschieden?
10. Welche drei Desinfektionsverfahren werden grob unterschieden?
11. Welche physikalischen Desinfektionsverfahren werden im Zusammenhang mit welchen Indikationen angewendet?
12. Welche Anforderungsfaktoren sind bei der chemischen Desinfektion zu berücksichtigen?
13. Durch welche Beeinträchtigungsfaktoren kann das Ergebnis einer chemischen Desinfektion in Frage gestellt werden?
14. Was ist der Unterschied zwischen einem Grob- und einem Feindesinfektionsmitteln?
15. Weshalb sollten Aldehyde – wenn möglich – durch andere Wirkstoffe ersetzt werden?
16. Was sind Antiseptika, wofür werden sie verwendet und worin unterscheiden sie sich von chemischen Desinfektionsmitteln?
17. Welche Substanzen finden heutzutage als Antiseptika Verwendung?
18. Welche Kontraindikationen sind bei der Anwendung von PVP-Jod zu beachten?
19. In welchen Fällen werden chemothermische Desinfektionsverfahren verwendet?
20. Was bezeichnet man als »fortlaufende Desinfektion« und in welchem krankenhausinternen Regelwerk sind die betreffenden Maßnahmen festgelegt?
21. In welchen Fällen werden Schlussdesinfektionen und in welchen Raumdesinfektionen durchgeführt?
22. Was ist der Unterschied zwischen Sterilisiergut und Sterilgut?
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842685567
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Januar)
- Schlagworte
- Altenheim Gesundheits- und Krankenpflege Gesundheitsberufe Hygiene Krankenhaus Krankenhausalltag Pflege