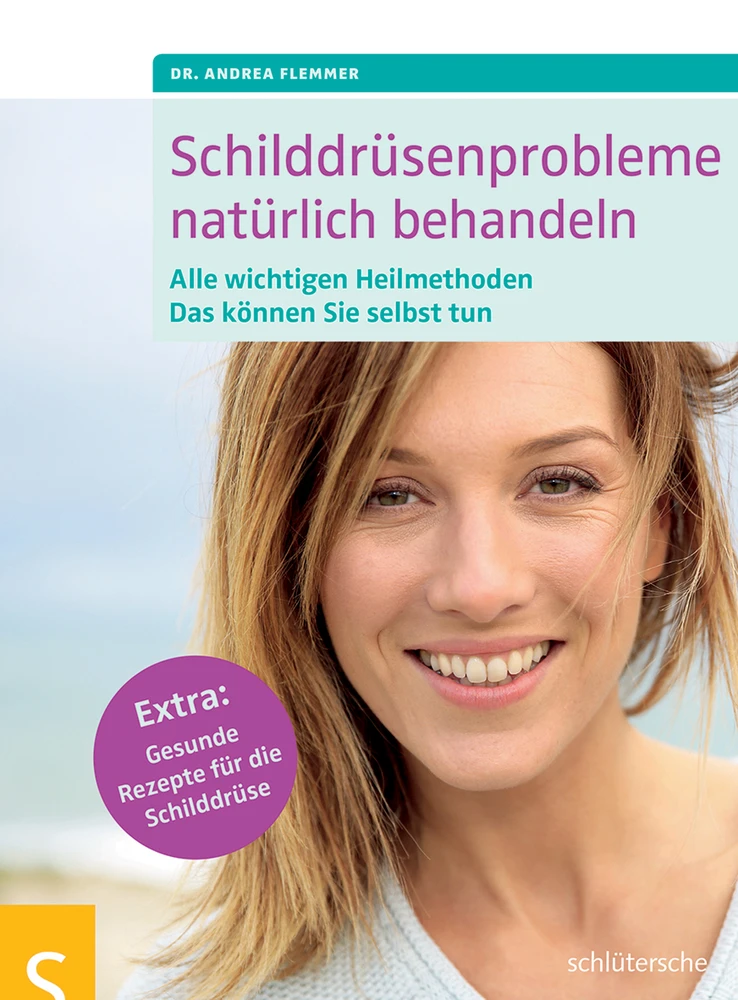Zusammenfassung
Probleme mit der Schilddruse können sich auf unterschiedliche Weise bemerkbar machen. Stoffwechsel- und Befindlichkeitsstörungen sind typisch für eine Uber- oder Unterfunktion, eine Vergrößerung der Schilddruse kann mit Engegefühl einhergehen, eine Entzündung mit Schmerzen. Mehr wissen – selbst aktiv werden
In der Regel erfordern Schilddrüsenerkrankungen die Behandlung durch einen spezialisierten Arzt. Die medizinische Therapie kann mit natürlichen Methoden aber effektiv unterstutzt werden. Fachkundig hat Dr. Andrea Flemmer ganzheitliche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für Schilddrüsenerkrankungen zusammengetragen. Der Leser erhalt eine Fülle wertvoller Tipps zur Selbsthilfe und Anregungen für eine schilddrüsengesunde Ernährung.
Mit diesem Buch erhalten Sie unverzichtbares Wissen:
- Jod – der lebensnotwendige Mineralstoff für die Schilddruse.
- Schilddruse und Ernährung.
- Heilkräuter bei leichter Schilddrüsenüberfunktion.
- Abnehmen durch Stimulation der Schilddruse.
- Homöopathische Mittel gegen Schilddrüsenbeschwerden.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
meine Großmutter lebte in Bayern, einem typischen Jodmangelgebiet, und wurde zweimal am Kropf operiert. Aber Jodmangel betrifft nicht nur die Bevölkerung in Bayern: Laut der Schilddrüsen-Liga Deutschland e. V. leiden etwa 30 Millionen Deutsche unter einer Fehlfunktion der Schilddrüse – häufig, ohne es zu wissen. Der Hauptgrund ist noch immer ein Mangel an Jod.
Viele wissen zunächst gar nicht, was die eigentliche Ursache ihrer Beschwerden ist. Etwa Frösteln mitten im Frühling, grundlos schlechte Laune, Gewichtszunahme, Übelkeit und ein Gefühl der Zerschlagenheit, manchmal begleitet von Nervosität oder Gliederschmerzen – daran kann auch die Schilddrüse schuld sein! Eine Überfunktion erkennt man in der Regel leicht, bei einer Unterfunktion kann es dauern, bis der Arzt darauf kommt.
Dieses Buch habe ich sowohl für Patienten mit Schilddrüsenproblemen und -erkrankungen geschrieben als auch für alle, die bisher nur vermuten, dass mit ihrer Schilddrüse etwas nicht in Ordnung sein könnte, und möglichen Erkrankungen vorbeugen möchten. Hier erhalten Sie eine Fülle wertvoller Tipps zur Selbsthilfe, Anregungen für eine schilddrüsengesunde Ernährung und erfahren alles über natürliche Therapieverfahren und die Möglichkeiten der Schulmedizin. Wenn Sie derart vorbereitet zum Arzt gehen, haben Sie die Gewähr für eine optimale Behandlung.
 | |
Hinweis Im Anhang finden Sie ein kleines Lexikon, in dem wichtige Fachbegriffe, die in diesem Buch häufig auftauchen, kurz erklärt werden. |
Dies wünscht Ihnen
Dr. Andrea Flemmer

DIE SCHILDDRÜSE – WICHTIG ZU WISSEN
Die Schilddrüse ist ein ziemlich kleines Organ, das für unseren Organismus aber eine umso größere Rolle spielt. Tatsächlich wären wir ohne sie nicht lebensfähig. In diesem ersten Teil des Buches erfahren Sie alles, was Sie über Aufbau, Funktion und Steuerung dieser hoch komplizierten Hormondrüse wissen müssen.
Kleines Organ, große Wirkung
Lage und Aufbau der Schilddrüse
„Ein Organ, das eigentlich für nichts nütze ist, sich aber überall einmischt“: Diesen Eindruck bekam ich im Laufe meines Lebens, wenn immer wieder mal ein Arzt überprüfte, ob meine Schilddrüse richtig funktionierte. Tatsächlich gibt es kaum eine Zelle im Körper, die nicht von den Schilddrüsenhormonen beeinflusst wird. Die Schilddrüsen-Liga Deutschland drückt es so aus: „Die Schilddrüse ist eine kleine Hormondrüse, von der viele Menschen nichts wissen. Sie sitzt vor dem Kehlkopf und normalerweise spürt man sie nicht. Obwohl von großer Bedeutung, wird sie erst wahrgenommen, wenn sie mit ihrem rebellischen Verhalten auf sich aufmerksam macht.“
 |
|
Der lateinische Fachausdruck für Schilddrüse lautet Glandula thyreoidea. |
Die Schilddrüse sieht aus wie ein Schmetterling mit aufgeklappten Flügeln. Sie sitzt an der Vorderseite des Halses, unterhalb des sogenannten Schildknorpels, im Volksmund auch „Adamsapfel“ genannt, einem Teil des Kehlkopfes. Sie besteht aus drei Teilen: zwei Lappen, jeweils links und rechts vom Kehlkopf, und einem Verbindungssteg, dem Isthmus. Letzterer liegt unter dem Schildknorpel der Luftröhre. Die beiden Seitenlappen beginnen auf der Vorderseite des Halses und umschließen fast die gesamte Luftröhre hufeisenförmig. Dieser Lage hat die Drüse ihren Namen zu verdanken: Einem Schild ähnlich liegt sie, umgeben von Halsmuskeln, vor der Luftröhre.
Mit Blut wird sie über je zwei obere und untere Arterien versorgt. Sie wiegt bei Frauen etwa 15 bis 18 Gramm und bei Männern 20 bis 25 Gramm, bei der Geburt sind es nur 2 Gramm. Ist sie gesund, kann man die Schilddrüse von außen weder sehen noch ertasten.
 |
|
Eine gesunde Schilddrüse ist von außen nicht zu sehen. |
Die Luftröhre bewegt sich beim Schlucken hin und her. Diese Bewegung macht folglich auch die Schilddrüse mit. Ist die Drüse vergrößert, kann ein erfahrener Arzt deshalb bereits während des Schluckens eine Verdickung unterhalb des Kehlkopfes erkennen, die parallel mit den Schluckbewegungen ihre Lage ändert.
Die beiden Seitenlappen bestehen aus kleinen Drüsenläppchen, den sogenannten Lobuli. Diese bestehen wiederum aus winzigen Bläschen, den Follikeln, die von den Schilddrüsenzellen, den Thyreozyten, gebildet werden. Die Schilddrüsenzellen umschließen den entstehenden Hohlraum. Diese Follikel machen 80 Prozent des Gewebes aus und enthalten das sogenannte Kolloid. Darin findet sich das Schilddrüseneiweiß Thyreoglobulin sowie Kohlenhydrate und Fett. Dort werden auch die Schilddrüsenhormone gespeichert. Der Hormonvorrat der Follikel reicht bei normalem Bedarf etwa sechs bis acht Wochen aus.

Unsere Schilddrüse ist eine wichtige Hormondrüse.
Zwischen den Follikeln liegen die sogenannten C-Zellen (siehe Abschnitt „Die Hormone der Schilddrüse“). Je nach Funktionszustand der Schilddrüse ändert sich
• die Größe der Schilddrüsenzellen
• die Menge des Thyreoglobulins
• die Größe der Follikel
Die Aufgaben der Schilddrüse
Die Hauptaufgaben der Schilddrüse sind
• die Speicherung von Jod
• die Bildung der Schilddrüsenhormone Tetrajodthyronin (T4) und Trijodthyronin (T3) sowie des Hormons Kalzitonin (TC)
Die Drüse ist lebensnotwendig, denn ohne sie würde es in unserem Körper drunter und drüber gehen. Sie beeinflusst unseren gesamten Organismus: Herz-Kreislauf-System, Verdauung, Knochenaufbau und sogar die Psyche. Sie steuert außerdem weitere Stoffwechselvorgänge wie Wachstum, Energiestoffwechsel und damit einen reibungslosen Ablauf der Prozesse von Herz, Kreislauf und Muskulatur. Ursache sind die verschiedenen Hormone, die von der Schilddrüse jeden Tag gebildet und ausgeschüttet werden.
 |
|
Die Schilddrüse ist unsere größte Hormondrüse. Ohne ihre Hormone wären wir nicht lebensfähig. |
Wie wichtig diese Drüse ist, sieht man allein schon daran, dass in etwa 1,5 Stunden unser gesamtes Blut einmal durch die Schilddrüse fließt. Damit ist sie etwa vier- bis fünfmal stärker durchblutet als z. B. unsere Nieren.
Die Rolle der Schilddrüsenhormone
Die Schilddrüsenzellen bilden täglich die Schilddrüsenhormone. Diese werden meist vorübergehend an die Follikel abgegeben. Dort werden sie an das Speichereiweiß gebunden, das dann Thyreoglobulin genannt wird. Werden nun vermehrt Schilddrüsenhormone im Blut benötigt,
• wird das Thyreoglobulin wieder in die Schilddrüsenzellen aufgenommen,
• dort werden die Schilddrüsenhormone abgespalten und
• direkt in die reichlich vorhandenen Blutgefäße der Schilddrüse abgegeben.
 |
|
Jeder Mensch hat seinen eigenen, optimalen Schilddrüsenhormonspiegel. |
Tetrajodthyronin (T4) und Trijodthyronin (T3)
Die Bildung der Schilddrüsenhormone erfolgt in Stufen. An den Eiweißbaustein Tyrosin wird mithilfe des Enzyms Schilddrüsenperoxidase (TPO) Jod angelagert, das vorab von den Schilddrüsenzellen aus dem Blut aufgenommen wurde. Es entsteht das Tetrajodthyronin oder Thyroxin (T4) und das Trijodthyronin (T3).
Die Schilddrüse bildet täglich etwa 90 bis 100 μg (Mikrogramm) T4 und 10 μg T3. Tatsächlich aktiv in den Zellen ist fast nur das T3. Das T4-Hormon muss erst ein Jodatom abspalten, damit es als T3 in die Zellen aufgenommen und aktiv werden kann. Sein Vorteil ist, dass es sich besser als T3 über den ganzen Organismus verteilen kann. Damit garantiert es eine ausreichende Versorgung aller Körperzellen.
Tatsächlich stammen nur etwa 10 Prozent des im Blut befindlichen T3 direkt aus der Schilddrüse. Der größte Teil – also 90 Prozent – wird von den Zellen der Organe und allen Körperzellen, die das Hormon benötigen, aus T4 gebildet und aufgenommen.
Das Kalzitonin und die C-Zellen
Zwischen den Follikeln der Schilddrüse liegen die sogenannten C-Zellen, die 20 Prozent der Schilddrüsenzellen ausmachen. Diese Drüsenzellen liegen verstreut in der Schilddrüse. Sie produzieren das Hormon Kalzitonin (Thyreocalcitonin, TC), das den Kalziumstoffwechsel im Körper reguliert. TC ist auch ein Tumormarker zur Entdeckung des C-Zell-Tumors und dessen Metastasen bzw. Rezidiven. Dann ist der Kalzitoninwert wie auch bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse erhöht.
 |
|
Kalzitonin wird bei Kalziumüberschuss im Blut ausgeschüttet und sorgt dafür, dass mehr Kalzium mit dem Harn ausgeschieden, seine Freisetzung aus den Knochen gehemmt und mehr davon ins Skelett eingebaut wird. Damit trägt es zur Stabilität der Knochen bei und wird demzufolge als Medikament gegen Osteoporose verordnet. Ist dagegen die Kalziumkonzentration im Blut gering, ist auch Kalzitonin kaum nachweisbar. Zusätzlich beeinflussen Hormone des Magen-Darm-Trakts seine Ausschüttung. Dazu kommt, dass Kalzitonin bei verschiedenen Schmerzsyndromen (komplexes regionales Schmerzsyndrom) schmerzlindernd wirkt.
Der Normalwert bei Frauen liegt bei bis zu 5 ng/l (Nanogramm pro Liter), bei Männern bei bis zu 8,4 ng/l. Die Referenzwerte sowie die ermittelten Werte können sich je nach Labor stark unterscheiden. Hinzu kommt, dass es starke tageszeitliche und jahreszeitliche Schwankungen ohne Krankheitswert gibt. Bevor Sie sich durch abweichende Ergebnisse verunsichern lassen, fragen Sie Ihren Arzt nach dem Grund dafür. Einzelne Laborwerte alleine sind zudem meistens wenig aussagekräftig. Sie müssen im Zusammenhang mit anderen Werten und wiederholt erfasst werden.
Die Steuerung der Hormonproduktion
Die gebildete Hormonmenge wird an die jeweiligen Bedingungen angepasst. Würde die zentrale Regulierung ausfallen, könnte die Schilddrüse nur noch etwa 60 Prozent des normalen Bedarfs an T3 und T4 produzieren.
Gesteuert wird die Produktion der Schilddrüsenhormone über den Hypothalamus, der im Zwischenhirn liegt. Der Hypothalamus ist ein Teil des Zwischenhirns und dient als oberstes Regulationszentrum für alle vegetativen und hormonellen Vorgänge. Diese Zentrale regt bei einem Mangel an Schilddrüsenhormonen die Ausschüttung des Thyreotropin-Releasing-Hormons (TRH) an. Dieses Hormon wiederum regt die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) zur Freisetzung des Hormons Thyreotropin (TSH) an, welches seinerseits die Schilddrüse zur Produktion von T3 und T4 anregt. Die Hypophyse besitzt T3-Fühler. Sind genügend Schilddrüsenhormone im Blut, wird weniger TSH freigesetzt und die Schilddrüse produziert weniger Hormone. Im umgekehrten Fall wird mehr TSH ausgeschüttet und die Schilddrüse bildet mehr Hormone und setzt sie aus den Schilddrüsenfollikeln frei. Durch das Zusammenspiel zwischen Hypophyse und Schilddrüse wird der Hormonspiegel im Körper reguliert und hält ein konstantes Niveau.
 |
|
TRH = Thyreotropin-Releasing-Hormon = Hormon, das Thyreotropin freisetzt |
 |
|
Thyreotropin TSH = Thyroidea-stimulierendes Hormon, also Schilddrüsenantreibendes Hormon |
Der erste Schritt bei einer Schilddrüsenuntersuchung ist es dann auch, den TSH-Wert im Blut zu bestimmen. Ist dieser Wert normal, kann eine Störung praktisch ausgeschlossen werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Konzentration von freiem T3 und freiem T4 gemessen.
Die beiden Schilddrüsenhormone T3 und T4 werden bei Bedarf von ihrem Bildungsort ins Blut abgegeben. Etwa 0,3 Prozent der Schilddrüsenhormone befinden sich frei im Blut. Man nennt sie auch freies T3 (abgekürzt fT3) und freies T4 (fT4). Nur diese Form der Hormone gelangt in die Körperzellen. Werden dem Blut diese Hormone entnommen, so wird augenblicklich gebundenes Hormon von den Transporteiweißen freigesetzt. Die Quote von 99 Teilen gebundener Schilddrüsenhormone zu einem Teil ungebundener Hormone bleibt immer in etwa gleich.
 |
|
Die Hormone T3 und T4 werden bei Bedarf ins Blut abgegeben. |
Die Aufgaben der Schilddrüsenhormone
In unserem Körper haben alle Zellen einen gewissen Grundumsatz, den man zur Aufrechterhaltung der normalen Zellfunktion benötigt. Das bedeutet, dass die Zellen Energie produzieren, die sie für andere Aufgaben benötigen, z. B. stellen die inneren Drüsen Hormone her, die Herzmuskelzellen müssen sich für den Herzschlag rhythmisch zusammenziehen und die Nieren scheiden schädliche Stoffe aus. Die spezifischen Aufgaben der jeweiligen Zellen werden durch den Grundumsatz gewährleistet. Bei einem höheren Grundumsatz steigert sich auch die Produktivität der einzelnen Zellen, bei einem niedrigen geht alles etwas langsamer.
Dieser Grundumsatz wird von den Schilddrüsenhormonen gesteuert. Mehr Schilddrüsenhormone haben einen gesteigerten Grundumsatz zur Folge, weniger einen geringeren. Damit ist auch der Energieverbrauch der Zellen verknüpft. Je höher der Grundumsatz, desto mehr Energie und Sauerstoff verbrauchen sie. Dabei ist der Energieverbrauch gleichzusetzen mit Kalorienbedarf, der dann durch erhöhte Nahrungsaufnahme gedeckt werden muss.
 |
|
Schilddrüsenhormone steuern unseren Grundumsatz. |
Während der Entwicklung vom Fetus bis zum Übergang der Pubertät ins Erwachsenenalter haben die Schilddrüsenhormone außerdem einen direkten positiven Einfluss auf die Entwicklung der Knochen und des Gehirns.
Tatsächlich werden alle Zellen des Körpers und alle Organe direkt durch die Schilddrüsenhormone beeinflusst. Das betrifft sowohl unser Herz als auch die Muskel- und Nervenfunktionen, das Gehirn und die Knochen bis hin zu Haut und Haaren, die direkt unter dem anregenden Einfluss der Schilddrüse stehen. Die Schilddrüsenhormone regulieren die Körpertemperatur, wirken sich auf den Blutdruck und das körperliche Leistungsvermögen aus. Sie beeinflussen den Darm und seine Verdauung, die geistige Leistungsfähigkeit, die Konzentration und die Stimmung. Sie regulieren den Wasserhaushalt, haben Auswirkungen auf das Immunsystem, die Fruchtbarkeit bei Mann und Frau sowie den Schwangerschaftsverlauf. Durch diese Hormone werden auch der Stoffwechsel der Nervenzellen und die Gehirntätigkeit beeinflusst. Auf diesem Wege hat die Schilddrüse auch einen deutlichen Einfluss auf die Psyche und das seelische Gleichgewicht.
Sehen wir uns z. B. das Herz an: Bei einer Schilddrüsenüberfunktion leiden die Betroffenen unter einem zu schnellen Herzschlag bis hin zu Herzrasen und Rhythmusstörungen. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion schlägt das Herz langsamer. Auch unsere Reflexe werden beeinflusst: Bei Unterfunktion sind sie verlangsamt, bei Überfunktion zu schnell. Der Grund: Die Schilddrüsenhormone beeinflussen die Geschwindigkeit der Signalübertragung vom Nerv auf den Muskel.
 |
|
Die Schilddrüse beeinflusst auch unseren Herzschlag. |
T3 und T4 steigern den Grundumsatz sowie den Gesamtstoffwechsel. Beim Gesunden dienen sie der Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz. Man nennt sie aufgrund ihrer Wirkung auch die „Peitsche des Organismus“. Sie fördern den Eiweißaufbau, wie z. B. den der Muskulatur. Man spricht von einer „anabolen“, also aufbauenden Wirkung. Eine Mindestmenge an Schilddrüsenhormonen ist für die Entwicklung der verschiedenen Organe und besonders des zentralen Nervensystems Voraussetzung. Durch Anregung der Wärmeproduktion wird die Körpertemperatur konstant gehalten.
Die Schilddrüsenhormone wirken nur auf die Körperzellen, die einen speziellen T3-Rezeptor haben. Bildlich kann man sich das wie ein Schloss vorstellen: Das Hormon T3 ist der Schlüssel und der Rezeptor das Schloss. Passt der Schlüssel, also das Hormon, zum Rezeptor, dem Schloss, so wird T3 aufgenommen und kann seine Wirkung in der Zelle entfalten. Seltsamerweise befinden sich die Rezeptoren am Zellkern: der Schaltzentrale der Zelle. Hat das Schilddrüsenhormon an seinem „Schloss“ (dem Rezeptor) angedockt, so läuft eine ganze Kaskade an Stoffwechselvorgängen ab, die schließlich zu der spezifischen Wirkung der Schilddrüsenhormone in den verschiedensten Organen und Gewebearten führen.
Schilddrüsenhormone haben Einfluss auf:
• das Herz-Kreislauf-System: Wärmeregulation, Herzfrequenz, Blutdruck
• den Magen-Darm-Trakt: Körpergewicht und Energieumsatz, Verdauung, Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß
• das Fortpflanzungssystem: Fruchtbarkeit, Schwangerschaft
• das äußere Erscheinungsbild: Haut und Haare
• das Nervensystem: Leistungsfähigkeit und Psyche
Weitere wichtige Faktoren
Die Nebenschilddrüsen
Damit das Ganze nicht zu einfach wird, gibt es auch noch die Nebenschilddrüsen, auch Epithelkörperchen genannt. Sie bestehen aus vier linsenförmigen kleinen Körperchen an den Polen der Schilddrüse, sind etwa so groß wie ein Pfefferkorn und ihre Lage wechselt. Die Epithelkörperchen sind nur schwer von den beiden Schilddrüsenlappen zu unterscheiden und arbeiten komplett unabhängig von der Schilddrüse.
Die Nebenschilddrüsen produzieren das sogenannte Parathormon, den Gegenspieler des Kalzitonins. Es hebt den Kalziumspiegel im Blut an, das heißt, es macht sozusagen das Kalzium parat, indem es dafür sorgt, dass aus verschiedenen Organen und Geweben Kalzium freigesetzt wird. Es verbessert die Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung und fördert die Kalziumaufnahme über den Darm. Es setzt Kalzium sowie Phosphat aus den Knochen frei und fördert die Phosphatausscheidung über die Nieren.
 |
|
Die Nebenschilddrüsen produzieren das Parathormon, das den Kalziumspiegel im Blut anhebt. |
Bei einer Schilddrüsenentfernung im Rahmen einer Operation besteht die Gefahr einer lebenslangen Unterversorgung mit Kalzium, da es durch das fehlende Parathormon nicht mehr ausreichend aufgenommen wird. Dann müssen die Patienten lebenslang Kalziumpräparate zu sich nehmen und auch Vitamin D.
Einflüsse anderer Faktoren und Wechselwirkungen
Da wir gerade bei Hormonen sind: Auch eine Wechselwirkung mit anderen Hormonen sollte man in Betracht ziehen. So weiß man, dass Östrogen die Schilddrüsenfunktion bremsen kann und Progesteron schilddrüsenabhängig funktioniert. Die Schilddrüse muss normal funktionieren, damit Progesteron in entsprechend benötigten Mengen produziert werden kann.
Wenn Sie als Frau einen unregelmäßigen Monatszyklus haben, sollten Sie eine Basaltemperatur-Kurve anlegen, also über einen ganzen Zyklus hinweg täglich morgens unter der Achsel die Temperatur messen, notieren und dann dem Arzt zeigen. Diese Messung sollte Ihre erste morgendliche Tätigkeit sein, das heißt: sofort nach dem Wachwerden und noch vor dem Aufstehen messen, dabei den ersten Tag der Monatsblutung speziell hervorheben.
 |
|
Frauen mit unregelmäßigem Zyklus sollten eine Basaltemperatur-Kurve anlegen. |
Aber auch Männer profitieren von dieser Methode: Bei ihnen reichen in der Regel zehn bis 14 Tage, um einen Einfluss der Schilddrüse zu erkennen. Dabei sollte man Besonderheiten wie Erkältung, ungewöhnliche körperliche Belastungen oder vermehrten Alkoholgenuss mit beliebigen Markierungen kennzeichnen.
Auch das Hormon Somatostatin, der Nervenbotenstoff Dopamin sowie Glukokortikoide beeinflussen die Schilddrüse: Sie hemmen die Freisetzung von TSH.
Kältereize, psychische und körperliche Belastungen führen zu einer vermehrten Bildung von Schilddrüsenhormonen. Dagegen haben Wärmereize und Ruhe den gegenteiligen Effekt.
KRANKHEITEN UND PROBLEME
Schilddrüsenerkrankungen entwickeln sich meist schleichend und äußern sich durch wenige typische Beschwerden. Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Probleme und Erkrankungen der Drüse sowie die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. Manche Probleme lassen sich bereits im Vorfeld einer Erkrankung angehen.
Schilddrüsenerkrankungen und ihre konventionelle Behandlung
Schilddrüsenerkrankungen sind bei uns die häufigsten Stoffwechselerkrankungen, wenn man den Jodmangelkropf mit einbezieht. Der Grund dafür ist vor allem der extreme Jodmangel in unseren Böden. Aber auch Selen wird zu wenig aufgenommen. Beides erschwert der Schilddrüse die Arbeit. Als weitere Ursachen von Schilddrüsenkrankheiten kommen Immunkrankheiten, Entzündungen oder Vererbung infrage.
 |
|
Ein Mangel an Jod und Selen macht der Schilddrüse die Arbeit schwer. |
Schweizer und deutsche Ärzte gehen davon aus, dass trotz Salzjodierung und, im Vergleich zu früher, häufigeren Seefischmahlzeiten immer noch etwa ein Drittel der Bevölkerung eine Schilddrüsenvergrößerung aufweist. Doch selbst wenn eine Schilddrüsenuntersuchung messbare Veränderungen zeigt, merken die Betroffenen zunächst nichts davon.
Weniger häufig treten Knoten oder eine Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose) auf und noch seltener eine Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose). Frauen sind stärker betroffen als Männer.
Viele der Symptome einer Schilddrüsenerkrankung sind unspezifisch und kommen auch bei anderen Erkrankungen vor, z. B. Schlafstörungen, chronische Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Gehen Sie deshalb im Zweifelsfall zum Arzt, denn nur er kann eine verlässliche Diagnose stellen.
An der folgenden Tabelle können Sie ablesen, welche Arten von Schilddrüsenerkrankungen es gibt. Am häufigsten kommt der Kropf vor, am seltensten ein Tumor; die anderen Erkrankungen liegen, was die Häufigkeit ihres Auftretens angeht, dazwischen.
Schilddrüsenerkrankungen im Überblick
| KRANKHEIT | ÜBLICHES ERKRANKUNGSALTER | HÄUFIGKEITSVERTEILUNG FRAUEN/MÄNNER |
| Jodmangelkropf | Pubertät, Schwangerschaft und Wechseljahre | 3 zu 1 |
| Schilddrüsenunterfunktion: angeboren erworben | von Geburt an eher Ältere | 1 zu 1 5 zu 1 |
| Schilddrüsenüberfunktion | Jede Altersstufe, häufiger bei älteren Menschen | 5 zu 1 |
| Morbus Basedow | eher Jüngere | 5 zu 1 |
| Schilddrüsenentzündungen | unabhängig vom Alter | 5 zu 1 |
| Bösartige Tumore | Jede Altersstufe, bevorzugt zwischen 30 und 60 Jahren | 3 zu 1 |
Sollte man sich generell auf Schilddrüsenprobleme untersuchen lassen? Schilddrüsenerkrankungen sind zu einem gewissen Teil erblich. Kommen in Ihrer Familie zahlreiche Fälle von Fehlfunktionen oder Jodmangelkropf vor, kann eine Vorsorgeuntersuchung auch ohne akute Symptome sinnvoll sein. Dann sollten Sie mit Ihrem Hausarzt sprechen. Ab dem 40. Lebensjahr sollten Sie sich generell in regelmäßigen Abständen von ein bis zwei Jahren untersuchen lassen. Da diese Untersuchungen jedoch nicht zu den normalen Vorsorgeleistungen der gesetzlichen Krankenkassen zählen, müssen Sie sie eventuell selbst bezahlen, wenn keine medizinische Notwendigkeit für die Durchführung besteht.
Wie beugt man Schilddrüsenerkrankungen vor? Das Wichtigste, um einer Schilddrüsenerkrankung vorzubeugen, ist die ausreichende Versorgung mit Jod. Das heißt konkret:
• Verwenden Sie Jodsalz.
• Essen Sie zwei Meeresfisch-Mahlzeiten in der Woche.
• Verzichten Sie aufs Rauchen.
 |
|
Wie häufig sind Schilddrüsenerkrankungen? Die „Papillon-Studie“ – eine der weltweit größten Bevölkerungsstudien – ergab bei 100.000 untersuchten Deutschen folgende Häufigkeiten:
• Jeder dritte Erwachsene weist krankhafte Veränderungen an der Schilddrüse auf, ohne davon zu wissen.
• Jeder vierte Erwachsene hat Knoten in der Schilddrüse, ältere häufiger als jüngere. Bei fast bei jedem zweiten über 65-Jährigen sind Knoten in der Schilddrüse nachweisbar, Frauen sind etwa viermal so häufig betroffen wie Männer.
• Die häufigste Erkrankung ist eine vergrößerte Schilddrüse, der sogenannte Kropf; dessen Ursache ist meist ein chronischer Jodmangel.
• Viele Patienten werden an der Schilddrüse operiert oder mit einer Radiojodtherapie behandelt, weil ihre Schilddrüsenerkrankung zu spät erkannt wurde.
 |
|
Jeder vierte Erwachsene hat Knoten in der Schilddrüse. |
Die Untersuchung der Schilddrüse
Damit ein Arzt die Ursache einer Schilddrüsenkrankheit herausfinden und die richtige Diagnose stellen kann, muss er das Organ untersuchen bzw. weitere spezielle Untersuchungen anordnen.
Als erste Maßnahme entnimmt er in der Regel Blut, um die Laborwerte zu bestimmen. Hier sind vor allem die Hormonwerte von Bedeutung. Die Normalwerte für die einzelnen Hormone finden Sie in der folgenden Tabelle. Ferner kann das Blut auf Thyreoglobulin sowie auf Antikörper untersucht werden.
Die gängigen Untersuchungen auf einen Blick
• Blutuntersuchung
• Abtasten
• Ultraschall-Untersuchung (Sonografie)
• Schilddrüsen-Szintigrafie
• Feinnadelbiopsie
Die eigenen Werte kennen
| SCHILDDRÜSENHORMON INKL. NEBENSCHILDDRÜSE | NORMALWERT |
| Kalzitonin | Männer: 0,14 pg/ml (0–4,1 pmol/l) Frauen: 0,28 pg/ml (0–8,2 pmol/l) |
| T3 | 1,7–3,7 ng/l (1,16–3,00 nmol/l) |
| T4 | 7,0–14,8 ng/l (52–154 nmol/l) |
| Parathormon | unter 25 pg/ml (unter 2,94 pmol/l) |
| TRH | 18 μU/ml |
| TSH | 0,3–4,0 mU/l (0,2–3,1 μU/ml) Bei Unterfunktion sind die Werte erhöht, bei Überfunktion sinken die TSH-Spiegel stark ab. |
| TSH nach TRH-Test | Anstieg um 2,0–25 mU/l |
mU/l = Tausendstel Einheit [Unit] pro Liter
pg/ml = Pikogramm (ein Billionstel Gramm = 10–12 g) pro Milliliter
ng/l = Nanogramm pro Liter
pmol = Pikomol pro Liter, nmol = Nanomol pro Liter
 |
|
Der TSH-Wert zeigt, wie gut die Steuerung über das Gehirn funktioniert. |
Äußerlich kann der Arzt Größe und Beschaffenheit der Schilddrüse durch Abtasten des Halses bei nach hinten überstrecktem Kopf beurteilen. Als wichtigstes bildgebendes Verfahren wird die Ultraschall-Untersuchung der Schilddrüse eingesetzt. Falls nötig, kann der Arzt ferner eine Röntgenuntersuchung des Oberkörpers, eine Schilddrüsen-Szintigrafie, die über die Funktion der Schilddrüse Auskunft gibt, sowie eine Punktion (Feinnadelbiopsie) der Schilddrüse mit anschließender mikroskopischer Untersuchung anordnen. Letztere gibt Aufschluss darüber, ob Gewebeveränderungen gutartig oder bösartig sind.
Jodmangelkropf
Sie werden staunen, aber Beschreibungen von Kröpfen gibt es schon seit mehr als 2500 Jahren aus der chinesischen und indischen Literatur! Dabei bezeichnet man als Kropf – medizinisch Struma – eine deutliche Schwellung unterhalb des Kehlkopfes. Sie ist die Folge einer vergrößerten Schilddrüse, die nicht immer von außen sichtbar ist.
 |
|
Als Kropf bezeichnet man eine deutliche Schwellung unterhalb des Kehlkopfes. |
Eine Schilddrüsenvergrößerung, wie beim Kropf, ist die häufigste Schilddrüsenerkrankung in Deutschland. Je nach Region, in der die Menschen leben, lässt sich bei 15 bis 30 Prozent der Deutschen, etwa einem Drittel der Bevölkerung in Westeuropa und 90 Prozent der Schilddrüsenpatienten mithilfe des Ultraschalls ein Kropf feststellen.
Die schwammartige Schilddrüse ist von vielen Blutgefäßen durchsetzt, mit deren Hilfe sie auch die winzigsten Spuren an Jod aus dem Blut filtern kann. Dabei ist sie äußerst bescheiden: Sie benötigt nur 200 μg Jod pro Tag. Erhält sie diese Menge jedoch nicht, werden innerhalb der Schilddrüsenzelle Wachstumsfaktoren produziert, die eine Vermehrung und Vergrößerung der Zellen bewirken. Diese nehmen an Größe und Anzahl zu – das nennt der Arzt Hypertrophie und Hyperplasie. Bestimmte Jodfette scheinen ebenfalls für das Wachstum von Zellen verantwortlich zu sein. Auch das Schilddrüsensteuerungshormon TSH bewirkt eine Größenzunahme der Zellen.
Durch eine Gewebevermehrung versucht die Schilddrüse, noch geringste Jodmengen aufzunehmen, um die Effizienz der Jodaufnahme und die Hormonbildungsrate zu erhöhen. Deshalb wächst sie und bildet neue Schilddrüsenfollikel. Ist die Jodzufuhr aber dauerhaft zu gering, bilden sich immer mehr neue, größere Zellen, die Schilddrüse wird immer größer – ein Kropf entsteht.
Mithilfe der zusätzlich gebildeten Zellen kann der Hormonspiegel über eine kurze Zeit konstant gehalten werden. Diese Körperreaktion nimmt jedoch im Alter ab. Dauert der Jodmangel an, entstehen immer mehr Zellen und ohne Behandlung kann die Schilddrüse letztlich auf eine enorme Größe anwachsen.
Symptome
Anzeichen für leichte Schilddrüsenvergrößerungen:
• Der Hemdkragen erscheint zu eng.
• Rollkragen werden vermieden.
• Anliegende Ketten und ein Schlips werden als unangenehm empfunden.
Anzeichen für Jodmangelkropf:
• häufiges Räuspern
• Engegefühl im Halsbereich
• Schluckbeschwerden
• Atembeschwerden
Zur Kropfbildung kommt es vor allem in Phasen eines erhöhten Hormonbedarfs wie Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit und Wechseljahre. So entwickelt sich ein Kropf bei Mädchen häufig in der Zeit der Geschlechtsreife. Meist kann man dessen Wachstum aber gut durch die Gabe von Jod stoppen.
 |
|
Ein Kropf entsteht vor allem in Phasen eines erhöhten Hormonbedarfs. |
Insbesondere zu Beginn verursacht die Kropfbildung häufig keine Probleme, kann jedoch auch aufgrund von Verdrängung und Einengung der Nachbarbereiche mit Druck- und Schluckbeschwerden einhergehen. In der Regel hat man lange Zeit keine Beschwerden, erst wenn der Kropf sehr groß wird, sich sogenannte autonome Knoten bilden oder die Hormonproduktion gestört ist, zeigen sich Symptome. Das Gefühl der Einengung im Hals (Globusgefühl) kann von der Tageszeit abhängig sein, bei Frauen teilweise sogar von der Monatsblutung.
Je nach Ursache ist eine gesteigerte oder verminderte Schilddrüsenfunktion mit dem Kropf verbunden. Besteht er längere Zeit, treten häufig Knoten auf, da die Schilddrüsenzellen unterschiedlich auf den Jodmangel bzw. die TSH-Stimulation reagieren. Anders gesagt: Die Knotenbildung steigt mit zunehmendem Alter.
Da ein Kropf – insbesondere zu Beginn – nur geringe Beschwerden verursacht, wird er oft nur zufällig und sehr spät entdeckt, wenn bei einer ärztlichen Untersuchung der Hals abgetastet wird bzw. wenn Sie selbst die Schilddrüsenvergrößerung bereits sehen. Das bedeutet, Sie sollten spätestens, wenn Sie bemerken, dass Ihr Hals dicker geworden ist, oder andere Sie darauf hinweisen, sofort einen Arzt aufsuchen.
Achtung: Eine Einnahme von Jodtabletten kann bei einer Schilddrüsenüberfunktion zu einer Verschlimmerung bis hin zu einer akuten lebensbedrohlichen Krise führen. Lassen Sie sich daher immer vorher von einem Arzt die Notwendigkeit der Einnahme von Jodtabletten bestätigen! Verwenden Sie Jodsalz, besteht dieses Problem nicht, da dessen Jodgehalt deutlich geringer ist.
Ein Kropf, der die Atmung behindert, muss auf alle Fälle in seinem Wachstum gebremst werden. Sind Sie jünger als 45 Jahre, sollte der Kropf auch behandelt werden, um Komplikationen zu vermeiden, die im Zusammenhang mit der Schilddrüsenfunktionsstörung in späteren Jahren auftreten können. Sind Sie bereits älter, kann es genügen, die Schilddrüse regelmäßig ärztlich kontrollieren zu lassen.
 |
|
Lassen Sie sich stets vom Arzt bestätigen, dass die Einnahme von Jodtabletten nötig ist! |
Nicht alle Personen, die in einem Jodmangelgebiet wohnen, erkranken auch an einem Kropf. Da er in bestimmten Familien häufiger auftritt, geht man davon aus, dass neben einem Jodmangel eine ererbte Störung der Jodverwertung, z. B. durch einen Defekt in der Hormonbildung, an der Kropfentstehung beteiligt ist.
Ursachen
Ein Kropf kann sowohl bei einer Schilddrüsenunterfunktion als auch bei einer -überfunktion auftreten. Sogar bei einer normalen Hormonproduktion kann ein Kropf entstehen. Die häufigste Ursache ist eine unzureichende Jodversorgung.
Es ist auf alle Fälle wichtig, die Ursache einer Kropfentstehung zu kennen. Dafür kommen infrage: in den meisten Fällen ein Jodmangel, ferner Schilddrüsenautonomien, Schilddrüsenknoten, die Krankheit Morbus Basedow, Zysten, Entzündungen und selten Schilddrüsentumore.
Bei einer anderen Variante der Kropfentstehung werden gegen das Globulin, also den Eiweißkörper des Thyreoglobulins (Speicherform des Schilddrüsenhormons), oder gegen andere Eiweiße in der Schilddrüse Antikörper gebildet. Das heißt: Der Körper sieht ein von ihm selbst produziertes Eiweiß als körperfremd an und bildet Antikörper dagegen. Die Folge dieser Antigen-Antikörper-Reaktion ist, dass nicht ausreichend Schilddrüsenhormone in das Blut und damit in den ganzen Körper gelangen.
Diagnoseverfahren und typische Untersuchungsergebnisse bei Jodmangelkropf
| DIAGNOSEVERFAHREN | UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE |
| Sonografie | normale Echostruktur, vergrößerte Schilddrüse, ohne/mit Knoten |
| BLUTUNTERSUCHUNG | UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE |
| TSH | normal |
| TSH nach TRH | normale Antwort |
| T3 | (hoch) normal |
| T4 | normal |
| Antikörper (z. B. Thyreoglobulin- oder TSH-Rezeptor-Antikörper) | negativ |
| URINUNTERSUCHUNG | UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE |
| Jodausscheidung | vermindert |
| Szintigrafie | leicht erhöhte Aufnahme der radioaktiven Substanz, evtl. Nachweis von kalten Knoten |
So behandelt der Arzt einen Kropf
Medikamentöse Therapie Als erste Maßnahme und bei geringen Beschwerden verschreibt ein Arzt Jodtabletten. Zum Vorbeugen genügen meist 100 μg täglich, zur Kropftherapie müssen es 200 μg sein, manchmal auch 400 μg. Im Anschluss an die Therapie genügen meist sechs bis zwölf Monate lang täglich 100 bis 200 μg. Hat dieser Ansatz über sechs Monate keinen Erfolg, verordnet der Arzt zusätzlich das Schilddrüsenhormon Levothyroxin (L-Thyroxin). Dadurch können sich die Vermehrung wie auch die Vergrößerung der Schilddrüsenzellen zurückbilden. Ziel ist ein TSH-Wert im unteren Normbereich (0,3 bis 1,2 mU/ml).
 |
|
Als erste Maßnahme verschreibt Ihnen der Arzt Jodtabletten. |
Bei der Einnahme von L-Thyroxin kann es zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen. Beachten Sie dazu bitte den Kasten und die Hinweise auf Seite 42
Bei Schwangeren kombiniert der Arzt meist sofort Jod mit dem Schilddrüsenhormon. Gerade bei jüngeren Patienten kann sich bei ausreichender Jodzufuhr ein Kropf sogar zurückbilden.
Wenn Sie nicht täglich Jod einnehmen wollen oder können, gibt es Tabletten, die Sie nur einmal pro Woche einnehmen müssen. Dann sollten Sie jedoch in jedem Fall sicherstellen, dass eine zweimalige Einnahme ausgeschlossen ist.
Da für das Wachstum der Schilddrüse Wachstumsfaktoren zumindest mitverantwortlich sind, steht die Verabreichung von Jod als alleinige Therapie im Vordergrund. Dies erwies sich als genauso effektiv, um das Schilddrüsenvolumen zu reduzieren, wie die Medikation mit dem Schilddrüsenhormon. Der Vorteil der Behandlung mit Jod ist, dass nach Absetzen der Therapie im Unterschied zur Therapie mit Hormonen das Volumen der Schilddrüse nur geringfügig wieder zunimmt. Das liegt daran, dass die Größenzunahme der Schilddrüse nicht nur vorübergehend symptomatisch behandelt, sondern der ursächliche Jodmangel beseitigt wird. Auch um einen Rückfall zu vermeiden, erweist sich die Gabe von Jod als wirksam.
Unbehandelt kann sich aus einem anfangs unproblematischen Kropf eine deutliche Schilddrüsenunterfunktion entwickeln. Langfristig können sich sogenannte heiße oder kalte Knoten bilden, die eine Überfunktion bedingen oder auch zur Tumorbildung beitragen können. Bei Knoten mit einem Durchmesser von über einem Zentimeter sollte man eine Szintigrafie durchführen lassen.
 |
|
Knoten sind möglicherweise dabei
Etwa ein Drittel der Bevölkerung weist eine Vergrößerung oder einen Knoten in der Schilddrüse auf. Jeweils 10 Prozent haben eine Vergrößerung ohne und eine Vergrößerung mit Knoten. Etwa 14 bis 17 Prozent (Frauen) haben eine normal große Schilddrüse mit Knoten. Das heißt: Eine Knotenbildung kann, muss aber nicht mit einem Kropf einhergehen. Die Ursache liegt auch hier meist in einem Jodmangel.
Durch die Vermehrung oder Vergrößerung der Schilddrüsenzellen kann eine normale Hormonproduktion über lange Zeit aufrechterhalten werden. Je länger aber die Jodmangelsituation andauert, desto eher kommt es auch zur Bildung andersartiger Gewebe in der Drüse. Bei der Szintigrafie unterscheidet man folgende Strukturen:
• normal funktionierende Knoten
• inaktive Knoten („kalte Knoten“)
• überaktive Knoten („heiße Knoten“)
• autonome Knoten: überaktive Knoten, die einer Steuerung von „oben“ (über TSH) nicht zugänglich sind (siehe Seite 25)
Für heiße und kalte Knoten zusammen besteht ein Krebsrisiko von etwa 0,1 Prozent. Dieses Risiko steigt jedoch auf bis zu 10 Prozent, wenn die kalten Knoten größer werden – es ist also wichtig, die Größenentwicklung dieser Knoten zu kontrollieren. Wenn Sie zum ersten Mal einen Knoten bei sich entdecken, vereinbaren Sie am besten eine kurzfristige Kontrolle nach drei Monaten. Bleibt der Knoten unverändert, können die Kontrollintervalle verlängert werden.
Operative Therapie Ob ein kalter Knoten operiert wird, hängt nicht nur von der Größe und Größenzunahme ab. Auch das Alter oder Zusatzerkrankungen des Patienten sind wichtig. Jüngere werden meist eher operiert, da hier die Gefahr für eine Entartung über die Lebensdauer größer ist. Im Allgemeinen wächst ein Schilddrüsenkrebs eher langsam. Deshalb muss man bei älteren Patienten nicht um jeden Preis operieren. Entscheiden müssen Arzt und Patient gemeinsam.
 |
|
Sehr große Kröpfe werden operiert. Dabei entfernt man die Schilddrüse möglichst nur teilweise. |
Radiojodtherapie Ist der Kropf so groß, dass z. B. Schluckbeschwerden vorliegen, reichen die genannten Medikamente zur Behandlung nicht aus. Dann wird der Arzt eine Radiojodtherapie empfehlen, die immerhin 70 bis 80 Prozent der Patienten hilft.
Eine länger bestehende vergrößerte, knotig umgebaute Schilddrüse kann durch Jodzufuhr allein oder andere konservativ-medikamentöse Maßnahmen nur unvollständig behandelt werden. Hier geht man folgendermaßen vor: Nachdem der Knoten getastet wurde, folgen Ultraschall- und Blutuntersuchung. Danach gibt es zwei Möglichkeiten:
1. TSH normal → Feinnadelbiopsie
a) Ergebnis: gutartiger Knoten → Nachbeobachtung
b) Ergebnis: bösartiger oder suspekter Knoten → Operation
2. TSH zu gering → Szintigrafie
a) Ergebnis: kalter Knoten → Feinnadelbiopsie
b) Ergebnis: heißer Knoten → Radiojodtherapie/Operation und Nachbeobachtung
Vorbeugung
Vorbeugen kann man einem Kropf durch ausreichende Jodversorgung. Verwenden Sie am besten jodiertes Speisesalz und essen Sie wöchentlich ein- bis dreimal Meeresfisch. Bei Jodmangel greift die Schilddrüse auf ihre Reserven zurück. Sind diese aufgebraucht, sinkt der Schilddrüsenhormonspiegel.
Was ist in der Schwangerschaft zu beachten? Bis zu 70 Prozent aller Schwangeren entwickeln im Verlauf der Schwangerschaft oder direkt danach einen Kropf. Dies allerdings nur, wenn die Jodzufuhr nicht ausreicht. Haben Schwangere einen Kropf und werden ausreichend Schilddrüsenhormone produziert, müssen täglich 50 bis 200 μg Jod und 50 bis 100 μg L-Thyroxin eingenommen werden. Bei unzureichender Schilddrüsenhormonbildung müssen es 75 bis 125 μg L-Thyroxin und 150 μg Jod sein.
Was ist bei Säuglingen und Kleinkindern zu beachten? Bei uns werden jedes Jahr 6000 Säuglinge mit Kropf geboren. Sind Schwangere ausreichend mit Jod versorgt (siehe oben), so bekommen auch ihre gestillten Säuglinge genug Jod. Andererseits versursacht eine Jodunterversorgung der Mutter auch beim Baby eine Schilddrüsenunterfunktion. Wichtig ist auch für nicht (mehr) gestillte Babys, dass sie eine mit Jod angereicherte Säuglingsmilch und später mit Jod angereicherte Beikost bekommen.
Da Säuglinge besonders empfindlich auf Jodmangel reagieren, werden kommerziell hergestellte Säuglingsmilchnahrungen auf dem deutschen Markt mit Jod angereichert (50 bis 150 μg/l). Dies ist auch für Beikost auf Getreidegrundlage erlaubt. Daher vermutet man, dass Säuglinge, die regelmäßig Getreidebrei erhalten, ausreichend Jod aufnehmen.
Schilddrüsenüberfunktion
Eine Schilddrüsenüberfunktion – medizinisch Hyperthyreose – ist im Grunde ein Überangebot von Schilddrüsenhormonen im Blut, meist bedingt durch eine Überfunktion der Schilddrüse. Das heißt, die Schilddrüse produziert mehr Hormone, als der Körper benötigt, oder die Ausschüttung an Hormonen aus den Thyreozyten und Follikeln ist erhöht. In diesem Falle sind die Follikel oft stark geleert und kleiner. Die Schilddrüse ist also bei Überfunktion nicht unbedingt vergrößert. Davon betroffen sind etwa 0,3 bis 2 Prozent der Bevölkerung.
Symptome
Erhöhte Schilddrüsenhormonkonzentrationen haben einen starken Abbau von Eiweiß, der Speicherform von Kohlenhydraten (Glykogen), sowie von Fetten zur Folge. Wer unter Schilddrüsenüberfunktion leidet, ist somit in der Regel sehr schlank, obwohl er einen gesteigerten Appetit hat. Durch die Abbauprozesse nehmen die Körperwärmeproduktion und die Schweißsekretion zu, der Puls steigt. Weitere Symptome können Sie der Vergleichstabelle auf Seite 37 entnehmen.
 |
|
Wer unter Schilddrüsenüberfunktion leidet, ist in der Regel sehr schlank. |
Auch infolge einer falsch dosierten Therapie mit Schilddrüsenhormonen, das heißt, durch eine Überversorgung mit von außen zugeführten Schilddrüsenhormonen kann es zu einer künstlichen (artifiziellen) Überfunktion kommen. Dahinter steckt meist eine mangelhafte oder fehlende ärztliche Versorgung.
Ursachen
Eine Überfunktion beruht zu mehr als 95 Prozent entweder auf einer Basedowkrankheit (Morbus Basedow, siehe Seite 43) oder gutartigen Knoten, den sogenannten autonomen Adenomen. Häufig geht ein langjähriger Jodmangel voraus. Selten ist eine Schilddrüsenentzündung und noch seltener Schilddrüsenkrebs die Ursache.
Bei einer unbehandelten Schilddrüsenüberfunktion können auch hohe Jodmengen eine Überfunktion auslösen.
So behandelt der Arzt eine Schilddrüsenüberfunktion
Um eine Hyperthyreose festzustellen, bestimmt der Arzt zunächst den TSH-Wert und die Schilddrüsenhormone T3 und T4 im Blut. Außerdem tastet er den Patienten auf einen Kropf ab und führt eine Ultraschalluntersuchung durch, um die Größe der Schilddrüse zu bestimmen, und eine Szintigrafie, um ihre Funktion zu testen. Auch eine Biopsie kann sinnvoll sein.
Medikamentöse Therapie In der Regel wird der Arzt zunächst versuchen, die Produktion von Schilddrüsenhormonen medikamentös zu hemmen. Mit sogenannten Thyreostatika wird das Hormon Schilddrüsenperoxidase (TPO) blockiert bzw. die Jodanlagerung an die Schilddrüsenhormone verhindert. Die Menge dieser Medikamente muss immer sehr genau beobachtet und immer wieder überprüft werden, da bei einer Überdosierung auch eine Unterfunktion entstehen kann, die über vermehrte TSH-Aktivität zum Kropf führt. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie etwa alle vier Wochen zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen gehen.
 |
|
Die Dosierung von Thyreostatika muss regelmäßig überprüft werden. |
Bis die Medikamente wirken und sich die Blutwerte normalisiert haben, vergehen sechs bis acht Wochen. Entsprechend dauert die medikamentöse Therapie in der Regel zwölf bis 18 Monate.
Es wird auch empfohlen, auf jodreiche Lebensmittel zu verzichten sowie die Jodaufnahme in Form von Röntgenkontrastmitteln oder jodhaltigem Heil- bzw. Mineralwasser zu meiden.
Operative Therapie und Radiojodtherapie Bei einer dauerhaften Überfunktion oder einem großen Kropf stehen die Radiojodtherapie oder ein operativer Eingriff zur Wahl. Das Behandlungsziel besteht darin, die Menge an funktionstüchtigem Schilddrüsengewebe so weit zu verringern, dass der verbleibende Schilddrüsenrest nicht mehr ausreicht, um den Körper mit Schilddrüsenhormonen zu überschwemmen.
 |
|
Ziel ist eine Verringerung des Schilddrüsengewebes oder die Hemmung der Hormonproduktion. |
Selten wird auch Jod in hoher Dosierung gegeben, da sehr hohe Joddosen die Jodaufnahme der Schilddrüse und somit auch die Produktion von Schilddrüsenhormonen hemmen – zumindest über einen kurzen Zeitraum.
Ist die Ursache der Überfunktion die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow, so kommt es in der Hälfte der Fälle während der einjährigen Therapie mit Thyreostatika zur Spontanheilung. Leider kann die Erkrankung aber auch wieder aufflackern.
Infolge der Symptome ist auch eine Bewegungstherapie sinnvoll sowie Entspannungsübungen wie z. B. autogenes Training.
Was ist in Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten? Selten bekommen Schwangere eine Schilddrüsenüberfunktion. Meist lag eine schwache Überfunktion bereits vorher vor und wurde nur nicht erkannt. Ist sie nur leicht ausgeprägt, wartet man mit der Behandlung noch etwas ab. Bei deutlichen Krankheitszeichen und erhöhten Schilddrüsenhormonwerten ist auch die Behandlung mit Schilddrüsenhemmern möglich und sinnvoll.
 |
|
Wird eine Überfunktion in der Schwangerschaft nicht behandelt, können Missbildungen, Früh- und Totgeburten auftreten. |
Damit das ungeborene Kind über die Nabelschnur keine allzu hohen Mengen an Thyreostatika erhält, wird die Medikamentendosis so gering wie möglich gehalten. Verläuft die Überfunktion mild, wird vorzugsweise ein pflanzliches Präparat eingesetzt.
Ist die Verwendung von Jodsalz bei einer Überfunktion gefährlich? Auch bei einer Überfunktion der Schilddrüse ist die Verwendung von Jodsalz nicht gefährlich. Eine Jodzufuhr bis zu 300 μg täglich gilt als unproblematisch. Eine Schilddrüsenüberfunktion, die sich einer Regulierung durch übergeordnete Hormone entzieht, also die sogenannte autonome Überfunktion, ist zumeist durch einen jahrzehntelangen Jodmangel bedingt. Wird der Jodmangel dauerhaft bekämpft, können Schilddrüsenautonomien weitgehend ausgemerzt werden. Eine Überdosierung von Jod durch Medikamente, Röntgenkontrastmittel, Hautdesinfektionsmittel, hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel, jodreiche Algen kann die Beschwerden einer Schilddrüsenüberfunktion auslösen oder auch verschlimmern. Jodsalz löst derartige Beschwerden nachgewiesenermaßen nicht aus.
 |
|
Eine Jodzufuhr bis zu 300 μg täglich gilt als unproblematisch. |
Schilddrüsenunterfunktion
Bei der Schilddrüsenunterfunktion – medizinisch Hypothyreose – werden zu wenig Schilddrüsenhormone ausgeschüttet, das heißt: Es entsteht ein Mangel daran.
Symptome
Wenn die Schilddrüse zu wenig Schilddrüsenhormone bildet, führt das zu Störungen in vielen Körperbereichen. So beeinflussen diese Hormone z. B. die Hirnfunktionen, das Herz-Kreislauf-System, die Verdauung, viele Stoffwechselvorgänge, die Muskulatur und auch die Psyche. In der folgenden Tabelle sehen Sie die Symptome im Vergleich zur Schilddrüsenüberfunktion.
Außerdem können Sie als Patient mit Schilddrüsenunterfunktion von folgenden Problemen gequält werden: hormonelle Dysfunktion jeglicher Art, Lernstörungen, langsam wachsende, zu weiche oder brüchige Nägel mit Rillen quer oder längs, Zahnverlust, schlechte Wundheilung, Leberverfettung, Hör-, Geruchsund Geschmacksstörungen sowie Ausfall der seitlichen Augenbrauen. Auch eine Schuppenbildung ist häufig. Dazu kommt, dass die Haare langsam wachsen, trocken und brüchig werden, manchmal fallen sie sogar büschelweise aus.
Es kommt zur Blutarmut bzw. zu verminderter Bildung von roten Blutkörperchen. Auch ein sogenanntes Myxödem kann auftreten, bei dem sich in die Haut bestimmte Substanzen einlagern und damit eine typische Verdickung und Schwellung, besonders im Gesicht an Augenlidern und Zunge sowie an Beinen, Händen und Armen, verursachen.
Viele Körpervorgänge arbeiten im Schneckentempo, da die Nervenfasern extrem langsam schalten. Das kann z. B. im Darm zu starker Verstopfung, schlimmstenfalls zur Darmlähmung führen.
 |
|
Typisch ist, dass viele Körpervorgänge langsam arbeiten. |
Bei Frauen kommt es zur unregelmäßigen Monatsblutung, auch die Menopause kann früher einsetzen. Bei Kinderwunsch bleibt bei einem Drittel der Patientinnen die Befruchtung aus. Kommt es dennoch zur Empfängnis, treten häufig Fehlgeburten im ersten Drittel der Schwangerschaft auf.
Vergleich der Symptome der Schilddrüsenunter- und -überfunktion im Erwachsenenalter
| SCHILDDRÜSENÜBERFÜNKTION | SCHILDDRÜSENUNTERFUNKTION |
| Grundumsatz erhöht, guter Appetit bis Heißhunger ohne Gewichtszunahme (Gewichtsverlust) | Grundumsatz verringert (Gewichtszunahme) |
| Kalziummobilisation aus den Knochen und somit hohe Kalziumspiegel im Blut | Störungen des Knochenstoffwechsels |
| Schlaflosigkeit, Unruhe, Reizbarkeit bis hin zur Aggressivität, Nervosität, Ruhelosigkeit, Gefühlsschwankungen | Schläfrigkeit, Desinteresse, depressive Verstimmungen |
| Cholesterinspiegel möglicherweise erniedrigt | Cholesterinspiegel möglicherweise erhöht, Arteriosklerose-Risiko |
| Geistige und körperliche Agilität | Geistige und körperliche Trägheit bis hin zu Gedächtnisschwäche und wirren Gedanken |
| Häufiges Schwitzen bis Fiebergefühl | Frösteln, Kälteempfindlichkeit |
| Haut feucht, warm, gerötet, Haarausfall | Haut trocken, kalt und blass, Haarausfall |
| Dünne Haut, feine Strukturen | Trockene, brüchige Haut, neigt zum Bluten an Händen und Fersen |
| Hervortretende Augäpfel (Morbus Basedow) | Teigiges, aufgeschwemmtes Gesicht |
| Blutdruck erhöht | Blutdruck i. d. R. erniedrigt |
| Starkes Herzklopfen, Kurzatmigkeit | Langsamer, schwacher Puls |
| Gesteigerte Darmaktivität bis hin zu Durchfall | Verstopfung, Blähungen, langsames Verdauungssystem |
| Schlank bis mager | Normal- bis übergewichtig mit Gewichtsverteilung in der Körpermitte |
| Schwäche der Oberschenkelmuskulatur | Extreme Schmerzhaftigkeit des Rippenknorpels (wird besser bei Jodzufuhr) |
| Schlechter bei Hitze, besser bei Kälte | Schlechter bei Kälte, besser bei Wärme |
| Herzrasen | Reflexe und Herzschlag verlangsamt |
| Muskelschwäche, Zittern (der Hände) | Kropf |
| Bei Frauen eventuell Zyklusstörungen, Libido- und Potenzstörungen sowie Verminderung der Fruchtbarkeit (Empfängnisbereitschaft) | |
Üblicherweise leiden 0,25 bis 1,1 Prozent der Bevölkerung unter dieser Unterfunktion, mit zunehmendem Alter steigt die Rate auf bis zu 2,9 Prozent an.
Ursachen
Eine Schilddrüsenunterfunktion ist nur in ganz seltenen Fällen angeboren. Die Ursachen können sowohl auf der Ebene der Schilddrüse als auch in den übergeordneten Zentren des Hypothalamus oder der Hypophyse liegen. Liegt es an der Schilddrüse, so ist der TSH-Spiegel erhöht, ansonsten können auch erniedrigte TSH-Spiegel vorliegen, die selbst nach der Gabe von TRH nicht ansteigen. Oft ist die Unterfunktion das Ergebnis einer Beschädigung des Schilddrüsengewebes, etwa bei einer Entzündung (z. B. Hashimoto-Thyreoiditis), bei Schilddrüsenoperationen oder -bestrahlungen (nur, wenn anschließend keine regelmäßigen Nachuntersuchungen stattfinden), bestimmten Medikamenten (z. B. Schilddrüsenblocker), Störungen im Bereich der Hirnanhangsdrüse oder bei einer Radiojodbehandlung.
Eine mangelnde Nachsorge betrifft in erster Linie ältere Patienten, die – teilweise mit Demenzerkrankungen – vergessen, die Schilddrüsenhormontherapie weiterzuführen und regelmäßig die richtige Dosierung überprüfen zu lassen.
Das Problem bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist, dass die Patienten selbst oft spät oder auch gar nicht merken, dass ihre Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Die Unterfunktion entwickelt sich sehr langsam und schleichend. Es kommt durchaus vor, dass man sie jahrelang hat, mit nur sehr wenigen und leichten Krankheitszeichen. So ist es durchaus möglich, dass man sich an die Symptome gewöhnt und sie gar nicht als solche wahrnimmt, sondern eher meint, man wäre eben „ständig müde“ oder depressiv veranlagt. Bei älteren Patienten schiebt man die Probleme auf das Alter, etwa die Vergesslichkeit oder auch häufige Müdigkeit.
 |
|
Eine Schilddrüsenunterfunktion bleibt oft unerkannt. |
So behandelt der Arzt eine Schilddrüsenunterfunktion
Neben der körperlichen Untersuchung, in deren Rahmen die bereits genannten Symptome festgestellt werden, lässt der Arzt das Blut untersuchen. Hier kommt es besonders auf den TSH-Basalwert an: Liegt er unter 0,3 mU/l, besteht keine Unterfunktion. Liegt er allerdings über 3,5 mU/l, kann eine Unterfunktion vorliegen. Die T3- und T4-Werte sind erniedrigt.
Medikamentöse Behandlung Wird Ihre Hypothyreose optimal behandelt, bessern sich die Symptome rasch und auf Dauer. Dazu verordnet Ihnen der Arzt künstlich hergestellte Schilddrüsenhormone zum Ausgleich des Schilddrüsenhormonmangels; 100 bis 200 μg L-Thyroxin ist die gängige Menge. Allerdings müssen Sie diese Hormone ein Leben lang einnehmen.
Eine Besserung der Beschwerden tritt nach ein bis drei Monaten ein, jedoch bemerkt man Zeichen der Besserung bereits nach etwa zwei bis drei Wochen. Zuerst betrifft dies die psychischen Erscheinungen, wie Müdigkeit, depressive Verstimmung und Antriebsarmut. Oft bessern sich in kurzem zeitlichem Abstand auch die körperlichen Beschwerden, so z. B. das verstärkte Frieren.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842686854
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Oktober)
- Schlagworte
- Alternative Medizin Fehlfunktion Gemmotherapie Gesundheits-Ratgeber Heilkräuter Homöopathie Schilddrüsenbeschwerden Konventionelle Behandlung Mangnetfeldtherapie Natürlich behandeln Patienten-Ratgeber