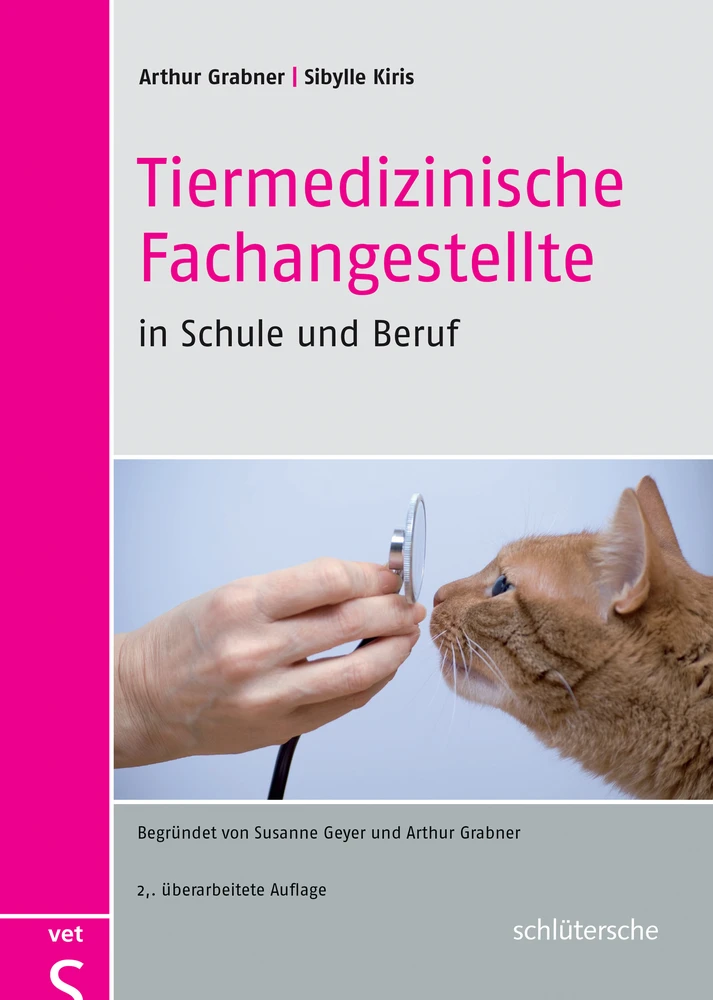Zusammenfassung
Verbindlich für den Berufsschulunterricht
Umfassend für die Praxis
Gliederung nach Lernfeldern – Fachkunde nach Rahmenlehrplan
Praxisbeispiele und Leitfragen für den handlungsorientierten Unterricht
Rund 400 instruktive Abbildungen
Laborkunde im Überblick
Kompaktes Nachschlagewerk für die Zeit während und nach der Ausbildung
Dieses Lehr- und Praxisbuch vereint zwei bewährte Standardwerke für die Berufsausbildung von Tiermedizinischen Fachangestellten: Die Autoren Arthur Grabner und Sibylle Kiris haben das eingeführte Lehrbuch „Die Tierarzthelferin“ und das auf den Rahmenlehrplan abgestimmte Ergänzungswerk zusammengeführt, aktualisiert und erweitert. Die Kapitel dieses Lehrbuches folgen den Anforderungen der 12 Lernfelder.
Zum schnellen Nachschlagen ist die Laborkunde in einem umfangreichen Kapitel am Ende des Buches zusammengefasst. Ein ausführlicher Index, zahlreiche Querverweise und ein optionales Inhaltsverzeichnis, das die Fachsystematik den verschiedenen Lernfeldern zuordnet, helfen dabei, die gesuchten Inhalte schnell und treffsicher aufzufinden.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
THEMATISCHE ZUORDNUNG ZU DEN LERNFELDERN
Hinweis für den Leser
Der handlungsorientierte Unterricht nach dem Lernfeldkonzept bringt es mit sich, dass einige Themen in unterschiedlichem Kontext dargestellt werden können. Die Autoren geben entsprechende Hinweise durch zahlreiche Verweise im Text. Darüber hinaus wird ausdrücklich empfohlen, den sehr detailliert und umfangreich gestalteten Index zur Orientierung im Buch zu nutzen.
 Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Stellen verweisen auf andere Kapitel. In der Regel werden Lernfeld und Thema genannt, zu denen weitere Informationen nachzulesen sind.
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Stellen verweisen auf andere Kapitel. In der Regel werden Lernfeld und Thema genannt, zu denen weitere Informationen nachzulesen sind.
Um den Text gut lesbar zu lassen, wird grundsätzlich auf die Ausformulierung beider Geschlechter verzichtet. Bei der Formulierung »der Tierarzt« ist immer auch die Tierärztin gemeint. »Die TFA« ist die Abkürzung für »die Tiermedizinische Fachangestellte«, auch in diesem Fall ist immer auch der Tiermedizinische Fachangestellte gemeint. »Der Klient« steht für alle weiblichen und männlichen Personen, die die Dienste einer Tierarztpraxis in Anspruch nehmen.
VORWORT
Infolge der neuen Verordnung der Berufsausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten/zum Tiermedizinischen Fachangestellten vom 22. August 2005 wurde eine Aktualisierung des bewährten Lehrbuchs »Die Tierarzthelferin« erforderlich. Bereits im Jahr 2006 wurde ein Leitfaden für die schulische Ausbildung zu Tiermedizinischen Fachangestellten verfasst, der sich in Aufbau und Inhalt am Rahmenplan für die Berufsschule orientiert. Dabei tragen die Kapitel des Buches die Titel der 12 Lernfelder. Auf der Grundlage des jeweiligen Lernfelds sollen im Schulunterricht Lernsituationen herausgearbeitet werden.
Das neue Fachbuch »Tiermedizinische Fachangestellte in Schule und Beruf« wurde komplett überarbeitet und der Wissensstoff nach Lernfeldern zusammengestellt. Es ist somit auch ein verbindliches Lehrbuch für den Berufsschulunterricht geworden. Das übersichtliche Lernen wird durch zahlreiche instruktive, überwiegend farbige Abbildungen und viele Tabellen und Übersichten erleichtert. Das komplexe Wissensgebiet konnte für den Leser informativ gestaltet werden. Für die Arbeit der TFA in der Praxis ist ein umfassendes Nachschlagewerk entstanden. Das langjährige Standardwerk »Die Tierarzthelferin« wurde abgelöst.
Jedes Lernfeld beginnt thematisch mit einer kurzen Einleitung. Für den handlungsorientierten Unterricht und um einen hohen Praxisbezug herzustellen, folgen Vorschläge für erste Lernsituationen und Leitfragen zum Aufgabengebiet in der Praxis. Im Anschluss daran findet sich jeweils der Lehr- und Lernstoff, der in den einzelnen Lernfeldern vermittelt werden soll. Die Zell- und Gewebelehre wurde bewusst im Buch belassen, obwohl diese Inhalte nach der neuen Ausbildungsordnung nicht mehr geprüft werden. Ohne Zweifel ist die Kenntnis dieser biologischen Grundlagen aber eine unverzichtbare Voraussetzung für das Verständnis der medizinischen Abläufe.
Der wichtige Beitrag »Allgemeine Pathologie« von Frau Dr. Schoon aus Leipzig wurde in das Lernfeld 6 aufgenommen. Eine gründliche Überarbeitung erforderten die Themen Abrechnungs- und Gebührenwesen, Arzneimittelpreisverordnung und Zahlungsverkehr in der Tierarztpraxis, die Herr Dr. Schäfer, Aulendorf, erneut übernahm. Somit wird eine Aktualität auf der Grundlage der am 30. Juni 2008 novellierten Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches gewährleistet – wenngleich sich bevorstehende erneute Änderungen bereits abzeichnen. Beiden Mitarbeitern sei für ihr freundliches Entgegenkommen besonders gedankt. Zur Bereitstellung umfangreichen Bildmaterials für das Kapitel »Instrumente« gilt der Firma Eickemeyer, Tuttlingen, ebenfalls ein besonderer Dank.
Der Verlag hat das Buch großzügig gestaltet und ist auf besondere Wünsche in der Darstellung der Lernfelder eingegangen. Besten Dank!
München, Frankfurt a. M.
im Mai 2015
Arthur Grabner
Sibylle Kiris
LERNFELD 1 |
DIE EIGENE BERUFSAUSBILDUNG MITGESTALTEN UND SICH IM GESUNDHEITS- UND IM VETERINÄRWESEN ORIENTIEREN |
Einleitung
Beginnt ein junger Mensch eine Berufsausbildung, sind seine Fähigkeiten zunächst eher allgemeiner Natur. Ein Absolvent einer weiterführenden Schule (Haupt-/Realschule/Gymnasium) verfügt über einen Schulabschluss, mit dem ihm bescheinigt wird, dass er auf das Berufsleben vorbereitet ist. Die Vorbereitung findet in Form der Vermittlung fachlichen Wissens einerseits und andererseits der Fähigkeit, neue Dinge zu lernen, statt. In den unterschiedlichen Schulformen werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt, so dass die Schulabgänger sehr unterschiedliche fachliche und persönliche Voraussetzungen mit in die Ausbildung bringen. Damit am Ende der Berufsausbildung jeder ausgelernten TFA dieselben Grundkenntnisse und Fertigkeiten bescheinigt werden können, ist es notwendig, die Ausbildung so zu gestalten, dass Unterschiede ausgeglichen und persönliche Eignung gefördert wird.
Praxisbeispiel 1
Die TFA hat den Auftrag, ein Schema zu entwerfen, welches die Praxis selbst und darin das gesamte Praxisteam darstellt. Dieses Schema soll in Form eines Posters im Anmeldungsbereich der Praxis aufgehängt werden, damit die Klienten sich direkt über die Mitarbeiter, deren Verantwortungsbereiche und Aufgaben informieren können. Das Poster soll übersichtlich und ansprechend gestaltet sein.
Praxisbeispiel 2
In der Tierarztpraxis geht eine Flasche mit Narcoren®-Injektionslösung zu Bruch. Die TFA erhält den Auftrag, die in der Praxis notwendigen Formalitäten zu erledigen und die zuständigen Behörden zu informieren.
Praxisbeispiel 3
Im Praxislabor steht eine Harnprobe, bei der eine Harnsedimentuntersuchung durch geführt werden soll. Die Probe wird eine Stunde vor Ihrem Feierabend genommen. Sie können die Untersuchung noch nicht durchführen. Der behandelnde Tierarzt sagt, das könne die Kollegin tun, die Wochenenddienst hat. Das Ergebnis der Untersuchung würde er erst in seinem nächsten Dienst am darauf folgenden Tag brauchen. Die letzte Stunde Ihres Dienstes ist turbulent. Es kommen noch zwei Notfälle herein, und die Arbeit türmt sich. Sie vergessen die Harnprobe, und die Kollegin entsorgt sie am Ende ihres Dienstes. Am nächsten Tag werden die Ergebnisse der Untersuchung gebraucht, und die Kollegin muss die Verantwortung für das Verschwinden der Harnprobe übernehmen. Sie ist wütend und gibt Ihnen die Schuld. Der Tierarzt ist ebenfalls wütend und gibt der Kollegin die Schuld. Sie hätte die Probe nicht einfach entsorgen dürfen.
Praxisbeispiel 4
Frau Schmidt hat vor zwei Wochen ihre Ausbildung als TFA begonnen. Sie möchte nun wissen, welche Möglichkeiten sie nach abgeschlossener Ausbildung hat, sich weiterzubilden, um mehr Verantwortung zu tragen und ihre finanzielle Situation zu verbessern.
Praxisbeispiel 5
Herr Schulze ist auszubildender TFA in der Tierarztpraxis und bekommt in seiner dritten Woche drei Mal die Rückmeldung von Kollegen, oft im Weg zu stehen und die anderen Teammitglieder mehr zu behindern als zu unterstützen. Oft weiß er nicht, welche Handgriffe und Zuarbeiten die Praxisabläufe vereinfachen könnten. Er möchte diesen Zustand dringend ändern.
Leitfragen
• Wie ist das Team in Ihrer Praxis zusammengesetzt?
• Wer im Team hat welche Aufgaben?
• Welche Bereiche werden von mehreren Mitarbeitern abgedeckt?
• Welche immer wiederkehrenden Praxisabläufe können Sie erkennen?
• Welchem Ablaufschema folgen die verschiedenen Praxisabläufe?
• Für welche Bereiche sind Sie verantwortlich?
• Mit welchen Behörden kommt Ihre Praxis häufig oder gelegentlich in Kontakt und was ist der jeweilige Anlass?
• Welche Aufgaben haben die Behörden?
• Wie finden Sie heraus, welches Amt für Ihr Problem zuständig ist?
• Wie verhalten Sie sich in einer Konfliktsituation?
• Wen sprechen Sie in einer Konfliktsituation an?
• Wie können Sie sich auf ein Konfliktgespräch vorbereiten?
• Welche Verhaltensregeln sollten Sie bei einem Konflikt beachten?
• Welche Aspekte der Kommunikation müssen Sie kennen, um mit Klienten und Teammitgliedern angemessen umgehen zu können?
• Wie können Sie bewusste Kommunikation trainieren?

1.1 Gesundheits- und Veterinärwesen
Gesundheit ist nach einem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegten Begriff ein »Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens«. Die Bewahrung und Verbesserung der Gesundheit sind Zweck des staatlich regulierten Gesundheitssystems.
1.1.1 Gesundheitswesen
Im Gesundheitswesen sind alle öffentlichen und privaten Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und der Krankenbehandlung zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem die öffentlichen Gesundheitsdienste (staatliche und städtische Gesundheitsämter), alle Einrichtungen der ambulanten und stationären Krankenbehandlung, das Betriebsarztwesen, die Schwangerenberatung und die Säuglingspflege. Des Weiteren sind alle im medizinischen Bereich tätigen konfessionellen und karitativen Organisationen sowie Rettungsdienste und nicht zuletzt die Lehreinrichtungen zur Ausbildung (Universitätskliniken, angeschlossene Institute, Krankenpflegeschulen) Teil des Gesundheitswesens. Das Gesundheitswesen steht auf drei Säulen (Abb. 1.1):
• Öffentlicher Gesundheitsdienst (Behörden)
• Ambulante Versorgung in der Praxis
• Stationäre Versorgung im Krankenhaus
Aufgaben des Gesundheitswesens
Der Begriff »Gesundheitswesen« gliedert sich in drei eigenständige Aufgabenbereiche:
Gesundheitsschutz
Dazu gehören Maßnahmen der allgemeinen Hygiene und der Sozialhygiene wie Umwelt- und Ortshygiene (z. B. Trink-, Brauchwasserversorgung, Abfallbeseitigung, Schulen, Kindergärten), Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygiene im Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, der Strahlenschutz, Maßnahmen der Unfallverhütung, Mitwirkung bei der Gewerbeaufsicht u. a. m.
Gesundheitspflege
Sie hat die Aufgabe, Menschen vor gesundheitsschädlichem Handeln zu bewahren, und umfasst alle Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (z. B. Gesundheitsaufklärung, Mütterberatung – primäre Prävention), den Schutz vor Erkrankung bei Gefährdeten (z. B. Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, Impfprophylaxe – sekundäre Prävention), die Bewahrung vor weiteren Krankheitsgefahren bei bereits Erkrankten (z. B. bei der Krebsbekämpfung – tertiäre Prävention) und alle Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge. Nach dem Modell der Gesundheitspflege sollen gesundheitsförderliche Entwicklungen erkannt und wirksam unterstützt werden.
Kurative Medizin
Darunter versteht man alle Möglichkeiten der ambulanten Versorgung durch niedergelassene Ärzte und Zahnärzte und der stationären Versorgung im Krankenhaus, um bei Erkrankten oder Verletzten die Gesundheit wiederherstellen zu können. In diesen Bereich gehören auch die Maßnahmen zur Wiedereingliederung von körperlich, geistig oder seelisch behinderten Menschen in das Alltags- und Berufsleben (Rehabilitation).
Die genannten Aufgabenbereiche des Gesundheitswesens werden durch den öffentlichen Gesundheitsdienst, das Krankenhauswesen und die ambulante Versorgung von Erkrankten durch niedergelassene Ärzte wahrgenommen.
Gesundheitsgesetzgebung
In der Bundesrepublik Deutschland gehört die Durchführung der Gesetze über das Gesundheitsrecht zur Zuständigkeit der Länder unter Oberaufsicht des Bundes.
Im Gesundheitsrecht sind die Vorschriften über die öffentliche Gesundheitspflege enthalten, besonders über die Heilberufe, die Apotheken, den Verkehr mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln, Impfstoffen und Seren, die allgemeine Gesundheitsfürsorge, die Seuchenbekämpfung, die Lebensmittelhygiene und das Veterinärwesen.
Grundlagen der Gesundheitsgesetzgebung (Legislative)
Bereiche der Bundesgesetzgebung sind alle Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren (Infektionsschutzgesetz), die Zulassung zu Heilberufen, Heilhilfsberufen und zum Heilgewerbe, der Verkehr mit Arzneien, Heil- und Betäubungsmitteln und Giften und die Gesundheitsfürsorge (z. B. Bundessozialhilfegesetz).
In den Bereich der Länder gehören die Gesetze über die Berufsvertretungen und über die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker (Kammergesetze) und Gesetze über die Einrichtung von Behörden (Medizinaluntersuchungsämter, Landesimpfanstalten, Gesundheitsämter u. a.), die mit der Durchführung der Gesundheitsgesetze betraut sind.
Öffentlicher Gesundheitsdienst
Der öffentliche Gesundheitsdienst umfasst die Gesundheitsbehörden des Bundes und der Länder sowie die Gesundheitsämter auf kommunaler Ebene.
Aufbau und Verwaltung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Exekutive)
Die Gesundheitsaufsicht und Verwaltung im gesamten Bundesbereich obliegt dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit seiner Gliederung in Abteilungen, Unterabteilungen und Referate für das Gesundheitswesen und dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV).
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat seinen Sitz in Braunschweig mit Dienststellen in Braunschweig und Berlin. Es übernimmt Aufgaben im Bereich des Risikomanagements. Dazu gehört der Betrieb eines europäischen Schnellwarnsystems vor gefährlichen Lebensmitteln und Futtermitteln. Die einzelnen Referate erfüllen Aufgaben in der Überwachung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Futtermitteln, Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneimitteln sowie in der Überprüfung von Arzneimittelrückständen in Lebensmitteln. Ein weiterer Schwerpunkt des BVL liegt in der Durchführung von Zulassungsverfahren für Tierarzneimittel.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gehört zum Geschäftsbereich des BMELV und ist eine wissenschaftliche Einrichtung mit Sitz in Berlin. Es nimmt durch eigene Forschung wichtige Aufgaben bei der Verbesserung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit wahr.
Das BVL überwacht und prüft
• Verbraucherschutz in der EU
• Betrieb eines Schnellwarnsystems
• Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
• Futtermittel
• Pflanzenschutzmittel
• Tierarzneimittel (Zulassung und Registrierung)
• Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln
Das BfR ist ein Forschungsinstitut zum Schutz der Gesundheit des Verbrauchers vor
• Gefahren und Risiken
• Irreführung und Täuschung
Auf Landesebene sind meist das Innenministerium oder in einigen Bundesländern auch dem Sozialministerium zugeordnete Gesundheitsabteilungen die oberste Gesundheitsbehörde.
Der Unterstützung dieser Landesbehörden und der Erledigung selbstständiger Aufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitswesens dienen besondere Einrichtungen:
• Landes- oder Medizinaluntersuchungsämter für das Gesundheitswesen sind Einrichtungen zur Seuchendiagnostik und Seuchenbekämpfung bei Mensch und Tier.
• Landesimpfanstalten.
• Standesorganisationen in allen Ländern (Ärztekammern und Tierärztekammern).
Zusätzlich zu den ärztlichen Standesorganisationen als Berufsvertretungen gibt es in allen Ländern auf Grund der kassenärztlichen Vorschriften die sog. kassenärztlichen Vereinigungen. Dies sind Stellen, die als Berater der Versicherungsträger auftreten und die Belange der Kassenärzte diesen gegenüber wahrnehmen.
Auf kommunaler Ebene leistet das Gesundheitsamt die Basisarbeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes in der Bevölkerung. Es wird von einem Amtsarzt geleitet. Neben dem ärztlichen Personal sind in den Gesundheitsämtern MTA, medizinische Fachangestellte (früher Arzthelferinnen genannt), Gesundheitsingenieure, Gesundheitsaufseher bzw. Hygieneinspektoren, Sozialarbeiter und Verwaltungspersonal angestellt. Die Gesundheitsämter überwachen die Durchführung der Gesundheitsgesetzgebung (insbesondere das Infektionsschutzgesetz) und sind ärztliche Berater der Kreisverwaltungsbehörden, die in den Landkreisen und kreisfreien Städten Vollzugsorgan der Gesundheitsaufsicht sind.
Aufgaben des Gesundheitsamtes im Einzelnen sind:
• das Bewusstsein zur persönlichen Gesundheitspflege zu fördern (Gesundheitserziehung),
• die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung fachlich zu beaufsichtigen (Aufsicht über die Arztpraxen, das ärztliche Hilfspersonal, die Apotheken und die Krankenanstalten),
• die allgemeinen hygienischen und sozialhygienischen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge (Prävention) durchzuführen,
• die Gesundheitsfürsorge für Kranke, Behinderte und Süchtige zu betreiben,
• innerhalb des Gutachterwesens amtsärztlich (Ausstellung von Zeugnissen und Erstellung von Gutachten), gerichtsärztlich und vertrauensärztlich (Untersuchung der Arbeitsfähigkeit) tätig zu sein.
1.1.2 Berufe im Gesundheitswesen
Heilberufe
Zu den Heilberufen zählen der Arzt, der Zahnarzt, der Tierarzt und der Apotheker. Ihre Ausbildung und Berufsausübung sind in entsprechenden staatlichen Zulassungen (Approbation) und einer Berufsordnung gesetzlich geregelt. Jeder Angehörige dieser Berufsstände ist in seinem Bundesland Pflichtmitglied der jeweiligen Berufsvertretung (Landesärztekammer, Landeszahnärztekammer, Landestierärztekammer, Landesapothekerkammer).
Die Kammern haben als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Unterstützung der Kreis- und Bezirksverbände u. a. die Aufgabe, im Rahmen der Gesetze die beruflichen Belange der genannten Berufsstände wahrzunehmen und in der öffentlichen Gesundheitspflege mitzuwirken.
Arzt
Aufgabe des Arztes ist es, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie Leiden zu lindern. Der Arzt übt seinen Beruf nach den Geboten der Menschlichkeit aus. Er dient nach § 1 der Bundesärzteordnung der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes.
Weitere Grundsätze seiner Berufsausübung sind in einer Reihe von Bestimmungen in der ärztlichen Berufsordnung festgelegt. Hierzu gehört insbesondere auch die Verpflichtung über das, was ihm in seiner Eigenschaft als Arzt anvertraut oder bekannt geworden ist, zu schweigen. Nach erfolgreicher Beendigung des Medizinstudiums und Nachweis der geforderten Praktikantenzeit wird auf Antrag bei der zuständigen Behörde des Landes die Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Berufes erteilt.
Die meisten Ärzte bemühen sich nach der Approbation um eine Weiterbildung zum Facharzt auf den vielfältigen Gebieten und Teilgebieten ärztlicher Tätigkeit. Sie üben dann ihren Beruf in der freien Praxis, im Krankenhaus, im öffentlichen Gesundheitsdienst, in der Bundeswehr oder in vielen weiteren Bereichen der Medizin aus.
Eine Teilgebietsbezeichnung darf ein Arzt erst führen, wenn er eine über das Gebiet hinausgehende Weiterbildung in dem speziellen Teilgebiet abgeschlossen hat.
Zahnarzt
Aufgabe des Zahnarztes ist die Erkennung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Er ist ferner mit der Eingliederung von Zahnersatz (zahnärztliche Prothetik) und der Behandlung falsch stehender Zähne oder falsch geformter Kiefer (Kieferorthopädie) beschäftigt.
Nach einem fünfjährigen Studium der Zahnmedizin und bestandener Prüfung erhält der Zahnarzt die Approbation, die ihn zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes berechtigt.
Tierarzt
Apotheker
Aufgaben des Apothekers sind die kunstgerechte Ausführung ärztlicher Rezepte, die Herstellung und Abgabe von Heilmitteln, für deren einwandfreie Beschaffenheit er verantwortlich ist.
Die Apotheke ist ein Gewerbebetrieb für Zubereitung und Verkauf von Arzneimitteln nach ärztlicher Vorschrift (Rezept) oder im Handverkauf. Nach einem mehrjährigen Studium der Pharmazie und einer praktischen Ausbildung in einer Lehrapotheke und bestandener staatlicher Prüfung ist der Apotheker nach erteilter Approbation zur Führung einer Apotheke berechtigt.
Neben dem Apotheker ist unter den Heilberufen nur der Tierarzt berechtigt, Arzneimittel selbst herzustellen, vorrätig zu halten und abzugeben (vergl. tierärztliches Dispensierrecht).
Die Berufsbezeichnungen Heilpraktiker bzw. Tierheilpraktiker gehören nicht den genannten Heilberufen, sondern dem Heilgewerbe an. Darunter versteht man die Ausübung der Heilkunde bzw. Tierheilkunde durch nicht approbierte Personen. Heilpraktiker sind an gesetzliche Berufsbedingungen (Heilpraktikergesetz) gebunden und üben die Heilkunde auf der Grundlage einer staatlichen Genehmigung nach Prüfung durch den Amtsarzt aus.
Gesundheitsfach- und Krankenpflegeberufe
Für die vielfältigen Bereiche des Gesundheitswesens gibt es eine Fülle von Berufszweigen, die sich in Fachangestellte (medizinisch, zahnmedizinisch, tiermedizinisch), Krankenpflegeberufe, diagnostisch-technische Berufe und therapeutisch-rehabilitative Berufe aufteilen lassen.
Fachangestellte bei Heilberufen
In jedem Bereich der vier Heilberufe gibt es Fachangestellte, deren Ausbildung auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses erfolgt. Die Fachangestellten bei Arzt, Zahnarzt, Tierarzt sowie die PKA (Pharmazeutischkaufmännische Angestellte) erhalten im Allgemeinen nach einer dreijährigen Ausbildung in der Praxis bzw. Apotheke und in der Berufsschule und nach bestandener Abschlussprüfung ein Zeugnis und eine Urkunde, die sie berechtigt, die jeweilige Berufsbezeichnung zu führen. Die Fachangestellten üben ihren Beruf vorwiegend in der freien Praxis bzw. Apotheke aus. Medizinische Fachangestellte werden auch in Krankenhäusern und bei Gesundheitsbehörden beschäftigt. Zur Ausbildung und Berufstätigkeit der TFA  1.3, 1.4
1.3, 1.4
Diagnostisch-technische Berufe
Angehörige dieser Berufsgruppe sind für die medizinische Assistenz von besonderer Bedeutung. Sie üben ihre Tätigkeit als medizinische/r Laboratoriumsassistent/in (MTA), medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in oder als veterinärmedizinisch-technische/r Assistent/in (VMTA) hauptsächlich in Krankenhäusern (Laboratorien, Röntgenabteilungen), Arztpraxen und Untersuchungsämtern aus. Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) arbeiten in Apotheken unter Aufsicht eines Apothekers oder in der pharmazeutischen Industrie.
Die Ausbildung für diese Berufe ist durch Bundesgesetze geregelt und erfolgt an anerkannten Lehranstalten. Voraussetzung für die Zulassung ist die abgeschlossene Realschulbildung.
Zytologie-Assistenten sind dem Arzt bei der Herstellung und Auswertung zytologischer Präparate (z. B. Zellabstriche im Rahmen der Krebsfrüherkennung) behilflich. Die Ausbildung erfolgt in Berufsfachschulen.
Therapeutisch-rehabilitative Berufe
Darunter versteht man Berufe, die dem Arzt insbesondere bei der physikalischen Behandlung von Patienten (z. B. Massagen, Bäder, Bestrahlungen, Übungsbehandlungen) und bei der Wiederherstellung der Gesundheit bei körperlichen und seelischen Leiden (Rehabilitation) behilflich sind.
Masseure, medizinische Bademeister und Krankengymnasten (Physiotherapeuten) haben nach ihren staatlich vorgeschriebenen Ausbildungsgängen auch die Möglichkeit, freiberuflich in eigener Praxis tätig zu sein.
Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten (Ergotherapeuten) sind nach einer ebenfalls gesetzlich geregelten dreijährigen Ausbildungsdauer in orthopädischen Kliniken, Nervenkrankenhäusern, Altenpflegeheimen und Rehabilitationszentren tätig.
Logopäden werden nach Abschluss einer dreijährigen, staatlich geregelten Ausbildung auf Anordnung des Arztes bei der Diagnostik und Therapie von Hör-, Stimm- und Sprachkrankheiten tätig.
Orthoptisten sind Therapeuten für Sehstörungen und Helfer des Augenarztes bei Sehübungen und Augenmuskeltraining der Patienten.
Krankenpflegeberufe
Die Berufsbezeichnungen der »Krankenschwester« bzw. der »Kinderkrankenschwester« wurden aufgegeben und durch »Gesundheits- und Krankenpflegerin« ersetzt. Voraussetzungen für die Zulassung zur jeweiligen Berufsbezeichnung sind der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung und das vollendete 17. Lebensjahr. Nach erfolgreichem Abschluss einer 3-jährigen theoretischen und praktischen Ausbildung an staatlichen oder staatlich anerkannten Schulen können die oben genannten Berufsbezeichnungen getragen werden. Bei der Krankenpflegehelferin bzw. beim Krankenpflegehelfer genügt nach Hauptschulabschluss eine einjährige Ausbildung. Die Ausübung dieser Berufe findet hauptsächlich in Krankenhäusern oder in der ambulanten Krankenpflege statt.
Als weitere Berufe im Gesundheitswesen seien noch die Hebamme bzw. der Entbindungspfleger und die Diätassistentin genannt, deren Ausbildung ebenfalls durch ein Bundesgesetz geregelt ist.
Der Rettungssanitäter hat seine Aufgaben in der Besetzung des Rettungswagens, erste Hilfe bei Notfällen zu leisten und in der Assistenz für den Notarzt.
Veterinärhilfsberufe
In veterinärmedizinischen Ausbildungsstätten, Untersuchungsämtern und biologischen Forschungseinrichtungen wird technische Assistenz benötigt. Diese Tätigkeit wird von VMTA und veterinärmedizinischen Laboranten ausgeführt, deren Ausbildung in Berufsfachschulen abgeleistet wird.
Von VMTA werden Hilfeleistungen und selbstständige Tätigkeiten bei zytologischen und histologischen Untersuchungen erbracht. Ihre Arbeitsgebiete liegen in der klinischen Chemie, der Hämatologie, Serologie, Mikrobiologie, Parasitologie und auf dem Gebiet der Untersuchung von Lebensmitteln tierischer Herkunft.
Neben den tiermedizinischen Fachangestellten mit ihrem vorwiegenden Tätigkeitsbereich in Praxis und Klinik stehen dem Tierarzt in größeren Tierkliniken und in Einrichtungen mit Versuchstierhaltung Tierpfleger als unentbehrliche Helfer für die ordnungsgemäße Haltung und Pflege des Tierbestandes zur Verfügung. Eine systematische Ausbildung dieses Berufszweiges erfolgt in Tierkliniken, zoologischen Gärten, Tierheimen, Versuchstierzuchten und biologisch forschenden Industriebetrieben.
Tiergesundheitspfleger sind in Hessen in Veterinärämtern für den Tiergesundheitsdienst, die Tierseuchenbekämpfung, die Tierkörperbeseitigung und den Tierschutz tätig.
In der Schlachttier- und Fleischbeschau sind Fleischkontrolleure beschäftigt, die in einem mehrwöchigen Lehrgang ausgebildet werden.
Geflügelfleischkontrolleure sind an der Seite des amtlichen Tierarztes an der Untersuchung des Schlachtgeflügels und bei der Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften beteiligt.
In der Lebensmittelüberwachung und im öffentlichen Veterinärwesen sind fachlich ausgebildete Lebensmittelkontrolleure und Gesundheitsaufseher eingesetzt.
Aus dem Tierzuchtbereich sei noch der Besamungswart genannt, dessen Tätigkeitsfeld in der künstlichen Besamung von Rindern und Schweinen an Besamungsstationen oder im tierärztlichen Praxisbereich liegt. Bewerber müssen eine landwirtschaftliche Vorbildung besitzen und werden in einem Lehrgang zum Besamungswart ausgebildet.
1.1.3 Veterinärwesen
Unter dem Begriff »Veterinärwesen« wird die Gesamtheit aller amtlichen tierärztlichen Tätigkeiten und Aufgaben zusammengefasst. Im Veterinärwesen erfüllt der Amtstierarzt viele öffentliche Aufgaben, die dem Schutz des Menschen vor gesundheitlichen Gefahren dienen und ihm durch Gesetz übertragen worden sind. Dadurch sind enge Verbindungen zu Aufgaben des Gesundheitsschutzes und Wechselwirkungen mit Institutionen des öffentlichen Gesundheitsdienstes gegeben.
Rechtliche Grundlagen
Zu den rechtlichen Grundlagen der tierärztlichen Berufsausübung zählen das Berufsrecht (Bundes-Tierärzteordnung, Tierärztekammerrecht), das Tierseuchenrecht, das Fleischbeschaurecht, das Geflügelfleischhygienerecht, das Lebensmittelrecht, das Arzneimittel- und Dispensierrecht, das Futtermittelrecht, das Tierschutzrecht, das Bundes-Seuchenrecht und ferner solche aus den Bereichen der Tierzucht, des Tierkaufs, des Umweltschutzes, der Tierkörperbeseitigung u. a. m.
Aufgaben des öffentlichen Veterinärwesens
Für das öffentliche Veterinärwesen gibt es grundlegende Aufgaben, deren Ziel und Verpflichtung der Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie das Allgemeinwohl sind.
• Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten der Tiere (Tierseuchen).
• Schutz des Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten (Zoonosen).
• Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel tierischer Herkunft.
• Erhaltung und Entwicklung eines leistungsfähigen Tierbestandes.
• Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen, die von Tieren sowie vom Tier stammenden Erzeugnissen und Abfällen ausgehen.
• Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere (Tierschutz).
Die Hauptaufgaben erstrecken sich somit auf die Bereiche der Tierhaltung (Tierzucht, Tiergesundheitsschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz), des Verbraucherschutzes (Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Lebensmittelhygiene, Rückstandsprobleme durch Zusatzstoffe und Tierarzneimittel, Schutz vor Irreführung und Täuschung) und der Umwelthygiene (Umweltbelastung durch Tierhaltung, Tierkörperbeseitigung).
Die genannten Aufgaben werden von beamteten Tierärzten im höheren Veterinärverwaltungsdienst wahrgenommen.
Aufbau des öffentlichen Veterinärwesens
Wesentliche Funktionen des Veterinärwesens sind durch Bundesrecht geregelt und werden in der Europäischen Gemeinschaft (EG) normiert.
Auf Bundesebene ist die Veterinärverwaltung in verschiedenen Referaten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) vertreten.
Die Bundesministerien werden zur Erfüllung ihrer Funktionen von verschiedenen Bundesinstituten, wie dem für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und dem Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel sowie dem deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) unterstützt.
Weitere Einrichtungen des BMELV sind für das öffentliche Veterinärwesen von besonderer Bedeutung. Dies sind u. a. das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit mit Sitz in Greifswald-Insel Riems und weiteren Standorten, das Max-Rubner-Institut (MRI) als Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel sowie das Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) als Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei.
In den Ländern ist das öffentliche Veterinärwesen in drei Verwaltungsebenen (Ministerium, Bezirksregierung, Kreis) präsent. Oberste Veterinärbehörden in den Ländern sind die jeweiligen Ministerien für Soziales oder Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Der Unterstützung dieser Landesbehörden dienen staatliche Veterinäruntersuchungsämter, die Laboruntersuchungen durchführen und wissenschaftliche Gutachten erstellen. In Bayern hat man ärztliche, tierärztliche und chemische Untersuchungsämter zu Landesuntersuchungsämtern für das Gesundheitswesen zusammengeschlossen.
| Aufbau des öffentlichen Veterinärwesens | ||
Bund | BMELV • Verschiedene Abteilungen (Lebensmittelrecht, Tiergesundheit, Veterinärwesen u. a.) • BfR | BVL • Verbraucherschutz • Lebensmittelsicherheit • Futtermittel • Tierarzneimittel |
Länder | • Referate für Veterinärwesen in den Sozial- bzw. Ernährungs- und Landwirtschaftsministerien • Veterinäruntersuchungsämter • Tiergesundheitsdienste |
|
Regierungsbezirke | • Referate für Veterinärwesen in den Bezirksregierungen |
|
Kreise | • Staatliche und kommunale Veterinärämter |
|
Daneben bestehen auf Landesebene noch Tiergesundheitsdienste bzw. Tiergesundheitsämter, die vorbeugende Maßnahmen und eine planmäßige Bekämpfung von weitverbreiteten Tierkrankheiten und Gesundheitsstörungen durchführen sollen.
Die Sachbearbeiter für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen in den Bezirksregierungen haben neben ihren öffentlichen Aufgaben auch die Dienst- und Fachaufsicht über die Untersuchungsämter und die Kreisverwaltungen.
Auf der unteren Verwaltungsebene führen staatliche und kommunale Veterinärämter die Aufgaben des öffentlichen Veterinärwesens durch. Sie bilden das Fundament im Aufbau der Veterinärverwaltung.
Aufgaben des Veterinärwesens im Landkreis
• Aufgaben des Amtstierarztes nach Landesrecht
• Tierseuchenbekämpfung
• Mitwirkung bei der Tierzucht
• Tierschutz, Tiergesundheit
• Schlachttier- und Fleischuntersuchung
• Lebensmittelüberwachung
• Tierkörperbeseitigung
1.2 Der tierärztliche Berufsstand und seine Organisation
1.2.1 Der tierärztliche Beruf
Ausbildung
Die Ausbildung zum Tierarzt erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland an den veterinärmedizinischen Fakultäten der jeweiligen Universitäten oder an einer Tierärztlichen Hochschule. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums der Tiermedizin (Tierärztliche Prüfung) erhält der Studierende auf Antrag die Bestallung (Approbation) als Tierarzt bei der zuständigen Behörde des Landes, in dem die Prüfung abgelegt wurde. Die Approbation erlaubt dem Tierarzt die Ausübung des tierärztlichen Berufs. Demnach darf die Berufsbezeichnung »Tierarzt« nur führen, wer approbierter Tierarzt ist oder die Erlaubnis zur Ausübung des tierärztlichen Berufes besitzt. Unabhängig davon ist ein Tierarzt erst nach einer fertiggestellten und beim Dekanat eingereichten wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) und einer erfolgreich abgelegten mündlichen Doktorprüfung berechtigt, die Doktorwürde (Promotion) zu tragen. Nach geeigneter Veröffentlichung seiner Doktorarbeit darf der Tierarzt den Titel »Dr. med. vet.« führen.
Weiterbildung
Viele Tierärzte bemühen sich, auch nach der Approbation, ihre Erfahrungen und Kenntnisse auf bestimmten Gebieten ihrer Berufstätigkeit zu vertiefen. Diese Weiterbildung ist auf Grund der Kammergesetze der Länder in den entsprechenden Weiterbildungsordnungen gesetzlich geregelt worden. Dauer und Inhalt der Weiterbildung in den jeweiligen Gebieten richten sich nach den Bestimmungen, die in der Anlage zur Weiterbildungsordnung festgelegt sind.
Die Anerkennung zum Führen einer Fachtierarztbezeichnung erhält der Tierarzt nach abgeschlossener Weiterbildung durch seine Landestierärztekammer nach einer vor einem besonderen Prüfungsausschuss abgelegten Prüfung.
Beispiele für Fachtierarzt- und Zusatzbezeichnungen nach einer Weiterbildung
Fachtierarztgebiete: Pferde, Rinder, Kleintiere, Schweine, Geflügel, Chirurgie, Innere Medizin, Fortpflanzung, Pathologie, Mikrobiologie, Parasitologie, Lebensmittelhygiene, Tierernährung u. a. m.
Zusatzbezeichnungen: Augenheilkunde, Zahnheilkunde, Dermatologie, Homöopathie, Akupunktur, Verhaltenstherapie, Qualitäts- und Umweltmanagement u. a. m.
Ein Fachtierarzt sollte entsprechend seiner Gebietsbezeichnung grundsätzlich nur in diesem Gebiet tätig werden. Er kann jedoch weiterhin als niedergelassener praktizierender Tierarzt tätig sein, wenn er neben seiner Fachtierarztbezeichnung auch die Bezeichnung »prakt. Tierarzt« führt.
Unabhängig von einer Weiterbildung haben die Tierärzte, die ihren Beruf ausüben, gemäß ihrer Berufsordnung eine Fortbildungspflicht (Lesen von Fachliteratur, regelmäßiger Besuch von Fortbildungsveranstaltungen und Fachkongressen), und sich dabei über die für ihre Berufsausübung geltenden Bestimmungen zu unterrichten.
Tätigkeit als Tierarzt
Die Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO) definiert das tierärztliche Berufsbild. Die tierärztlichen Berufsaufgaben erstrecken sich auf folgende drei medizinisch und volkswirtschaftlich bestimmte Schwerpunkte im Dienst an den Menschen:
• Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere (Tiererhaltung).
• Vermehrung des dem Menschen nutzbaren Tierbestandes (Tiervermehrung).
• Verwertung der Tiere vornehmlich zur Gewinnung gesundheitsunschädlicher Lebensmittel (Tierverwertung).
Nach § 1 der Bundes-Tierärzteordnung vom 18. Februar 1986 ist
(1) der Tierarzt berufen, Leiden und Krankheiten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, zur Erhaltung und Entwicklung eines leistungsfähigen Tierbestandes beizutragen, den Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten sowie durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft zu schützen und auf eine Steigerung der Güte von Lebensmitteln tierischer Herkunft hinzuwirken.
(2) Der tierärztliche Beruf ist kein Gewerbe; er ist seiner Natur nach ein freier Beruf.
Die tierärztlichen Berufstätigkeiten schließen nach der Approbation gemäß den Berufsaufgaben des Tierarztes mehrere Möglichkeiten ein:
• Niederlassung als praktizierender Tierarzt in eigener Groß- und/oder Kleintierpraxis oder als Assistent bzw. als Vertreter in einer solchen Praxis.
• Niederlassung als Fachtierarzt mit angegebener Gebietsbezeichnung.
• Tierarzt in der pharmazeutischen Industrie und Forschung (z. B. als Pharmakologe, Mikrobiologe, Pathologe).
• Tierarzt in der freien Wirtschaft (z. B. Futtermittelindustrie, Fleischwaren- und Lebensmittelindustrie).
• Tierarzt in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
• Tierarzt in der Veterinärverwaltung und in der amtlichen Lebensmittelüberwachung (sog. Amtstierärzte im Verwaltungsdienst des Bundes, der Länder und Kreise).
• Tierarzt in Untersuchungs- und Forschungsanstalten.
• Tierarzt im Tiergesundheitsdienst landwirtschaftlicher Organisationen (z. B. Rindergesundheitsdienst).
• Tierarzt in akademischen Ausbildungsstätten und Instituten.
• Tierarzt in der Bundeswehr (Veterinäroffiziere überwachen innerhalb der Bundeswehr den Verkehr mit Lebensmitteln tierischer Herkunft).
• Tierarzt in der Entwicklungshilfe (die Tätigkeit insbesondere in tropischen Ländern wird als technische Hilfe von der Bundesregierung, der Europäischen Gemeinschaft sowie von internationalen Organisationen getragen).
Ferner können Tierärzte zusätzlich auf vielen weiteren Gebieten tätig werden, z. B. in zoologischen Gärten, in der Fisch-, Pelztier- und Bienenkunde, in tierärztlichen Berufsorganisationen, als Lehrer und Berater in landwirtschaftlichen Schulen, Berufsschulen und in Lehranstalten für Veterinärhilfsberufe.
1.2.2 Die tierärztlichen Berufsvertretungen
Der Tierarzt erfüllt eine öffentliche Aufgabe. Die tierärztlichen Berufsaufgaben sind durch die Bundes-Tierärzteordnung gesetzlich und bundeseinheitlich geordnet. Entsprechend dem föderalistischen Aufbau nach dem Grundgesetz obliegt die Überwachung der Erfüllung dieser Berufspflichten den einzelnen Bundesländern. Zu diesem Zweck wurden gemeinsam für die vier Heilberufe Gesetze über die »Berufsvertretung und über die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker« (Kammergesetze) erlassen.
Tierärztekammer und Bezirksverbände
Durch diese Gesetze wurden in allen Bundesländern Landestierärztekammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts geschaffen.
Darunter versteht man Organisationen, deren Existenz gesetzlich verankert ist. Sie erfüllen Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen. Ihre Mitglieder sind alle auf Grund einer Pflichtmitgliedschaft Angehörige einer bestimmten Berufsgruppe. So sind auch alle Tierärzte Pflichtmitglieder ihrer Kammer. Die Berufsvertretung der Tierärzte besteht aus den Landestierärztekammern und den tierärztlichen Bezirksverbänden, die für den Bereich eines Regierungsbezirks gebildet wurden (z. B. Tierärztlicher Bezirksverband Oberbayern für den Regierungsbezirk Oberbayern). Sie stehen unter der Aufsicht ihrer Landestierärztekammer und der für den Sitz des Bezirksverbandes zuständigen Regierung. Sie sind ebenfalls Körperschaften des öffentlichen Rechts.
Die Kammern und Bezirksverbände haben in berufsständischer Selbstverwaltung die Aufgabe der Förderung und des Schutzes des tierärztlichen Berufs.
Nach dem Kammergesetz bestehen für die Berufsvertretung dabei folgende Rechte und Pflichten:
• Regelung der beruflichen Belange der Tierärzte in einer Berufsordnung (Berufsausübung, Weiterbildung).
• Überwachung der Erfüllung tierärztlicher Berufspflichten (Berufsaufsicht).
• Hinwirken auf ein gedeihliches Verhältnis der Tierärzte untereinander und von Tierärzten zu Dritten (Schlichtung bei Streitigkeiten).
• Förderung der tierärztlichen Fortbildung.
• Schaffung von Wohlfahrtseinrichtungen für Tierärzte und deren Angehörige.
• Mitwirkung in der öffentlichen Gesundheitspflege.
• Beantwortung von Anfragen der Behörden und ggf. Erstellung von Gutachten.
Außerdem sind die jeweiligen Landestierärztekammern die zuständige Stelle für die Ausbildung zur/zum TFA.
Die Wahl der Delegierten der Landestierärztekammern erfolgt durch ihre Mitglieder in bestimmten, mehrjährigen Abständen. Aus den gewählten Delegierten setzt sich die Delegiertenversammlung zusammen, der es nach Artikel 13 des Kammergesetzes obliegt, den Vorstand und die erforderlichen Kammerausschüsse (z. B. Prüfungsausschuss, Weiterbildungsausschuss, Schlichtungsausschuss) zu wählen. Die Delegiertenversammlung versteht sich somit als »Parlament des tierärztlichen Berufsstandes«.
Bundestierärztekammer e. V.
Die Dachorganisation des gesamten tierärztlichen Berufsstandes ist die Bundestierärztekammer (BTK) zu der sich sämtliche Tierärztekammern der Länder und die freien tierärztlichen Berufsverbände in der Bundesrepublik Deutschland zusammengeschlossen haben.
Die BTK hat 31 Mitglieder, davon 17 Tierärztekammern und 14 freie Berufsvereinigungen. Die BTK wird von ihrem Präsidenten geleitet und nach außen vertreten, der von der Delegiertenversammlung auf vier Jahre gewählt wird.
Neben Aufgaben zur Berufspolitik (u. a. Förderung der Zusammenarbeit innerhalb des tierärztlichen Berufsstandes, Beratung der gesetzgebenden Körperschaften des Bundes und der Bundesregierung, Pflege der Verbindungen zu den tierärztlichen Vereinigungen des Auslandes) nimmt die Bundestierärztekammer durch die Akademie für Tierärztliche Fortbildung (ATF) in einer Vielzahl von Fachtagungen, wissenschaftlichen Veranstaltungen und Seminaren die Verpflichtung zur Fortbildung der Tierärzte wahr.
In dem von der BTK herausgegebenen Deutschen Tierärzteblatt werden monatlich aktuelle Berichte und Nachrichten der Kammern und Verbände bekannt gegeben.
Tierärztliche Vereinigungen innerhalb der BTK
Neben den Tierärztekammern und Bezirksverbänden besteht eine Vielzahl von freien Berufsvereinigungen mit freiwilliger Mitgliedschaft, die verschiedene Berufsgruppen innerhalb der Tierärzteschaft repräsentieren, z. B. der Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. (bpt), der Bundesverband der beamteten Tierärzte (BbT), die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) oder der Verband Deutscher Tierarztfrauen und Tierärztinnen (VDTT).
Wissenschaftliche Vereinigungen wie die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V. (DVG) mit ihren verschiedenen Fachgruppen sind Zusammenschlüsse von Tierärzten zur Förderung der Wissenschaft. Sie veranstalten Fachkongresse in regionalem, bundesweitem und internationalem Rahmen. Deutsche Fachgruppen dieser Verbände sind auch internationalen Fachorganisationen angegliedert.
1.2.3 Für die Veterinärmedizin relevante Gesetze und Verordnungen
(in der jeweils gültigen Fassung)
Berufsstand
• Approbationsordnung für Tierärzte (TAppO)
• Berufsordnung der Landestierärztekammern
• Bundes-Tierärzteordnung
• Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) v. 8. Juli 2008
• Gesetz über die Berufsvertretungen und über die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker (Kammergesetz)
• Medizingeräteverordnung (MedGV)
• Röntgenverordnung (RöV) – Strahlenschutzmaßnahmen
• Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Tiermedizinischen Fachangestellten
• Weiterbildungsordnung
Arzneimittel
• Arzneimittelgesetz (AMG)
• Wesentliche Vorschriften des AM-Rechts (September 2005)
• Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) v. 13. Dezember 2010
• Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
• Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV)
• Tierärztliches Dispensierrecht (11. AMG-Novelle 2002)
• Verordnung über tierärztliche Hausapotheken (TÄHAV)
Lebensmittel
• Fleischhygienegesetz (FlHG) und Fleischhygieneverordnung (FlHV)
• Fischhygiene-Verordnung (FischHV)
• Geflügelfleischhygienegesetz (GFlHG) und -Verordnung (GFlHV)
• Hackfleischverordnung (HFlV)
• Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz (LMBG)
• Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV)
• Milchverordnung
Tiergesundheit, Hygiene, Tierkauf, Tierschutz, Tierzucht
• Abfallbeseitigungsgesetz
• Futtermittelgesetz (FutMG)
• Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz, IfSG)
• Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)
• Tierimpfstoff-Verordnung
• Tollwut-Verordnung
• Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen
• Verordnung über meldepflichtige Tierseuchen
• Verordnung zum Schutz gegen die vesikuläre Schweinekrankheit
• Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG)
• Tierkaufrecht nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der jeweils gültigen Fassung
• Tierschutzgesetz (TierSchG) neugefasst 2006, zuletzt geändert 2010
• Tierzuchtgesetz (TierZG)
Unfallschutz
• Arbeitssicherheitsgesetz
• Biostoff-Verordnung
• Richtlinien für Laboratorien (GUV)
• Unfallverhütungsvorschriften (GUV)
 14.4 Auswahl wichtiger Rechtsvorschriften
14.4 Auswahl wichtiger Rechtsvorschriften
1.3 Ausbildung zur/zum Tiermedizinischen Fachangestellten (TFA)
1.3.1 Berufsausbildung
Der Ausbildungsberuf »Tiermedizinische Fachangestellte (TFA)« ist dem Berufsfeld Gesundheit zugeordnet. Er ist eng mit der Tätigkeit des Tierarztes in der Groß- bzw. Kleintierpraxis verbunden.
Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur TFA vom 1. August 2006 ist die Ausbildung und deren Dauer von 3 Jahren gesetzlich geregelt und der Beruf der TFA als medizinischer Assistenzberuf staatlich anerkannt.
Berufswahl
Nicht selten sind der Besitz von Haustieren und die Bereitschaft bei der Untersuchung und Behandlung kranker Tiere zu helfen die Beweggründe, eine Ausbildungsstelle als TFA in der Praxis eines niedergelassenen Tierarztes zu suchen. Dies kommt häufig durch persönliche Kontaktaufnahme mit einem Tierarzt, Anzeigen im deutschen Tierärzteblatt, Vermittlung der Berufsberatung und durch schriftliche Bewerbung zustande.
Für den Beginn der Berufsausbildung ist ein Mindestalter von 16 Jahren vorgeschrieben. Die Anforderungen der tierärztlichen Praxis setzen eine besondere Eignung und ein Einfühlungsvermögen im Umgang mit Tieren und Tierbesitzern voraus. Sie verlangen neben einer schnellen Auffassungsgabe, einem guten Personen-, Namen- und Sachgedächtnis auch unbedingte Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit. Ein ausgeprägtes Gefühl für Ordnung und Sauberkeit sind für die Praxispflege und -hygiene notwendig.
Gesundheitliche Überwachung
Nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ist für Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, vor Einstellung eine ärztliche Untersuchung vorgeschrieben. Jeder Ausbildungstierarzt, der Jugendliche beschäftigt, ist verpflichtet, sich darüber eine Bescheinigung vorlegen zu lassen.
Vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres hat sich der Jugendliche einer Nachuntersuchung zu unterziehen und die Bescheinigung hierüber dem ausbildenden Tierarzt auszuhändigen.
Aus Gründen der Gesundheitspflege und zur Verhütung von Berufserkrankungen besteht auch bei Auszubildenden, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, die Verpflichtung, sich vor Einstellung ärztlich untersuchen und regelmäßig – mindestens einmal im Jahr – Nachuntersuchungen vornehmen zu lassen.
Strahlenschutz
Gemäß Röntgenverordnung (§ 29 Abs. 1 Satz 3) darf tierärztliches Hilfspersonal (TFA, Tierpfleger) Röntgenstrahlen auf Tiere nur dann anwenden, wenn es die für diese Tätigkeit notwendigen Kenntnisse im Strahlenschutz hat.
Die Kenntnisse können durch die Teilnahme an einem Strahlenschutzkurs, vermittelt durch die Tierärztekammer, erworben werden. Auch eine intensive Schulung durch den ausbildenden Tierarzt ist möglich. Die Kurse umfassen u. a. folgende Lehrinhalte:
• Allgemeine Apparatekunde
• Physikalisch-technische Grundlagen der Röntgenstrahlenerzeugung
• Grundlagen der Strahlenbiologie
• Strahlenschutz im Anwendungsbereich
• Aufnahmetechniken
• Dunkelkammerarbeit
• Strahlenschutzgesetzgebung
Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen und die erfolgreiche Teilnahme bescheinigt.
Verlauf der Ausbildung
Neben der fachlichen Ausbildung in der tierärztlichen Praxis ist der Besuch der Berufsschule für jeden Auszubildenden Pflicht. Die allgemeinen Vorschriften für diese gleichzeitige Ausbildung in Praxis und Berufsschule nach dem »dualen System« sind im Berufsbildungsgesetz (BBiG) festgelegt.
Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit einer Probezeit, die wenigstens einen Monat und höchstens drei Monate beträgt. Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.
Vor Beendigung des zweiten Ausbildungsjahres wird zur Ermittlung des Ausbildungsstandes eine Zwischenprüfung durchgeführt. Mit Bestehen der Abschlussprüfung nach drei Ausbildungsjahren endet das Berufsausbildungsverhältnis.
Bei Nichtbestehen der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis bis zum vertraglich vereinbarten Ende. Auf Verlangen der TFA wird die Ausbildungsdauer bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr verlängert.
Nach Beendigung der Probezeit ist die Kündigung nur aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist oder von der auszubildenden TFA mit einer Frist von vier Wochen bei Aufgabe der Berufsausbildung oder bei Ausbildung für eine andere Berufstätigkeit möglich (§ 15 BBiG). Weitere gesetzliche Vorschriften der Kündigung sind im Ausbildungsvertrag enthalten.
Als zuständige Stellen für die Ausbildung zur TFA gelten die Landestierärztekammern, die die Berufsausbildung überwachen, Ausbildungsverträge prüfen, in ein Verzeichnis eintragen und Prüfungsausschüsse für die Zwischen- und Abschlussprüfung errichten. Als Nachweis einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung werden von der entsprechenden Landestierärztekammer ein Zeugnis und eine Urkunde ausgehändigt (Abb. 1.2).
Ausbildungsvertrag
Nach Maßgabe der Richtlinien für die Ausbildung und Prüfung einer TFA ist zwischen einem ausbildenden Tierarzt und der auszubildenden TFA bzw. bei Minderjährigen auch deren gesetzlichem Vertreter ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen.
Die verbindlichen Inhalte dieses Vertrages sind:
§ 1: Ausbildungsdauer und Probezeit
§ 2: Pflichten des ausbildenden Tierarztes
§ 3: Pflichten der Auszubildenden
§ 4: Vergütungen und sonstige Leistungen
§ 5: Tägliche und wöchentliche Ausbildungszeiten
§ 6: Urlaub
§ 7: Kündigung
§ 8: Ausstellung eines Zeugnisses bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
Ergänzend zum Ausbildungsvertrag finden die Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes und das Tarifvertragswerk »Tiermedizinische Fachangestellte«, das einen Manteltarifvertrag und einen Vergütungstarifvertrag umfasst, in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Der Ausbildungsvertrag ist zum Abschluss dem zuständigen tierärztlichen Bezirksverband zur Unterschrift vorzulegen.
Tarifvertragswerk »Tiermedizinische Fachangestellte«
Zwischen dem Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. (bpt) und dem Verband medizinischer Fachberufe (VmF) wurde ein Manteltarifvertrag und ein Gehaltstarifvertrag abgeschlossen.
Der Manteltarifvertrag umfasst alle für die TFA wichtigen, arbeitsrechtlichen Bestimmungen und gilt entsprechend auch für Auszubildende.
Übersicht über den Manteltarifvertrag:
§ 1: Geltungsbereich
§ 2: Arbeitsvertrag
§ 3: Probezeit
§ 4: Schweigepflicht
§ 5: Ärztliche Untersuchungen
§ 6: Arbeitszeit
§ 7: Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst
§ 8: Arbeitsversäumnis, Arbeitsunfähigkeit
§ 9: Gehaltsfortzahlung in besonderen Fällen
§ 10: Gehalt, Urlaubsgeld, Weihnachtszuwendung und vermögenswirksame Leistungen
§ 11: Teilzeitarbeit
§ 12: Schutz- und Berufsbekleidung
§ 13: Sachbezüge
§ 14: Urlaub
§ 15: Arbeitsbefreiung
§ 16: Kündigungsfristen
§ 17: Zeugnis
§§18–21: Sterbegeld, Ausschlussfristen, Wahrung des Besitzstandes, Inkrafttreten und Laufzeit
Die Gültigkeit dieses Tarifvertrages beträgt mindestens drei Jahre.
Im Gegensatz dazu kann der Gehaltstarifvertrag von den Vertragspartnern jährlich geändert werden. Er umfasst u. a. eine Gehaltstabelle für vollbeschäftigte TFA, die Ausbildungsvergütung und gibt die Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit an.
Beide Tarifverträge gelten für alle TFA, deren Tätigkeit dem Berufsbild entspricht und die in einer Tierarztpraxis oder tierärztlichen Klinik beschäftigt sind. Anwendungsvoraussetzung ist, dass die TFA Mitglied ihres Berufsverbandes und der Praxis- bzw. Klinikinhaber Mitglied des BPT ist. Die Anwendung dieses Tarifvertragswerkes kann auch vereinbart werden, wenn eine oder beide arbeitsvertragschließenden Parteien nicht Mitglied der genannten Berufsorganisationen sind.
Verband medizinischer Fachberufe
Der Verband medizinischer Fachberufe (VmF), mit Geschäftsstelle in Dortmund, ist eine Interessenvertretung der Fachkräfte in Heilberufen und bemüht, die Belange dieser in Bezug auf Mantel- und Gehaltstarifvertrag, die finanzielle und soziale Absicherung der Berufstätigkeit, die Fortbildung und Qualifizierung im Beruf zu unterstützen.
Pflichten der Auszubildenden
Neben der Teilnahme am Berufsschulunterricht und dem Bemühen, die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zur Erreichung des Ausbildungszieles zu erwerben, hat die auszubildende TFA folgende Grundpflichten:
• sorgfältige Ausführung von Verrichtungen und Aufgaben, die ihr im Rahmen der Berufsausbildung übertragen worden sind (Sorgfaltspflicht);
• Befolgen von Weisungen, die ihr vom ausbildenden Tierarzt erteilt werden (Weisungsgebundenheit);
• Stillschweigen über alle Praxisvorgänge bewahren, auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Schweigepflicht).
• Bei grob fahrlässigem Verhalten und Schäden, die durch Nichtbeachtung der genannten Grundpflichten entstanden sind, kann auch eine auszubildende TFA zur Haftung herangezogen werden.
1.3.2 Ausbildungsordnung
Auf Grund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 verordnete das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung: »Der Ausbildungsberuf »Tiermedizinische/r Fachangestellte/r« wird staatlich anerkannt und erfährt eine bundesweite Regelung«. Bisher bestand nur in Bayern eine Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinie. In den anderen Ländern wurde nach der Regelung für Medizinische Fachangestellte verfahren.
Die neue Ausbildungsverordnung (Verordnung über die Berufsausbildung zum Tiermedizinischen Fachangestellten/zur Tiermedizinischen Fachangestellten vom 22. August 2005) enthält die bisher fehlende fachliche und zeitliche Aufgliederung der Ausbildung und passt sie an die veränderten Gegebenheiten und Bedingungen der tierärztlichen Praxis an. Die nachfolgend genannten Paragraphen beziehen sich auf diese Verordnung.
§ 4 Ausbildungsberufsbild
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
1 Der Ausbildungsbetrieb:
1.1 Stellung der Tierarztpraxis im Veterinär- und im Gesundheitswesen
1.2 Aufbau und Rechtsform
1.3 Gesetzliche und vertragliche Regelungen der tiermedizinischen Versorgung
1.4 Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht
1.5 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
1.6 Umweltschutz
2 Hygiene und Infektionsschutz:
2.1 Maßnahmen der Arbeits- und Praxishygiene
2.2 Infektionskrankheiten und Seuchenschutz
3 Tierschutz, Patientenbetreuung:
3.1 Tierschutz
3.2 Tierartgerechte und verhaltensgemäße Haltung von Tieren; Betreuung von Patienten
4 Kommunikation:
4.1 Kommunikationsformen und -methoden
4.2 Beratung und Betreuung von Tierhaltern und Tierhalterinnen
4.3 Verhalten in Konfliktsituationen
5 Information und Datenschutz:
5.1 Informations- und Kommunikationssysteme
5.2 Datenschutz und Datensicherheit
6 Betriebsorganisation und Qualitätsmanagement:
6.1 Betriebs- und Arbeitsabläufe
6.2 Marketing
6.3 Arbeiten im Team
6.4 Qualitätsmanagement
6.5 Zeitmanagement
7 Betriebsverwaltung und Abrechnung:
7.1 Verwaltungsarbeiten und Dokumentation
7.2 Abrechnungswesen
7.3 Materialbeschaffung und -verwaltung
8 Tierärztliche Hausapotheke:
8.1 Eingang und Lagerung von Arzneimitteln und Impfstoffen
8.2 Abgabe von Arzneimitteln
9 Maßnahmen bei Diagnostik und Therapie:
9.1 Assistenz bei tierärztlicher Diagnostik
9.2 Assistenz bei tierärztlicher Therapie
10 Prävention und Rehabilitation
11 Laborarbeiten
12 Röntgen und Strahlenschutz
13 Notfallmanagement:
13.1 Erste Hilfe beim Menschen
13.2 Hilfeleistungen bei Notfällen am Tier
Ausbildungsrahmenplan (§ 5)
Die Ausbildungsverordnung beschreibt in einem Ausbildungsrahmenplan (Anlage 1 zur Verordnung) die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten. Damit schafft sie die Voraussetzungen für eine moderne, qualitativ hochwertige Ausbildung in den tierärztlichen Praxen.
Abweichungen von der zeitlichen und sachlichen Gliederung des Ausbildungsinhaltes sind dann zulässig, wenn praxisbedingte Besonderheiten dies erfordern.
Nach der Verordnung über die Berufsausbildung hat der ausbildende Tierarzt unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes einen Ausbildungsplan zu erstellen.
Berichtsheft
Vom auszubildenden TFA ist ein schriftlicher Ausbildungsnachweis in Form eines Berichtshefts zu führen, das der ausbildende Tierarzt regelmäßig durchzusehen und abzuzeichnen hat. Der schriftliche Ausbildungsnachweis ist Bestandteil der praktischen Ausbildung und wird daher während der vereinbarten Arbeitszeit geführt.
Das Berichtsheft gilt als Nachweis für die in der Praxis erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, die vom ausbildenden Tierarzt vermittelt und durch seine Unterschrift bescheinigt werden. Die Berichtshefte sind nicht bundeseinheitlich konzipiert. Grundlage für die Abfassung der Tätigkeitsberichte ist aber der Ausbildungsrahmenplan für die Ausbildung zur TFA. In ihm werden alle Gebiete der praktischen Ausbildung zum Erwerb der Kenntnisse und Fertigkeiten berücksichtigt.
Die Berichte sollen sich auf Unterweisungsthemen, Lehrgespräche und Tätigkeitsbeschreibungen beziehen und können stichwortartig oder in Form eines kurzen Aufsatzes abgefasst werden.
Das Berichtsheft ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.
Rahmenlehrplan
Parallel zu dieser Regelung für die ausbildenden Tierarztpraxen haben die Beauftragten der Kultusministerkonferenz den Rahmenlehrplan für den Unterricht in den Berufsschulen erarbeitet und mit dem Ausbildungsrahmenplan des Bundes abgestimmt.
Die Berufsschulen vermitteln dem Schüler/der Schülerin allgemeine und berufsbezogene Lerninhalte für die Berufsausbildung, die Berufsausübung und im Hinblick auf die berufliche Weiterbildung.
Der Rahmenlehrplan umfasst 12 Lernfelder, die in drei Ausbildungsjahren unterrichtet werden. Die Zeitrichtwerte geben die Anzahl der Unterrichtsstunden, die das jeweilige Lernfeld in Anspruch nimmt, an.
Die Zielformulierungen der jeweiligen Lernfelder beschreiben die Tätigkeiten der ausgelernten TFA in der Praxis. Die dafür notwendigen theoretischen Kenntnisse werden anhand der Lösung praxisrelevanter und handlungsorientierter Aufgaben erworben.
Die stichpunktartig aufgelisteten Inhalte der Lernfelder stellen eine Auswahl dar, die den Mindestanforderungen entspricht.
1.3.3 Prüfungsordnung
Die Prüfungsordnungen der Länder entstehen auf der Grundlage von §8 und §9 der Ausbildungsverordnung des Bundes.
§ 8 Zwischenprüfung
(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.
(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 und 2 für die ersten 18 Monate aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.
(3) Die Zwischenprüfung ist schriftlich anhand praxisbezogener Aufgaben in höchstens 120 Minuten in folgenden Prüfungsgebieten durchzuführen:
1. Durchführen von Hygienemaßnahmen,
2. Schutzmaßnahmen vor Infektionskrankheiten und Tierseuchen,
3. Erste Hilfe beim Menschen,
4. Materialbeschaffung und -verwaltung,
5. Information und Datenschutz.
6. Betriebsorganisation und Qualitätsmanagement:
6.1 Betriebs- und Arbeitsabläufe,
6.2 Marketing,
6.3 Arbeiten im Team,
6.4 Qualitätsmanagement,
6.5 Zeitmanagement;
7. Betriebsverwaltung und Abrechnung:
7.1 Verwaltungsarbeiten und Dokumentation,
7.2 Abrechnungswesen,
7.3 Materialbeschaffung und -verwaltung;
8. Tierärztliche Hausapotheke:
8.1 Eingang und Lagerung von Arzneimitteln und Impfstoffen,
8.2 Abgabe von Arzneimitteln;
9. Maßnahmen bei Diagnostik und Therapie unter Anleitung und Aufsicht des Tierarztes oder der Tierärztin:
9.1 Assistenz bei tierärztlicher Diagnostik,
9.2 Assistenz bei tierärztlicher Therapie;
10. Prävention und Rehabilitation;
11. Laborarbeiten;
12. Röntgen und Strahlenschutz;
13. Notfallmanagement:
13.1 Erste Hilfe beim Menschen,
13.2 Hilfeleistungen bei Notfällen am Tier.
§ 9 Abschlussprüfung
(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage 1 aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.
(2) Im praktischen Teil der Prüfung soll der Prüfling in höchstens 75 Minuten eine komplexe Prüfungsaufgabe bearbeiten sowie während dieser Zeit in höchstens 15 Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. Dem Prüfling ist eine angemessene Vorbereitungszeit einzuräumen. Bei der Prüfungsaufgabe soll er praxisbezogene 4 Arbeitsabläufe simulieren, demonstrieren, dokumentieren und präsentieren. Für die Prüfungsaufgabe kommen insbesondere in Betracht:
1. Assistieren bei Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen einschließlich tierartgerechter Betreuung des Patienten vor, während und nach der Behandlung, Pflegen, Warten und Handhaben von Geräten und Instrumenten, Durchführen von Hygienemaßnahmen, Abrechnen und Dokumentieren von Leistungen sowie Aufklären über Möglichkeiten und Ziele der Prävention oder
2. Assistieren bei Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen einschließlich tierartgerechter Betreuung des Patienten vor, während und nach der Behandlung, Pflegen, Warten und Handhaben von Geräten und Instrumenten, Durchführen von Hygienemaßnahmen, Abrechnen und Dokumentieren von Leistungen sowie Durchführen von Laborarbeiten.
Durch die Durchführung der Prüfungsaufgabe und das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe planen, Betriebsabläufe organisieren, Mittel der technischen Kommunikation nutzen, sachgerecht informieren und adressatengerecht kommunizieren, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Belange des Umweltschutzes berücksichtigen sowie die für die Prüfungsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen und seine Vorgehensweise begründen kann. Darüber hinaus soll er nachweisen, dass er bei Notfällen am Tier erste Maßnahmen durchführen, Tierhalter und Tierhalterinnen zur Kooperation motivieren sowie tierpsychologische Aspekte berücksichtigen kann.
(3) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus den Prüfungsbereichen Behandlungsassistenz, Betriebsorganisation und -verwaltung, Infektionskrankheiten und Seuchenschutz, Strahlenschutz in der Tierheilkunde sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. Die Anforderungen in den Prüfungsbereichen sind:
1. Prüfungsbereich Behandlungsassistenz: Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben bearbeiten. Er soll in der Prüfung zeigen, dass er bei der Diagnostik und Therapie Arbeitsabläufe planen und die Durchführung der Behandlungsassistenz beschreiben kann. Dabei soll er gesetzliche und vertragliche Regelungen der tiermedizinischen Versorgung, tierphysiologische und tierpsychologische Aspekte, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz sowie Maßnahmen der Praxishygiene berücksichtigen. Der Prüfling soll nachweisen, dass er fachliche und wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, Sachverhalte analysieren sowie Lösungsmöglichkeiten entwickeln und darstellen kann. Hierfür kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht:
a) Betriebsorganisation und Qualitätsmanagement,
b) Zeitmanagement,
c) Kommunikation; Beratung und Betreuung von Tierhaltern und Tierhalterinnen,
d) Prävention und Rehabilitation,
e) Tierschutz und Patientenbetreuung,
f) Diagnose- und Therapiegeräte,
g) Information und Datenschutz,
h) Notfallmanagement,
i) Betriebsverwaltung, Abrechnungswesen und Dokumentation;
2. Prüfungsbereich Betriebsorganisation und -verwaltung:
Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben bearbeiten. Er soll in der Prüfung zeigen, dass er Betriebsabläufe beschreiben, Arbeitsabläufe systematisch planen und im Zusammenhang mit anderen Arbeitsbereichen darstellen kann. Dabei soll er Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten berücksichtigen. Hierfür kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht:
a) Gesetzliche und vertragliche Regelungen der tiermedizinischen Versorgung,
b) Arbeiten im Team,
c) Verwaltungsarbeiten und Dokumentation,
d) Marketing,
e) Zeitmanagement,
f) Tierärztliche Hausapotheke,
g) Datenschutz,
h) Abrechnung,
i) Materialbeschaffung und -verwaltung;
3. Prüfungsbereich Infektionskrankheiten und Seuchenschutz:
Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er bei Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten, insbesondere von Tierseuchen unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften Arbeitsabläufe planen und im Zusammenhang mit anderen Arbeitsbereichen darstellen kann. Hierfür kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht:
a) Zoonosen und andere Tierseuchen,
b) Immunisierung,
c) Schutzmaßnahmen für sich und andere,
d) Laborarbeiten,
e) Arbeits- und Praxishygiene,
f) Assistenz bei Diagnostik und Therapie,
g) Kommunikation, Beratung und Betreuung von Tierhaltern und Tierhalterinnen,
h) Prävention und Rehabilitation,
i) Notfallmanagement;
4. Prüfungsbereich Strahlenschutz in der Tierheilkunde:
Der Prüfling soll zeigen, dass er Maßnahmen des Strahlenschutzes in der Tierheilkunde unter Berücksichtigung der rechtlichen Regelungen beschreiben kann. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen:
a) Strahlenbiologische Grundlagen,
b) Physikalische Eigenschaften von ionisierender Strahlung und radioaktiven Stoffen,
c) Grundlagen des Strahlenschutzes in der Röntgendiagnostik und bei der Anwendung offener radioaktiver Stoffe in der Tierheilkunde,
d) Biologische Risiken,
e) Strahlenschutz des Personals, der Tierhalter und Tierhalterinnen sowie der Umgebung,
f) Strahlenschutz bei den Untersuchungsmethoden in der Tierheilkunde,
g) Dosisgrößen, Einheiten und Messverfahren,
h) Methoden der Qualitätssicherung,
i) Verhalten bei Stör- und Unfällen,
j) Dokumentation und Aufzeichnung,
k) Rechtsvorschriften, Richtlinien;
5. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:
Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben aus der Berufs- und Arbeitswelt bearbeiten und dabei zeigen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge darstellen kann.
(4) Für den schriftlichen Teil der Prüfung ist von folgenden zeitlichen Höchstwerten auszugehen:
1. im Prüfungsbereich Behandlungsassistenz 120 Minuten,
2. im Prüfungsbereich Betriebsorganisation und -verwaltung 90 Minuten,
3. im Prüfungsbereich Infektionskrankheiten und Seuchenschutz 45 Minuten,
4. im Prüfungsbereich Strahlenschutz in der Tierheilkunde 45 Minuten,
5. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.
(5) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten:
1. Prüfungsbereich Behandlungsassistenz 40 Prozent,
2. Prüfungsbereich Betriebsorganisation und -verwaltung 30 Prozent,
3. Prüfungsbereich Infektionskrankheiten und Seuchenschutz 10 Prozent,
4. Prüfungsbereich Strahlenschutz in der Tierheilkunde 10 Prozent,
5. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 10 Prozent.
(6) Sind im schriftlichen Teil der Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsbereichen mit mangelhaft und in den übrigen Prüfungsbereichen mit mindestens ausreichend bewertet worden, so ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einem der mit mangelhaft bewerteten Prüfungsbereiche die schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von höchstens 15 Minuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Der Prüfungsbereich ist vom Prüfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und im schriftlichen Teil der Prüfung sowie innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung im Prüfungsbereich Strahlenschutz in der Tierheilkunde und in mindestens drei weiteren Prüfungsbereichen mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht sind. Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungsbereich mit »ungenügend« bewertet, ist die Prüfung nicht bestanden.
1.3.4 Weiterbildung
Man unterscheidet zwischen Aufstiegsfortbildungen und Anpassungsfortbildungen.
Eine Aufstiegsfortbildung schließt sich an die Berufsausbildung und -ausübung an. Sie berechtigt nach der erfolgreichen Teilnahme an einer entsprechenden Prüfung zu einer weiteren Berufsbezeichnung. Beispiele für diese Berufe sind
• Hundefachwirt/-in
• Fachwirt/-in im Sozial- und Gesundheitswesen
• Betriebswirt/-in für Management im Gesundheitswesen.
Anpassungsfortbildungen erweitern die bestehenden beruflichen Qualifikationen. Die Teilnahme an einer solchen Fortbildung wird mit einer Teilnahmebescheinigung bzw. einem Zertifikat bestätigt. Beispiele für Anpassungsfortbildungen sind
• Fachtagungen
• Strahlenschutzkurse
• Lehrgänge für Qualitätsmanagement.
Beim Verband medizinischer Fachberufe e. V. (www.vmf-online.de), der Gewerkschaft der Medizinischen, Zahnmedizinischen und Tiermedizinischen Fachangestellten sowie der angestellten Zahntechniker/innen, kann man sich über weitere Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung informieren.
1.4 Die TFA im Beruf
1.4.1 Die tierärztliche Praxis
Mit dem Begriff »Praxis« ist einerseits der Tätigkeitsbereich des Arztes oder Tierarztes gemeint, andererseits umfasst der Begriff die Gesamtheit der Arbeitsräume des niedergelassenen Mediziners.
Praxisspezialisierung
Je nach Spezialisierung sind die Praxen unterschiedlich organisiert:
Großtierpraxis. Patienten sind die landwirtschaftlichen Nutztiere (Rinder, Schafe, Schweine) und Pferde. Sie werden meistens in den Stallungen oder auf der Weide, an Ort und Stelle vom Tierarzt untersucht und behandelt (Außenpraxis).
Kleintierpraxis. Patienten sind die kleinen Haustiere (Hunde und Katzen) und Heimtiere (Kleinsäuger, Vögel, Reptilien). Gelegentliche Patienten sind wild lebende Tiere, die als Findlinge aufgenommen wurden. Die tierärztliche Untersuchung und Behandlung findet in den Praxisräumen statt, in etlichen Fällen auch in Form des Hausbesuches.
Gemischtpraxis. Sowohl Großtiere als auch Kleintiere werden behandelt. Ein Sprech- und Behandlungszimmer ist erforderlich. Diese Praxisform macht meistens eine straffe Durchorganisation des Arbeitsablaufes notwendig und kann selten von einem Tierarzt allein bewältigt werden, weshalb sich eine Arbeitsgemeinschaft von zwei oder mehreren Tierärzten bildet. Sie stehen dem Praxisinhaber als Assistenten zur Seite.
Gemeinschaftspraxis. Zwei oder mehr Tierärzte arbeiten als Praxisinhaber zusammen. Die Praxis trägt deren Namen.
Gruppenpraxis. Zusammenschluss mehrerer Praxisinhaber an einem Praxissitz. Jeder Inhaber hat sein eigenes Praxisschild. Vorteilhaft ist die gemeinsame Nutzung der Einrichtung, fachliche Zusammenarbeit, gemeinsame Mitarbeiter und die gegenseitige Vertretung. Die Abrechnungen erfolgen getrennt.
Praxisgemeinschaft. Zusammenschluss mehrerer Praxisinhaber an örtlich getrennten Praxissitzen. Jeder Praxisinhaber kennzeichnet seinen Praxissitz. Wie bei der Gruppenpraxis liegt eine gemeinsame Nutzung der Einrichtung vor.
Fachtierarztpraxis. Hat ein Tierarzt die Anerkennung für ein bestimmtes Fachgebiet (z. B. Fachtierarzt für Kleintiere) erhalten, so ist er damit verpflichtet, hauptsächlich in diesem Fachgebiet tätig zu werden.
Praxisräume (Abb. 1.3)
Eine gewisse Grundkonzeption ist für die Vielfalt der Arbeit und ihren möglichst reibungslosen Ablauf notwendig. Anzahl und Größe der Räume richten sich weitgehend nach der zu erwartenden Patientenzahl, den Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten samt Operationen. Die Aufteilung eines großen Raumes in Zonen bestimmter Arbeitsabläufe wird häufig gehandhabt, kann aber zu Störungen und Unruhe des Patienten führen, wenn in diesem Raum gleichzeitig noch andere Patienten untersucht werden. Für die Abnahme eines Elektrokardiogramms oder die Endoskopie ist deshalb ein weiterer Raum notwendig.
Die Anordnung der Betriebsräume und Arbeitsbereiche resultiert häufig schon aus den baulichen Gegebenheiten, wird jedoch stets nach der Zweckmäßigkeit vorgenommen, so dass die Wege mit dem Patienten, z. B. vom Untersuchungs- in den Röntgenraum oder Operationsraum, nicht umständlich oder zu lang sind. Vorratslager werden im Keller – soweit vorhanden – angelegt, womit gleichzeitig auch die Vorschriften für eine sachgemäße Lagerung größerer Mengen brennbarer Flüssigkeiten sowie Arzneimittelvormischungen für die Herstellung von Fütterungsarzneimitteln gewährleistet sind.
Zur Führung der tierärztlichen Hausapotheke ist ein gesonderter Betriebsraum notwendig. In ihm kann der Arzneimittelvorrat – den Aufbewahrungsvorschriften entsprechend – gelagert werden.
Wird in der Praxis geröntgt, was ja heutzutage fast durchwegs der Fall ist, muss ein von den anderen Betriebsräumen abgetrennter Röntgenraum vorhanden sein. Er ist durch besondere bauliche Maßnahmen im Sinne der Strahlenschutzverordnung abgesichert.

Abb. 1.3: Beispiel der Betriebsräume einer Kleintierpraxis.
Vielfach gibt es in Kleintierpraxen noch andere zusätzliche Räume, wie z. B. einen Raum für medizinische Bäder bei Hunden, und Boxen, in denen Intensivpatienten oder frischoperierte Tiere zur ständigen Überwachung untergebracht werden können. Ein Toilettenraum für die Tierbesitzer befindet sich meistens in der Nähe des Wartezimmers. Ein gesonderter Toilettenraum muss außerdem für das Personal zur Verfügung stehen.
1.4.2 Die tierärztliche Klinik
Mit Genehmigung der Tierärztekammer darf die Bezeichnung »Tierärztliche Klinik« geführt werden. Die Größe der Klinik richtet sich weitgehend nach der zu versorgenden Tierart. Grundsätzlich muss die Möglichkeit bestehen, mehrere Patienten stationär unterzubringen.
Nach den erlassenen Richtlinien werden Mindestanforderungen gestellt:
• Beschäftigung mehrerer Tierärzte und ausreichend TFA und Pflegepersonal, damit eine ganzjährige Versorgung – Tag und Nacht – der Patienten und sofortige Hilfe bei Notfallpatienten gewährleistet sind;
• Räume, die leicht gepflegt und in hygienisch einwandfreiem Zustand gehalten werden können. Besonders wichtig sind auch die Beheizung, Belüftung und die Wasser- und Abwasserführung. Ein Isolationsraum, Räume für die Futterlagerung und Futterzubereitung müssen auch vorhanden sein. Wasch-, Umkleideräume und ein Aufenthaltsraum für das Klinikpersonal sind ebenfalls notwendig;
• Ausstattung der Klinik mit Apparaten, Geräten und Instrumenten, die Untersuchungen und Behandlungen nach dem jeweiligen Stand der veterinärmedizinischen Wissenschaft ermöglichen.
1.4.3 Arbeitsbereiche der TFA
Allgemeine Aufgaben
Fast jeder Berufstätige hat in seinem Arbeitsbereich mit anderen Menschen zu tun, die entweder als Vorgesetzte oder Mitarbeiter oder Klienten bestimmte Erwartungen in Umgang, Kommunikation und Mitarbeit setzen.
Der Tierarzt oder die Tierärztin erwarten von der TFA neben dem beruflichen Können und organisatorischen Fähigkeiten vor allem absolute Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Die TFA sollte ihre Arbeit mit Freude, Ausdauer und einer gewissen Belastbarkeit erledigen.
Die Kollegen, andere Hilfskräfte und Tierpfleger erwarten ein kollegiales Verhalten, die Bereitschaft zur Teamarbeit und gegenseitige, unterstützende Hilfeleistung, falls dies notwendig sein sollte.
Das Auftreten den Tierbesitzern gegenüber gehört für die TFA unter Umständen zu den schwierigsten Aufgaben, da sie sich jeweils neu, auf noch unbekannte Menschen einstellen muss. Wichtig ist, nie die Freundlichkeit und Höflichkeit zu verlieren. Die Tierbesitzer erwarten von der TFA Aufmerksamkeit, Geduld, Ruhe und einen geschickten Umgang mit dem Patienten.
Trotz notwendiger Kommunikation mit dem Tierbesitzer sollte die TFA eine gewisse Distanz wahren und ein – mit Takt und Einfühlungsvermögen gepaartes – Durchsetzungsvermögen gegenüber dem Tierbesitzer zeigen.
Die TFA sollte ein sicheres Auftreten und ein gepflegtes Aussehen zeigen. Sie vermittelt den ersten Eindruck, den der Tierbesitzer von der Praxis bekommt.
Die TFA wird in allen Bereichen der Praxis tätig. Das bedeutet einerseits, dass sie Hilfestellung bei der Untersuchung und Behandlung eines Tieres leistet, andererseits aber auch, dass sie Arbeiten an medizinischen Apparaten und im Laboratorium nach genauer Anleitung, unter Kontrolle des Tierarztes selbst ausführt. Eine große Unterstützung bietet sie bei der Praxisorganisation, Terminplanung und Erledigung des Schriftverkehrs.
Im Allgemeinen sind folgende Aufgaben durch die TFA zu erledigen:
Vor der Sprechstunde wird die Ordnung in Wartezimmer und Praxisräumen überprüft, die Spender für Desinfektionsmittel gefüllt, ausreichende Mengen Einweghandtücher bereitgestellt, der Terminkalender des Tages durchgesehen und Vorbereitungen für festgesetzte Operationen getroffen. Müssen Praxisfahrten unternommen werden, ist der Instrumenten- und Medikamentenvorrat im Auto durchzusehen. Die TFA sollte nach kurzer Zeit wissen, welche Dinge stets mitgenommen werden müssen.
Während der Sprechstunde steht die TFA für die Untersuchung und Behandlung am Tier zur Verfügung. Sie hält, soweit es ihre Kräfte zulassen, die Tiere oder reicht Instrumente, bereitet Spritzen vor, assistiert eventuell bei kleineren Operationen und hilft bei der Durchführung von physikalischen Untersuchungen (z. B. EKG) und Behandlungen (z. B. Bestrahlung, medizinische Bäder).
Im Labor müssen die abgenommenen Proben von Blut, Harn und Kot nach Anweisung untersucht und weitere Proben für den Versand an andere Laboratorien fertiggestellt werden.
Außerhalb der Sprechstunde sind neben weiteren bestellten Patienten, Notfällen, angesetzten größeren Operationen, der Nachsorge von operierten Patienten noch andere Hilfeleistungen zu erledigen. Medikamente müssen nachbestellt, Instrumente betreut (Desinfektion, Überprüfung der Funktionsfähigkeit, Sterilisation) und in der Patientenkartei Eintragungen ergänzt werden.
Dort wo stationäre Patienten in der Praxis aufgenommen sind, kann die TFA zur Pflege und Fütterung der Tiere eingesetzt werden.
Bei allen Tätigkeiten ist ein gutes Fachwissen, erworben durch den Unterricht in der Berufsschule und die Belehrungen in der Praxis, von großem Nutzen.
Die ihr übertragenen Arbeiten erledigt die TFA mit Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt und den erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen ihrer Ausbildung. Werden ihr neue Arbeiten zugewiesen, so wird sie diese nicht selbstständig, sondern erst nach gründlicher Unterweisung durch den Tierarzt ausführen.
Handelt sie nämlich eigenmächtig, so haftet sie selbst für möglicherweise entstehende Schäden. Sie darf deshalb z. B. nicht eigenmächtig Injektionen durchführen, Rezepte ausfüllen, Medikamente ausgeben oder in der Praxis mit Klinikbetrieb stationär eingestellte Tiere entlassen. Sie haftet auch für Schäden, die durch Unachtsamkeit, Flüchtigkeit und mangelnde Sorgfalt entstehen.
Arbeitsbereiche der TFA
Patient und Tierbesitzer
• Aufnahme und Betreuung
• Mithilfe bei Untersuchung und Behandlung
• Mithilfe bei Anästhesie und Operation
• Betreuung von Intensivpatienten
• Fütterung und Pflege von stationären Patienten
• Anwendung med.-technischer Geräte
• Röntgen und Dunkelkammerarbeiten
Labor
• Probengewinnung und Probenaufbereitung
• Laboruntersuchungen (mit Qualitätskontrolle)
• Probenversand
• Beseitigung von Untersuchungsmaterial
• Pflege der Laboreinrichtungen
Praxis
• Hygiene und Pflege von Einrichtung, Instrumentarium und medizinisch-technischen Geräten
• Desinfektion und Sterilisation
• Aufbewahrung und Betreuung von Arzneimitteln und Betäubungsmitteln
Verwaltung
• Terminplanung und Patientenbestellung
• Patientenkartei
• Untersuchungs- und Überweisungsanträge vorbereiten
• Gebührenabrechnung
• Mahnschreiben und übriger Schriftverkehr
• Einkauf von Praxis- und Bürobedarf
• Zahlungsverkehr und Buchführung
1.5 Tierschutz
Wer sich dem Schutz des Tieres widmet, zeigt sein Verständnis für das Leben aller Mitgeschöpfe dieser Welt. Das Tier steht innerhalb unserer menschlichen Verantwortung und die Fürsorge für ein Tier zwingt uns zur Rücksichtnahme und Hilfe.
Tierschutz bedeutet auch Umweltschutz und Artenschutz (Naturschutz, Jagdrecht). Tierschutz bezieht sich also nicht nur auf die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Menschen lebenden oder uns im tierärztlichen Beruf anvertrauten Tiere. Durch das Bundesnaturschutzgesetz und die Bundesartenschutzverordnung werden Schutz und Pflege wild lebender Tiere und wild wachsender Pflanzen besonders geregelt. Die Länder erlassen weitere Vorschriften zur Verwirklichung des Artenschutzes, insbesondere zum Schutz der Lebensräume wild lebender Tiere. Das Aufnehmen, die Pflege und die Aufzucht kranker, hilfloser Tiere der geschützten Art und ihr weiterer Lebensraum der Tiere geschützt wird: Errichten von Wildzäunen, Aufstellen von Warnschildern bei Wildwechsel, Gewässerschutz, Kenntlichmachung von Hindernissen, z. B. Aufkleber an großen Glasflächen, um ein Anfliegen einheimischer Vögel zu verhindern.
1.5.1 Tierschutzgesetz
Seit 18. Mai 2006 gilt die Neufassung des Tierschutzgesetzes.
§ 1 des Tierschutzgesetzes (TierSchG)
»Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.«
Tierhaltung (§ 2 und 3)
Der zweite Abschnitt des Gesetzes (§ 2 und 3) betrifft die Tierhaltung. Jeder, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss dafür sorgen, dass das Tier seiner Art entsprechend untergebracht ist, ernährt und gepflegt wird. Auch muss das Gemeinschaftsbedürfnis des Tieres berücksichtigt werden. Richtige Licht- und Temperaturverhältnisse und ausreichende Bewegungsmöglichkeiten für das Tier zu beachten. Für diese Voraussetzungen werden vom Halter des Tieres ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten zur Tierhaltung verlangt. Das BMELV kann durch Rechtsverordnung einen Nachweis dieser Kenntnisse und Fähigkeiten bei allen Personen, die gewerbsmäßig Tiere halten und betreuen, veranlassen.
Die TFA betrifft in § 2 des Gesetzes, z. B. die Versorgung des Patienten bei der postoperativen Betreuung, der seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt und verhaltensgerecht untergebracht werden muss. Da bei der stationären Unterbringung nach einer Operation neben dem subjektiven Wohlbefinden auch die Vermeidung von Verletzungs- und Infektionsrisiken berücksichtigt werden müssen, sind an die Unterkunft andere Maßstäbe anzulegen als bei fortwährender privater oder gewerbsmäßiger Haltung. Wichtig sind in der Aufwachphase vor allem eine ausreichend hohe Raumtemperatur und die Vermeidung von Verletzungen und Schädigungen durch unkontrollierte Bewegungen und Störungen der Atem- und Kreislauffunktionen. In der Aufwachphase durchläuft der Patient die gleichen Zustände wie in der Einschlafphase. Es kann zu Lautäußerungen und sogar zu Krampfanfällen kommen. Deshalb ist es wichtig, den Patienten erst nach vollständiger Aufwachphase an den Besitzer zurückzugeben.
Durch besondere Rechtsverordnung können für den Transport von Tieren deren Transportfähigkeit, die Versendungsart, Transportmittel und – falls notwendig – Betreuung der Tiere während der Fahrt durch eine Begleitperson bestimmt werden.
§ 3 des Gesetzes verbietet u. a.
• einem Tier – außer in Notfällen – Leistungen abzuverlangen, die seine Kräfte übersteigen oder denen es infolge seines Zustandes nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen,
• einem Tier, an dem Eingriffe und Behandlungen vorgenommen worden sind, die einen leistungsmindernden körperlichen Zustand verdecken, Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines körperlichen Zustandes nicht gewachsen ist,
• an einem Tier im Training oder bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen Maßnahmen, die mit erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind und die Leistungsfähigkeit von Tieren beeinflussen können, sowie an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen Dopingmittel anzuwenden,
• ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind,
• ein Tier zu einer Filmaufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern damit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind,
• ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurücklassen, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuungspflicht zu entziehen,
• ein Tier auf ein anderes zu hetzen, soweit dies nicht die Grundsätze weidgerechter Jagdausübung erfordern,
• ein Tier an einem anderen lebenden Tier auf Schärfe abzurichten oder zu prüfen,
• einem Tier durch Anwendung von Zwang Futter einzuverleiben, sofern dies nicht aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist,
• einem Tier Futter darzureichen, das dem Tier erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden bereitet.
Tötung von Tieren (§ 4)
Der dritte Abschnitt des Gesetzes regelt die Tötung von Tieren (Euthanasie). Die Tötung von Wirbeltieren darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen vorgenommen werden. Eine Ausnahme besteht für die Jagd und die Schädlingsbekämpfung. Allerdings dürfen auch hier bei der Tötung nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen auftreten.
Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. Für die berufs- oder gewerbsmäßige Tötung von Tieren ist ein Sachkundenachweis der Ausführenden notwendig. Warmblütige Tiere dürfen (außer bei Notschlachtungen) erst geschlachtet werden, wenn sie vor dem Blutentzug betäubt wurden. Ausnahmegenehmigungen erteilen die zuständigen Behörden nur für Angehörige bestimmter Religionsgemeinschaften, bei denen das Schlachten ohne Betäubung (Schächten) vorgeschrieben ist.
Weitere Ausnahmeregelungen sowie das Schlachten von kaltblütigen Tieren und Fischen können durch Rechtsverordnung genehmigt werden.
Eingriffe an Tieren (§ 5 und 6)
Der vierte Abschnitt des Gesetzes betrifft die Eingriffe an Tieren. Grundsätzlich darf an einem Wirbeltier kein Eingriff, der mit Schmerzen verbunden ist, ohne Betäubung vorgenommen werden. Die Betäubung warmblutiger Wirbeltiere, Amphibien und Reptilien ist von einem Tierarzt vorzunehmen. Außerdem dürfen grundsätzlich ohne tierärztliche Indikation keine Körperteile amputiert oder Gewebe oder Organe entnommen werden. Eine Betäubung ist dann nicht erforderlich, wenn auch beim Menschen bei ähnlichen Eingriffen die Betäubung unterbleibt oder im Einzelfall nach tierärztlicher Beurteilung die Betäubung am Tier nicht möglich ist. Eingriffe ohne Betäubung sind nur bis zu einem genau festgesetzten Lebensalter der Jungtiere bei der Kastration, der Enthornung und beim Kupieren des Schwanzes gestattet. Die Betäubung ist ferner nicht erforderlich bei der Kennzeichnung von Schweinen, Schafen, Ziegen und Kaninchen durch Tätowierung, Ohrmarken, Flügelmarken, injektierten Mikrochip, Schlagstempel beim Schwein und durch Schenkelbrand beim Pferd.
Im Anschluss an die Kastration eines über sieben Tage alten Schweines sind schmerzstillende Arzneimittel einschließlich Betäubungsmittel bei dem Tier anzuwenden. Die Eingriffe sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der zuständigen Behörde anzuzeigen.
Die Entnahme von Organen oder Organteilen und Geweben ist nur erlaubt, wenn eine tierärztliche Indikation vorliegt, für eine Transplantation, zum Anlegen einer Kultur oder zur Untersuchung von isolierten Geweben oder Zellen.
Tierversuche (§ 7, 8 und 9)
Der fünfte Abschnitt umfasst die Regelungen für Tierversuche. Als Tierversuche im Sinne des Gesetzes werden Eingriffe oder Behandlungen an Tieren zu Versuchszwecken bezeichnet, die mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für die Tiere verbunden sind.
Der Gesetzgeber lässt folgende Gründe für die Versuchsdurchführung gelten:
• Erkennen oder Beeinflussen physiologischer Zustände oder Organfunktionen bei Mensch oder Tier,
• Vorbeugen, Erkennen und Behandeln von Krankheiten bei Mensch oder Tier,
• Erkennen von Umweltgefährdungen,
• Grundlagenforschung,
• Prüfung von Stoffen auf ihre Unbedenklichkeit für die Gesundheit von Mensch oder Tier und die Prüfung der Wirksamkeit von Stoffen gegen tierische Schädlinge.
Tierversuche dürfen nur angesetzt werden, wenn sie durch andere Untersuchungsverfahren nicht ersetzt werden können. Die Versuchsvorhaben müssen behördlich genehmigt sein. Auch nicht genehmigungspflichtige Versuchsvorhaben, wie z. B. Impfungen, Blutentnahmen oder sonstige diagnostische Maßnahmen nach bereits erprobten Verfahren, müssen der zuständigen Behörde angezeigt werden.
Tierversuche an Wirbeltieren dürfen nur von Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium der Veterinärmedizin, Medizin oder Naturwissenschaften (Zoologie) oder von Personen mit den notwendigen Fachkenntnissen nach abgeschlossener Berufsausbildung durchgeführt werden. Unter anderem ist auch festgesetzt, dass für die Versuche an Wirbeltieren, mit Ausnahme aller Nutztierarten, nur zu diesem Zweck gezüchtete Tiere verwendet werden sollen.
Über die Tierversuche sind Aufzeichnungen mit Angabe der Zahl, Tierart, Kennzeichnung und Herkunft der Tiere zu machen und drei Jahre lang aufzubewahren.. Nach Abschluss der Versuche ist eine tierärztliche Untersuchung zur Beurteilung der Lebensfähigkeit der Tiere ohne Schmerzen oder Leiden notwendig.
Eingriffe und Behandlungen zur Aus-, Fort- oder Weiterbildung (§ 10)
Der sechste Abschnitt des Gesetzes erlaubt Eingriffe und Behandlungen an Tieren zur Aus-, Fort- und Weiterbildung an Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Krankenhäusern, wenn die gesetzlichen Auflagen (fünfter Abschnitt) beachtet werden.
Eingriffe und Behandlungen zur Herstellung, Gewinnung, Aufbewahrung oder Vermehrung von Stoffen, Produkten oder Organismen (§ 10a)
Im siebenten Abschnitt des Gesetzes wird hervorgehoben, dass Eingriffe und Behandlungen an Wirbeltieren, zur Herstellung, Gewinnung, Aufbewahrung oder Vermehrung von Stoffen oder Produkten, anzeigepflichtig sind und nur unter den gesetzlichen Bedingungen für Tierversuche vorgenommen werden dürfen.
Zucht, Halten von Tieren und Handel mit Tieren (§ 11)
Der achte Abschnitt des Gesetzes betrifft die Zucht, das Halten von Tieren und den Handel mit Tieren. Gewerbsmäßig gehaltene Tiere, z. B. zur Schaustellung, in einem Reit- und Fahrbetrieb oder zur Zucht und für den Handel, müssen der zuständigen Behörde gemeldet sein. Die behördliche Genehmigung ist auch notwendig für die Tierhaltung in Tierheimen, Zoologischen Gärten, Einrichtungen zur Schutzhundausbildung, Tierbörsen oder für die tierschutzgerechte Bekämpfung von Wirbeltieren als Schädlinge.
Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn die verantwortlichen Personen die für die Tätigkeit notwendigen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachweisen können.
Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten oder durch bio- oder gentechnische Maßnahmen zu verändern. Bei den Nachkommen ist damit zu rechnen, dass mit Leiden verbundene, erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten und die Tiere Schmerzen oder Schäden erleiden.
Beim Handel mit Tieren ist zu berücksichtigen, dass Wirbeltiere an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten abgegeben werden dürfen.
Verbringungs-, Verkehrs- und Haltungsverbot (§ 12)
Im neunten Abschnitt des Gesetzes wird betont, dass Wirbeltiere, bei denen Schäden infolge tierschutzwidriger Handlungen festgestellt werden, nicht gehalten oder in den Verkehr gebracht werden dürfen. Durch Rechtsverordnung ist es demnach möglich, die Einfuhr von Tieren genehmigungsabhängig zu machen. Das Verbringen von Wirbeltieren in das Inland und das Halten ist zu verbieten, wenn an den Tieren tierschutzwidrige Handlungen zum Erreichen bestimmter Rassemerkmale vorgenommen wurden. Das Verbot betrifft auch Wirbeltiere mit erblich bedingten, körperlichen Defekten, Verhaltensstörungen oder Aggressionssteigerungen.
Sonstige Bestimmungen
Der zehnte Abschnitt des Gesetzes enthält die sonstigen Bestimmungen zum Schutz der Tiere. Diese betreffen z. B. das Verbot, Stoffe oder Vorrichtungen zum Verscheuchen oder Fangen von Wirbeltieren zu benutzen, wenn damit Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere verbunden sind.
Durch besondere Rechtsverordnung kann das Halten, der Handel, der Import oder Export von Tieren wild lebender Arten verboten, eingeschränkt oder von einer Genehmigung abhängig gemacht werden. Der Schutz des Wildes vor Schäden durch land- oder forstwirtschaftliche Arbeiten wird ebenfalls durch Rechtsverordnung geregelt.
Eine weitere Forderung des Tierschutzes sind freiwillige Verfahren zur Überprüfung der serienmäßigen Herstellung von Aufstallungssystemen und Stalleinrichtungen zum tiergerechten Halten landwirtschaftlicher Nutztiere. Ebenso wird die Überprüfung der beim Schlachten verwendeten Betäubungsgeräte und - anlagen gefordert.
1.6 Arbeitsschutz und Unfallverhütung
Während ihrer beruflichen Tätigkeit ist die TFA Gefahren ausgesetzt, die zu Unfällen und damit zu Gesundheits- und Sachschäden führen können. Es ist deshalb notwendig, dass sie ausreichend über die maßgebenden Unfallverhütungsvorschriften orientiert ist.
Das geschieht durch:
• Auslegen der »Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften« in der Praxis,
• Belehrung (in regelmäßigen Abständen durch den Praxisinhaber) über notwendige Verhaltensweisen,
• Beachtung der Arbeitsvorschriften an Geräten und bei Laborarbeiten.
Die TFA ist verpflichtet, sich gemäß den Vorschriften, Anweisungen und Belehrungen zu verhalten, weil sie sonst – im Falle eines eingetretenen Schadens – wegen Unterlassung oder Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden kann.
Der Arbeitsschutz betrifft die TFA selbst, während ihrer Tätigkeit in der Praxis. Wenn z. B. für die Tätigkeit am Röntgenapparat eine Schutzausrüstung (Schürze, Handschuhe) zur Verfügung steht, dient das dem persönlichen Schutz des Arbeitnehmers während des Röntgens, um Gesundheitsschäden zu vermeiden.
Unfallverhütung bezieht sich auf die Kenntnis von möglichen Gefahren. Sie müssen ausgeschaltet werden, um sich selbst und andere Personen vor Unfällen und ihren verschiedenen Folgen zu schützen. Wenn z. B. ein elektrischer Apparat, der für gewöhnlich von mehreren Personen bedient wird, eine defekte Zuleitung hat, so muss sie das sofort dem Praxisinhaber melden, damit bei weiterer Bedienung des Gerätes kein Schaden am Patienten oder anderen Personen auftreten kann.
Der Zugang zur Praxis muss bei Dunkelheit beleuchtet sein. Die Gehwege und Treppen zur Praxis sind im Winter schnee- und eisfrei zu halten und zu streuen. Die Fußböden in den Praxisräumen dürfen nicht mit wachshaltigen Mitteln gepflegt werden. Durch Beachtung dieser Maßnahmen wird die Benutzung der Arbeitswege und Zugänge sicherer und die Gefahr des Ausrutschens und Hinfallens verringert.
1.6.1 Einige Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen
Schutzkleidung
Neben der Zivilkleidung werden für die Berufsausübung folgende Kleidungsarten unterschieden:
• Arbeitskleidung: Kleidung, die keine spezifische Schutzfunktion hat. Sie wird anstelle von oder kombiniert mit Zivilkleidung getragen.
• Berufskleidung: Kleidung, die berufsspezifisch ist und als Standes- und Dienstkleidung ausgewiesen werden kann.
• Schutzkleidung: Kleidung, die zum Schutz gegen körperschädigende Einwirkungen dient.
Verschiedene Anforderungen werden an eine sinnvolle Schutzkleidung gestellt. Im medizinischen Bereich soll sie vor allem einen Schutz gegen Infektionserreger bieten und deren Verschleppung verhindern. Die Kleidung soll außerdem tragephysiologisch zumutbar sein, was von den Eigenschaften der Kleidung, dem Umgebungsklima und dem Kontakt mit dem Körper abhängig ist. Persönliche Schutzkleidung darf den Träger bei seiner Arbeitsverrichtung nicht behindern. Die Stoffe sollten aus Naturfaser sein, wegen der Brenneigenschaften und um die elektrostatische Aufladung nicht zu begünstigen.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Schutzbekleidung bereitzustellen (§ 12 des Manteltarifvertrages). Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Schutzkleidung zu tragen, wenn sie verbindlich vorgeschrieben ist.
Weitere Teile der Schutzkleidung sind Schürzen aus Gummi oder ähnlichem Material und Gummistiefel sowie Sicherheitsschuhe aus Leder mit Stahlkappen. Schürze wie Schuhe sind vor allem in der Großtierpraxis unentbehrlich und schützen gegen Nässe, Verschmutzung und mechanische Einwirkungen.
Das Tragen von Schutzkleidung ist in der Praxis unerlässlich. Schutzkleidung muss die übrige Kleidung bedecken. Mykotisch infizierte Fellhaare eines Tieres können, z. B. leicht am Pullover oder anderen Kleidungsstücken haften bleiben und dann eine Infektionsquelle für weitere Patienten oder auch für die TFA selbst darstellen.
Bei Verdacht einer Zoonose sollten vor Berührung des Patienten Einweghandschuhe angezogen werden.
 LF 2: Unfallgefahren beim Umgang mit Tieren
LF 2: Unfallgefahren beim Umgang mit Tieren
Umgang mit Instrumenten
Beim Umgang mit Instrumenten muss an die Gefahr der Schnitt- und Stichverletzungen und an die Möglichkeit der Übertragung von Infektionskrankheiten gedacht werden. Durch Verwendung von Einwegartikeln werden diese Gefahren weitgehend eingedämmt; es entfällt z. B. das Sterilisieren von Spritzen, Kanülen und Skalpellen (Verkürzung des Arbeitsganges = Unfallverhütung).
In die Spritze aufgezogene Medikamente werden dem Tierarzt nur mit geschützter aufgesetzter Kanüle gereicht. Es ist darauf zu achten, dass spitze und scharfe Gegenstände nicht ohne schützende Hülle in den Abfalleimer geworfen werden. Eine Verletzung bei späterer Entleerung des Eimers wäre sonst die Folge.
Am günstigsten ist eine Abfallbox aus festem Kunststoff, die auf einer günstig zu erreichenden Ablagefläche steht und in die scharfe (Skalpellklingen) und spitze (Kanülen, Nadeln) Gegenstände nach beendeter Verwendung gegeben werden können. Die Abfallbox muss sicher verschließbar sein und kann über den Hausmüll entsorgt werden.
Steht in der Großtierpraxis oder bei Hausbesuchen eine Abfallbox nicht gleich zur Verfügung, können gebrauchte Kanülen vorübergehend verwahrt werden (Abb. 1.4a, b).
Umgang mit Medikamenten
Beim Öffnen von Ampullen müssen Verletzungen vermieden werden. Die Ampulle wird fest in die Hand genommen, der Ampullenhals leicht angesägt und dann der Ampullenkopf nur mit einem Alkoholtupfer abgebrochen (Abb. 1.5). Verwechslungen von Medikamenten müssen vermieden werden. Alle Arzneiflaschen ohne Etikett, ebenso Tabletten ohne dazugehörige Verpackung könnten dazu Anlass geben. Sie müssen verworfen werden.
Ein in die Spritze aufgezogenes Medikament, das nicht gleich injiziert wird, muss bis zum Verbrauch neben der Originalflasche liegen bleiben oder der Name des Medikamentes muss auf der Einmalspritze vermerkt werden.
Laborarbeiten
Laborarbeiten können trotz Arbeitsvereinfachung durch moderne Untersuchungsmethoden auch in der tierärztlichen Praxis zu Unfällen führen. Nach den Richtlinien für Laboratorien ist es verboten, Flüssigkeiten mittels Pipette mit dem Mund aufzuziehen. Dafür müssen im Handel erhältliche Pipettierhilfen benutzt werden.
Arbeitet die TFA im Labor mit brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, so muss sie wissen, dass in der Nähe kein offenes Feuer (z. B. Flamme eines Bunsenbrenners) sein darf; nur auf diese Weise kann ein Unfall vermieden werden. Feuergefährliche Stoffe dürfen nicht off en stehen bleiben. Es gibt Vorschrift en für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten (Tab. 1.1). Im Labor besteht Rauchverbot.
Im Labor darf nicht gegessen werden. Es ist nicht erlaubt, Lebensmittel in Chemikalienoder Laboratoriumsgefäßen aufzubewahren. Umgekehrt dürfen Chemikalien nicht in üblicherweise für Lebensmittel vorgesehene oder gekennzeichnete Behältnisse gefüllt und darin aufbewahrt werden.

Abb. 1.4: (a) Kanüle in der Schutzhülle,
(b) Kanüle in der gebrauchten Spritze.

Abb. 1.5: Möglichkeiten der gefahrlosen Ampullenöffnung.
Tabelle 1.1: Lagerungsvorschriften für brennbare Flüssigkeiten
| Ort der Lagerung | Chlorethyl Ether Wundbenzin | Ethylalkohol Isopropylalkohol Aceton |
| Praxis und Labor | 1 Liter | 5 Liter |
| Keller oder Hausapotheke | 20 Liter*) | 20 Liter*) |
*) Bei Lagerung in zerbrechlichen Gefäßen (Glas, Porzellan) sind nur 1 Liter bzw. 5 Liter erlaubt.
Eine besondere Sorgfalt gilt dem Umgang mit Untersuchungsmaterial, damit Infektionen vermieden werden. Ein Händedesinfektionsmittel und Einweghandtücher müssen vorrätig sein. Infektiöses Material, z. B. Eiter, Punktatflüssigkeit, ist erst zu desinfizieren, bevor es weggeschüttet werden kann. Man stellt in einem größeren Gefäß eine 5%ige Desinfektionslösung her, in der dann das infektiöse Material etwa 5 Stunden bleiben muss. In die Toilette darf nur dieses aufbereitete Material gegossen werden. Festes Untersuchungsmaterial wird ebenfalls desinfiziert und anschließend in einem Plastikbeutel für die Verbrennung bereitgestellt.
1.6.2 Warnbeschilderung in Labor und Praxis
Gefahrstoffe sind laut Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Stoffe oder Gemische, die eine chemische Gefährdung darstellen können. Sie werden in Gefahrenklassen (physikalische Gefahren, Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren) eingeteilt. Gefahrstoffe müssen auf besondere Weise gekennzeichnet sein. Ein wichtiges Element der Kennzeichnung ist das Gefahrensymbol.
Es gibt verschiedene gefährliche Arbeitsstoffe, mit denen sowohl in der Praxis als auch im Labor gearbeitet wird, z. B. Ether, Ethylalkohol, Isopropylalkohol, Chlorethyl, Wundbenzin, Azeton, Giemsa-Lösung, Kalilauge, Sie müssen in Behältnissen aufbewahrt werden, die mit den entsprechenden Gefahrensymbolen versehen sind.
Brennbare Flüssigkeiten dürfen in Praxen und Labors für den Handgebrauch in erforderlicher Menge bereitgestellt werden.
Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten ist zu beachten, dass sie nicht in der Nähe von Zündquellen ab- oder umgefüllt werden. Bei Arbeiten im Labor muss dafür der Abzug benutzt werden. Zündquellen sind Bunsenbrenner, Gas- oder Elektroheizungen, Kühlschränke, Motoren und Schalter.
1.6.3 Brandschutz
Um die Entstehung eines Brandes in der Praxis zu vermeiden, soll auf mögliche Ursachen aufmerksam gemacht werden:
• Flüchtige Substanzen (z. B. Ether) nicht im Kühlschrank aufbewahren (Explosionsgefahr).
• Spraydosen mit Treibgas nicht in der Nähe von Heizstrahlern benutzen (Explosionsgefahr).
• Kurzschlussgefahr besteht bei defekten Zuleitungen von Elektrogeräten (Entstehung eines Schwelbrandes).
• Unzureichender Abstand von Wärmelampen oder Heizstrahlern zu Einstreu oder Patientenunterlagen in den Boxen (Brandgefahr).
• Offene Flamme im Labor in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten.
• Rauchen beim gleichzeitigen Hantieren mit brennbaren Flüssigkeiten.
Daraus ergeben sich Ge- und Verbote (Abb. 1.6 a, b)

Abb. 1.6 a: Verbotsschild zum Brandschutz.

Abb. 1.6 b: Gebotsschild im Brandfall.
Verhalten im Brandfall
Muster für einen Aushang, auf dem die wichtigsten Punkte für das Verhalten im Brandfall vermerkt sind, können käuflich erworben werden und sollten entsprechend den Gegebenheiten der Praxis variiert werden.
Jederzeit sollte auch noch auf zwei wichtige Punkte geachtet werden:
• Leicht brennbares Verpackungsmaterial nie in den Praxisräumen lagern.
• Die Durchgänge nicht mit Geräten, Schränken, Vorräten verstellen, da sonst der Fluchtweg nach außen und der Zugang für die Feuerwehr erschwert sind.
1.6.4 Arbeitssicherheit in tierärztlichen Praxen und Kliniken (Betreuungsvertrag)
Nach den Unfallverhütungsvorschriften wird eine sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung aller Betriebe mit Beschäftigten vorgeschrieben.
Die sicherheitstechnische Betreuung wird möglichst mit einer tierärztlichen Fachkraft für Arbeitssicherheit vertraglich abgeschlossen. Die arbeitsmedizinische Betreuung übernimmt ein Betriebsarzt. Bei den Praxisbesuchen durch die Fachkräfte werden zur Sicherung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes alle Arbeitsplätze, die Arbeitsabläufe und der Umfang der verwendeten Gefahrenstoffe beurteilt. Falls notwendig, erteilen die Fachkräfte dann Ratschläge zur Verbesserung, um etwaigen Gesundheitsschäden vorzubeugen.
1.7 Abfall- und Tierkörperbeseitigung
1.7.1 Abfallbeseitigung
In der Praxis gibt es die verschiedensten Abfälle. Neben den Wertstoffen wie Papier und Glas, die auch in den privaten Haushaltungen anfallen, ist vor allem an den praxisspezifischen Müll zu denken.
Abfall aus dem medizinischen Bereich
Nach der »Richtlinie für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen« wird zwischen drei Arten von Müll unterschieden:
A–Abfälle, die keiner besonderen Maßnahme zur Infektionsverhütung bedürfen; der sog. Hausmüll.
B–Abfälle, die mit Blut, Sekreten und Exkreten verunreinigt sind, z. B. Wundverbände, Einmalspritzen, Kanülen, Einwegkatheter, Schlauchsysteme usw.; Materialien, die bei mikrobiellen Arbeiten anfallen; Körperteile und Organabfälle; Probenröhrchen mit Blut.
C–Abfälle, die beim Sammeln, Transportieren, Lagern und Beseitigen besonderer Maßnahmen zur Infektionsverhütung bedürfen. Hiermit ist der Abfall gemeint, der nach dem Infektionsschutzgesetz gesondert behandelt werden muss.
Zum Sammeln und Transportieren des Praxismülls (B-Abfall) müssen Einwegbehältnisse verwendet werden, die gut verschließbar, geruchsdicht, feuchtigkeitsbeständig und transportfest sind. Das Fassungsvermögen der Behältnisse sollte 70 Liter nicht überschreiten. Nach den Richtlinien für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen spricht aus hygienischen Gründen nichts gegen eine gemeinsame Entsorgung der Abfälle der Gruppen A und B durch die örtliche Müllabfuhr; es sei denn, die städtische oder gemeindliche »Allgemeine Müllsatzung« schreibt eine Entsorgung des B-Abfalles in einer gesonderten Verbrennungsanlage für Krankenhausmüll vor. Die Abfälle der Gruppe C sind besonders zu kennzeichnen und müssen in zentralen Spezialanlagen verbrannt werden. Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) erkennt auch bestimmte Verfahren zur Desinfektion des C-Abfalles an. Er kann dann wie B-Abfall beseitigt werden.
Die Menge des anfallenden Mülls und die Art der Behandlung, d. h. Sammeln, Lagern, Transport und Beseitigung, ist in den einzelnen Praxen verschieden. Teilweise werden Spezialsäcke, teilweise formbeständige Einmalbehälter benutzt. Es muss auf jeden Fall gesichert sein, dass spitze, scharfe, mit Wundsekret oder anderen Ausscheidungen der Tiere verschmutzte Gegenstände die Umhüllungen oder Sammelbehälter für Müll nicht durchdringen können und beim Transport zur Entsorgung gefahrlos getragen werden können. Es muss auch verhindert werden, dass »Müllkontrolleure« (neugierige Kinder, Einwegspritzensammler) den Abfall durchsuchen können.
Bakterienkulturen. Bakterienkulturen und infektiöses Untersuchungsmaterial müssen vor der Entsorgung desinfiziert werden.
Altpapier. Altpappe, zerlegte Kartonagen und Altpapier sollten gebündelt und gestapelt für die Abholung durch karitative Verbände bereitgestellt oder zu Altpapier-Containern gebracht werden.
Glas. Hierzu gehören vor allem die Flaschen der Infusionslösungen und leere Arzneiflaschen. Vor dem Sammeln die Korken, Gummistopfen und Metallverschlüsse entfernen! Container für Altglas sind in den Gemeinden aufgestellt.
Verbrauchsmaterial aus Kunststoff. Bei der Entnahme von Proben (Blut, Harn, Kot) und Aufbereitung im Labor werden meistens Einwegartikel aus Kunststoff verwendet. Wenn größere Mengen dieses Verbrauchsmaterials anfallen, können sie durch eine sog. Vernichtungssterilisation für die Entsorgung über den Hausmüll vorbereitet werden. Hitzebeständige Spezialbeutel aus Polypropylen oder Polyamid sind im Handel erhältlich. Die gefüllten Beutel werden heißluft- oder dampfsterilisiert. Bei diesen Verfahren kommt es auch zu einer Volumenreduktion durch Schrumpfen der Kunststoffartikel.
Scharfe und spitze Gegenstände. Skalpelle, Kanülen, Lanzetten, Nadeln, Brechampullen, Objektträger sind an Ort und Stelle in festen Behältern, z. B. aus Kunststoff, zu sammeln. Die Behälter müssen gut verschließbar sein. Die Plastikspitzen der Infusionsbestecke sind mit den Schutzkappen zu sichern. Diese Abfälle werden wie B-Müll behandelt.
Altarzneimittel. Das sind aussortierte verfallene, verschmutzte, verdorbene oder anderweitig veränderte und für die Anwendung am Tier nicht mehr geeignete Arzneimittel.
Vorsicht beim Sammeln: Glasbruch – Verletzungsgefahr! Die Arzneimittel werden mit der Verpackung gesammelt und dann als Sondermüll bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben. Sondermüllaktionen geben die einzelnen Gemeinden bekannt. Verschiedentlich werden die Altarzneimittel auch von den Stadtapotheken angenommen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht vertretbar. Ein missbräuchlicher Zugriff müsste ausgeschlossen sein; denn Arzneimittel sind Giftstoffe.
Röntgenmaterial. Alte Röntgenfilme und verbrauchte Fixierbäder werden gesammelt. Die Kanister für die Fixierlösung liefert eine Silberscheideanstalt über einen Hol- und Bringdienst. Die alten Röntgenfilme sind dann mitzugeben.
Batterien. Haushaltsbatterien (alkalische Normalbatterien) sind getrennt von Quecksilberbatterien (Knopfzellen mit Aufschrift Mercury, M oder Mercure) zu sammeln und dem Fachhandel zuzuführen.
Sondermüll. Hierunter sind alle Abfälle zu verstehen, die in die vorgenannten nicht einzugruppieren sind und für gewöhnlich in kleineren Mengen in der Praxis anfallen: Chemikalienreste aus dem Labor, Lösungsmittel wie Aceton, Spiritus, Benzin, Quecksilber aus Fieberthermometern, Spraydosen mit Inhaltsresten. Hierzu zählen auch die Probenansätze mit Cyanhämiglobinkomplex aus der photometrischen Hämoglobinbestimmung. Die Reste sollten in ihren Behältnissen bleiben und nicht zusammengeschüttet werden, um gefährliche chemische Reaktionen zu vermeiden. Die Beseitigung ist durch Abgabe bei Sondermüllaktionen in den Gemeinden oder bei Gesellschaften zur Beseitigung von Sondermüll möglich.
1.7.2 Tierkörperbeseitigung
Das Tierkörperbeseitigungsgesetz unterscheidet:
• Tierkörper: Das sind verendete, getötete, tot geborene oder noch nicht geborene Tiere.
• Tierkörperteile: Das sind Schlachtabfälle und sonst anfallende Teile von Tieren.
• Erzeugnisse von Tieren: Das sind Fleisch, Milch, Eier, die unschädlich beseitigt werden müssen. Exkremente zählen nicht dazu.
Die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen muss so geschehen, dass weder Menschen noch Tiere durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxische Stoffe gefährdet werden können und dass Gewässer, Boden und Futtermittel nicht verunreinigt werden. Im Allgemeinen sind Tierkörperbeseitigungsanstalten mit der Beseitigung beauftragt. Das gilt vor allem für Tierkörper von Einhufern, Klauentieren, von Zootieren und Tieren aus Tierhandlungen. Desgleichen gilt dies für Hunde und Katzen, Geflügel, Kaninchen und Edelpelztiere, wenn es mehr als nur einige Tierkörper sind. Einzelne Körper dieser Tierarten dürfen auf geeigneten, von der zuständigen Behörde zugelassenen Plätzen oder auf eigenem Gelände des Tierbesitzers vergraben oder in dafür zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen verbrannt werden. Beim Vergraben muss die den Tierkörper bedeckende Erdschicht mindestens 50 cm stark sein. Einzelne Gemeinden verbieten allerdings durch Verordnung das Vergraben von Hunden, Ferkeln und Lämmern in ihrem Gemeindebereich.
In der Praxis anfallende Tierkörper und Tierkörperteile von Hunden, Katzen und Kaninchen werden meistens von den Tierärzten selbst oder von einem von ihnen Beauftragten zur Tierkörperbeseitigungsanstalt oder, falls diese am Ort nicht existiert, zu einer Sammelstelle gebracht. Bis zur Ablieferung sind die Tierkörper oder Tierkörperteile so zu verwahren, dass Menschen nicht unbefugt und Tiere nicht mit ihnen in Berührung kommen können. Die Abholung des Tierkörpers durch die Beseitigungsanstalt oder die dortige Ablieferung entfällt, wenn der Tierkörper für diagnostische Zwecke in einer tierärztlichen Untersuchungsstelle abgegeben wird.
Von großer Wichtigkeit ist es, dass Auszubildende Gelegenheit zu angemessener Kommunikation bekommen. Nicht nur der Ausbilder geht mit seiner Unterschrift unter einen Ausbildungsvertrag die Verpflichtung ein, die Auszubildenden zu unterweisen und anzuleiten. Auch die Auszubildenden selbst sollen sich mit Interesse und der Bereitschaft, Eigeninitiative zu entwickeln, in die eigene Ausbildung einbringen. Manchmal gehört ein wenig Mut dazu, vermeintlich unqualifizierte Fragen zu stellen, und oft kommt es in Praxisteams auch zu Missverständnissen und Konflikten. Dem Umgang mit den verschiedensten Arten der Kommunikation darf sich kein Auszubildender entziehen. Auch darauf sollte schon am Beginn der Berufsausbildung hingewiesen werden.  LF 2: Kommunikation
LF 2: Kommunikation
Auch die Bedeutung der Hygiene ist am Beginn der Berufsausbildung zu vermitteln, damit sich die auszubildenden TFA von Anfang an mit den Vorschriften und praxisspezifischen Besonderheiten vertraut machen.  LF 3: Hygiene
LF 3: Hygiene
Biologische Grundlagen für die Berufsausübung
Für Tiermedizinische Fachangestellte ist der Mittelpunkt der gesamten Berufsausbildung und des Berufslebens der Tierpatient. Tierärzte und auch Klienten dürfen erwarten, dass TFA ein Grundverständnis für medizinische Zusammenhänge und Fragestellungen aufbringen. Auch ein Basiswissen über den menschlichen Körper ist für TFA notwendig, um die eigene Gesundheit und die von Mitarbeitern und Klienten zu schützen und zu erhalten. Hier sei vor allem auf gesundheitliche Gefährdungen wie zum Beispiel Infektionen oder die Strahlenexposition bei der Anwendung von Röntgenstrahlen hingewiesen. Die Voraussetzung für ein solches Verständnis ist Fachwissen im Bereich der Anatomie und Physiologie von Tier und Mensch. Im Rahmenlehrplan für die Berufsschule sind bei der Neuordnung des Berufs die Zytologie und Histologie nicht mehr ausdrücklich genannt. Dennoch halten wir es für sinnvoll, an geeigneter Stelle je nach schulischer Vorbildung in den Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie die genannten Voraussetzungen zu schaffen.
1.8 Zell- und Gewebelehre
1.8.1 Die Zelle und ihre Aufgaben
Die Zelle ist das kleinste, mit den Fähigkeiten des Lebens behaftete Bau- und Funktionselement des tierischen Organismus (Größe der Zelle von etwa 1 Mikrometer bis 0,25 Millimeter Durchmesser).
Alle Zellen des Organismus sind nach einem gewissen Grundschema aufgebaut. Sie entstammen alle der ersten Zelle, die nach der Befruchtung aus Samenzelle und Eizelle entstanden ist. Durch ständige Zellteilungen und Differenzierung entwickeln sich unterschiedlichste Zellformen, an deren Struktur auch die verschiedenen Funktionen gebunden sind. Auf diese Weise beginnt eine Spezialisierung der Zellen während der embryonalen Entwicklung und es entstehen Gewebe und Organe mit völlig verschiedenen Aufgaben. Dadurch ist eine funktionsbezogene Arbeitsteilung im Organismus möglich.
1.8.2 Aufbau der Zelle
In jeder Zelle geschehen mehrere Arbeitsabläufe gleichzeitig. Dies ist durch den Aufbau der Zelle mit ihrem Zellplasma (Zytoplasma) und ihren Zellorganellen sowie dem Zellkern gegeben (Abb. 1.8).
Zellmembran
Sie umschließt als dünnes Häutchen das Zytoplasma, ist entweder glatt oder weist Ausbuchtungen und Einziehungen – das bedeutet eine Oberflächenvergrößerung der Zelle – auf, die für die Aufnahme von Stoffen und Abgabe von Substanzen des Zellstoffwechsels notwendig sind.
Die Membran grenzt den Zellinhalt gegen die Umgebung ab, ist aber durchlässig (permeabel) und gewährleistet den lebensnotwendigen Austausch mit der Umgebung. Verbindung zu benachbarten Zellen besteht in Form von Haftplatten.

Abb. 1.7: Aufbau der Zelle.
Zellkern (Nukleus)
Er ist von einer permeablen Membran umgeben, durch deren Poren ein ständiger Austausch von Stoffen zwischen Kern und Plasmabestandteilen stattfindet. Im Kern liegt das Kerngerüst, zwischen dessen Maschen sich das Chromatin mit der genetischen Grundsubstanz Desoxyribonukleinsäure (DNS) befindet. Aus dem Chromatin gehen die Chromosomen in der für jede Tierart konstanten Anzahl hervor. Diese Zahl wird als Chromosomensatz bezeichnet und ist in jeder Zelle des Einzelorganismus gleich. Im Zellkern gibt es außerdem ein bis mehrere Kernkörperchen (Nukleolus). Sie enthalten viel Ribonukleinsäure (RNS), bilden die Ribosomen und regulieren zentral die Eiweißsynthese.
Die Kerngröße steht in gewisser Relation zur Zellgröße, d.h. eine Zunahme des Zellstoffwechsels geht mit einer Größenzunahme des Kerns einher. Man kann somit an verschiedenen Zellen die Stoffwechselaktivität an der Kerngröße bemessen. Der Zellkern steuert die lebenswichtigen Vorgänge der Zelle. Zellen ohne Kern sterben ab.
Zellplasma
Das Zellplasma besteht aus dem Grundplasma und den Zellorganellen. Das Grundplasma ist ein Kolloid, eine gelartige Substanz, die zur Wasseraufnahme und - abgabe befähigt ist. Durch diese Quellung und Entquellung kommt es zur sog. Plasmaströmung.
Zellorganellen
Mitochondrien
Das sind stäbchenförmige oder ovale Organellen, die in Anzahl, Form und Größe in den einzelnen Zellen variieren. In stoffwechselaktiven und in jüngeren Zellen sind sie zahlreicher.
Mitochondrien haben große Bedeutung für den Zellstoffwechsel. Sie sind Träger von Enzymsystemen für die Zellatmung und die Energiegewinnung durch Glykolyse (Abbau von Glukose).
Die gewonnene Energie wird als Adenosintriphosphat (ATP) gespeichert und bei Bedarf abgegeben. Die Mitochondrien werden deshalb auch als »Kraftwerke der Zelle« bezeichnet.
Endoplasmatisches Retikulum
Es ist ein Membransystem in Gitterform, gebildet aus hohlen Platten, Röhren oder Blasen, die mit dem Golgi-Apparat und über die Zellwand mit dem extrazellulären Raum in Verbindung stehen. Dies ist vor allem für den Transport wichtig.
Die Membranen tragen außen kleine Granula (Körnchen), als Ribosomen bezeichnet.
Ribosomen
Sie kommen nicht nur als Besatz am endoplasmatischen Retikulum, sondern auch frei im Grundplasma vor. Sie werden in den Kernkörperchen gebildet und an das Plasma abgegeben. Sie enthalten viel RNS und sind für die Eiweißsynthese notwendig.
Golgi-Apparat
Das lamellige Membranwerk aus Röhrchen und Bläschen mit Verbindung zum endoplasmatischen Retikulum hat die Aufgabe, die im Retikulum gebildeten Stoffe zu kondensieren, zu speichern und dann als abgeschnürte Sekretbläschen an die Zelloberfläche zu transportieren.
Lysosomen
Sie sind bläschenförmige Gebilde und enthalten Enzyme für den zelleigenen Eiweißabbau von Abfallprodukten. Man spricht hierbei auch von intrazellulären »Verdauungsvorgängen«. Die Lysosomen variieren in Anzahl und Form, sind aber nicht in allen Zelltypen nachweisbar.
Zentralkörperchen (Zentriolen)
In den meisten Zellen gibt es zwei Zentriolen, die, von einer besonderen Plasmazone umschlossen, nahe dem Zellkern liegen. Sie bestehen aus kleinsten Hohlzylindern. Während der Zellteilung erfolgt von den Zentriolen aus die Bildung der Teilungsspindel (Kernspindel).
Metaplasma
Dies sind Fibrillen im Zellplasma, bestehend aus ganz spezifischen Proteinen für die entsprechenden Funktionen in verschiedenen Zellen. Man unterscheidet:
• Neurofibrillen in den Nervenzellen,
• Tonofibrillen in den Epithelzellen,
• Myofibrillen in den Muskelzellen.
Außerdem gibt es ein Röhrensystem (Mikrotubuli) im Zellplasma, das an den Bewegungen der Zelle und einer gewissen Stabilität beteiligt sein soll.
Paraplasma
Alle Stoffwechselprodukte, die als Zelleinschlüsse in der Zelle vorkommen, werden als Paraplasma bezeichnet. Dazu zählen Pigmente (z. B. Melanin), Sekretkörnchen, Fette, Glykogen, kristalline Einschlüsse.
1.8.3 Lebensvorgänge der Zelle
Die lebende Zelle ist zu einigen grundlegenden Funktionen befähigt:
• Bewegung
• Reizbarkeit
• Stoffwechsel
• Vermehrung (mit Wachstum und Differenzierung)
Die Bewegung der Zelle äußert sich z. B. in der Plasmaströmung, d. h. Bewegung des Grundplasmas. Diese Art der intrazellulären Bewegung ist auch Ursache der amöboiden Bewegung. Zellfortsätze wie Geißeln (z. B. Schwanzfäden der Spermien) und Flimmerhärchen (z. B. in den Atemwegen oder den Eileitern) sind zur Eigenbewegung befähigt.
Besondere Bedeutung kommt auch den Myofibrillen in den Muskelzellen zu, durch die eine Muskelbewegung erst möglich wird.
Die Reizbarkeit gilt für jede Zelle. Sie kann Reize, z. B. thermische, mechanische, elektrische Reize, aufnehmen und verarbeiten. Im Nervengewebe und im Sinnesepithel ist diese Fähigkeit besonders ausgeprägt.
Der Zellstoffwechsel umfasst die Aufnahme, Verwertung und Abgabe von Stoffen.
• Stoffaufnahme; sie wird allgemein als Resorption über die Zellmembran bezeichnet. Das kann passiv durch Osmose oder Diffusion – entsprechend dem Konzentrationsgefälle – geschehen oder aktiv durch Phagozytose von festen Bestandteilen oder Pinozytose von flüssigen Bestandteilen in das Innere der Zelle.
• Stoffverwertung; sie erfolgt intrazellulär mit Bildung neuer, körpereigner Stoffe, Entstehung von Energie und von Schlackenstoffen.
• Stoffabgabe von spezifischen Substanzen, wie z. B. Enzymen, Hormonen. In den Drüsenzellen besteht eine sehr intensive Sekretion. Diese Zellen zeigen vielfach ausgesprochene Sekretionsphasen. Neben der Sekretbildung wird Sekret gespeichert und erst auf besonderen Reiz hin abgegeben.
Auch die Schlackenstoffe wie Kohlendioxid, Ammoniak und auch Wasser werden ausgeschieden.
Eine Zellvermehrung ist während der gesamten Lebensdauer des Organismus notwendig, vor allem aber auch während der Wachstumsperiode des Lebewesens. Die Zellvermehrung geschieht im Organismus durch Zellteilung, wozu fast alle kernhaltigen Körperzellen fähig sind.
Jede Körperzelle unterliegt einem Generationszyklus, d. h. sie hat eine bestimmte Lebensdauer, beginnend mit der Teilung, über Wachstum und Differenzierung der Zelle bis zur neuen Teilung.
Während des Wachstums nimmt die Zelle an Substanz, besonders an Eiweißverbindungen zu, bis sie die spezifische Größe erreicht hat. Gleichzeitig findet auch die Differenzierung für die entsprechende Funktion der Zelle statt, je nach Organ oder Gewebe, dem sie zugeordnet ist.
Die Zyklusdauer ist sehr verschieden. Blut- und Epithelzellen haben eine kurze Lebensdauer, weshalb diese Zellen häufig erneuert werden. Nervenzellen und Zellen der quergestreiften Muskulatur haben dagegen eine sehr lange Lebensdauer, so dass ihr Generationszyklus der Lebensdauer des Tieres entspricht. Die Zellen werden meistens nicht erneuert.
Durch die Zellvermehrung werden gealterte und absterbende Zellen ersetzt. Der Alterungsprozess der Zelle gehört auch zum Generationszyklus und zeigt sich zuerst in einer Zunahme der Lysosomen, dann in einer Eindickung (Wasserverlust) des Zytoplasmas und damit Störung des Zellstoffwechsels und Degeneration der Zelle. Der Kern wird aufgelöst und zerfällt. Schließlich wird die lebensunfähige Zelle abgebaut, abgestoßen oder phagozytiert.
Zellteilung
Die Formen der Zellteilung sind:
• Indirekte Zellteilung (Mitose): die Chromosomenspalthälften werden zu gleichen Teilen auf die Tochterzellen verteilt. Dies ist die häufigste Art der Zellteilung.
• Direkte Zellteilung (Amitose): eine einfache und schnelle Durchschnürung des Zellkerns und des Zytoplasmas.
• Reduktions- oder Reifeteilung (Meiose): hier wird durch zwei Teilungsebenen der Chromosomensatz um die Hälfte reduziert. Es entstehen die reifen Geschlechtszellen (Eizellen oder Samenzellen).
Die Mitose läuft in vier Phasen ab (Abb. 1.9):
• Prophase; Auflösung der Zellorganellen, Spiralisierung der Chromosomen, Auflösung der Kernmembran und des Nukleolus. Bildung des Spindelapparates (Kernspindel) aus den Zentriolen und dann Längsspaltung der Chromosomen.
• Metaphase; Anheften der Chromosomen an den Fasern des Spindelapparates und Anordnung in der Äquatorialebene, Entstehung des Muttersterns (Monaster).
• Anaphase; die Chromosomenspalthälften werden zu den Spindelpolen gezogen, Entstehung der beiden Tochtersterne (Diaster), Beginn der Zytoplasmateilung in der Zellmitte.
• Telophase; Entspiralisierung der Chromosomen, Bildung der Nukleoli und einer Membran um die neuen Tochterzellkerne, Abschnürung der Tochterzellen durch Bildung neuer Zellmembranen.
Nach der abgeschlossenen Teilung bilden sich die Zellorganellen und es beginnt die Differenzierung der neuen Zellen.
Die Mitose dauert durchschnittlich dreißig Minuten und ist während dieser Zeit störanfällig. Schäden an den Chromosomen und Störungen der Spindelfunktion können durch Mitosegifte (z. B. Zytostatika) oder Strahlen (z. B. Röntgenstrahlen) verursacht sein.
1.8.4 Einteilung des Körpergewebes
Jede Gewebeart stellt einen Verband gleichartiger Zellen mit einheitlicher Funktion dar.
Der Zusammenhalt des Zellverbandes wird durch die Zwischenzellsubstanz (Interzellularsubstanz) gewährleistet, gebildet von den Zellen des jeweiligen Gewebes. Im Epithelgewebe ist diese Zwischenzellsubstanz eine dünne, homogene Schicht, als Kittsubstanz bezeichnet. Im Bindegewebe dagegen sind in die Zwischenzellmasse Fasern und im Knochengewebe außerdem Mineralstoffe eingelagert. Die verschiedenen Gewebearten sind:
• Epithelgewebe
• Binde- und Stützgewebe
• Muskelgewebe
• Nervengewebe
Epithelgewebe
Einteilung des Epithelgewebes:
• Deckepithel
• Drüsenepithel
• Sinnesepithel
Deckepithel
Das Deckepithel ist die oberste Schicht der Körperoberfläche und die Auskleidung aller inneren Hohlorgane sowie der Körperhöhlen. Es enthält wenig Interzellularsubstanz und keine Blutgefäße. Die Funktionen des Deckepithels sind der Schutz vor thermischen, chemischen oder anderen Einflüssen, und die Funktionen der Resorption und Sekretion.

Abb. 1.9: Indirekte Zellteilung (Mitose). (a) Prophase, (b) Metaphase, (c) Anaphase, (d) Telophase.
Die unterschiedlichen Zellformen und Schichtungen des Deckepithels lassen folgende Einteilung zu (Abb. 1.10):
a) Einschichtiges Plattenepithel. Nur eine Schicht abgeplatteter Zellen, Serosa des Bauch- und Brustfells und des Herzbeutels, Endothel der Blut- und Lymphgefäße und des Herzens, Auskleidung der Lungenalveolen, häutiges Labyrinth des inneren Ohres.
b) Einschichtiges kubisches Epithel. Würfelförmige Zellen, Epithel verschiedener Drüsenausführungsgänge und Nierenkanälchen.
c) Einschichtiges Zylinderepithel. Auch als hochprismatisches Epithel bezeichnet, die Zellen können teilweise Ausstülpungen (Mikrovilli des Darmes) oder einen Besatz von Härchen (Flimmerepithel des Eileiters) aufweisen, Auskleidung des Magens und des Darmkanals, des Eileiters, der Gallenblase, der Gebärmutter und Drüsenausführungsgänge.

Abb. 1.10: Epithelgewebeformen. (a) einschichtiges Plattenepithel: Flächenansicht und Schnittbild, (b) einschichtiges kubisches Epithel, (c) einschichtiges Zylinderepithel, (d) mehrstufiges Flimmerepithel, (e) mehrschichtiges Zylinderepithel, (f) mehrschichtiges Plattenepithel, (g) Übergangsepithel.
d) Mehrstufiges Flimmerepithel. Auch als mehrreihiges Epithel bezeichnet, die Zellen sitzen alle einer Basalmembran auf, aber nicht alle Zellen erreichen die Schichtoberfläche, Auskleidung der Atemwege.
e) Mehrschichtiges Zylinderepithel. Nicht alle Zellen sitzen der Basalmembran auf, Drüsenausführungsgänge und Übergang der Lidbindehaut zum Augapfel.
f) Mehrschichtiges Plattenepithel. Mehrere Zellschichten, die Dicke und Verhornung des Epithels hängt von der Beanspruchung ab. Es gibt das verhornende Plattenepithel der Haut und das nicht verhornende Epithel der kutanen Schleimhaut (z. B. Mundhöhle, Speiseröhre) sowie der Hornhaut des Augapfels.
g) Übergangsepithel. Mehrstufiges, sehr dehnungsfähiges Epithel in den ableitenden Harnwegen und der Harnblase.
Drüsenepithel
Das Drüsenepithel ist für die Sekretion zuständig. Aus dem Deckepithel entwickeln sich die Zellen des Drüsenepithels, diese wachsen in die Tiefe und bleiben entweder mit der Oberfläche durch einen Ausführungsgang in Verbindung (exokrine Drüsen, Abb. 1.11a) oder die Verbindung wird rückgebildet, und es besteht keine Verbindung mehr zur Oberfläche (endokrine Drüsen, Abb. 1.11b). In diesem Fall wird der Drüseninhalt an den Blutstrom abgegeben.
Es gibt einzellige Drüsen (z. B. Becherzellen des Darmepithels, siehe Abb. 1.10c) oder die Zellverbände der übrigen Drüsen (z. B. Schweiß-, Talg-, Tränendrüsen und die Hormondrüsen des endokrinen Systems).
Sinnesepithel
Zum Sinnesepithel gehören die differenzierten Zellen der Sinnesorgane. Das sind die Hörzellen, die Haarzellen des Gleichgewichtsorgans, das Riechepithel, das Epithel der Geschmacksknospen, die Stäbchen- und Zapfenzellen des Auges und spezifische Nervenendigungen. Sie dienen der Aufnahme von Reizen aus der Umwelt.
Binde- und Stützgewebe (Abb. 1.12)
Wie der Name sagt, dient dieses Gewebe der Bindung, Verbindung, Stützung von Organen und Organteilen im Körper. Bindegewebe dient z. B. als Füllgewebe in organfreien Räumen, als Hüllgewebe in Organkapseln, als Gerüstgewebe (Interstitium) in Organen und als Stützgewebe in Knochen und Knorpeln. Bindegewebe stellt die Verbindung zwischen Muskeln und Knochen her. Bindegewebe kann Wasser und Fett speichern und übernimmt Aufgaben der körpereigenen Abwehr. Das Bindegewebe besteht aus:
• Zellen, mit sehr unterschiedlicher Gestalt, entsprechend der Funktion.
• Interzellularsubstanz, als wässrige bis gelartige Grundsubstanz im Bindegewebe und in etwas festerer Konsistenz im Stützgewebe (Knorpel und Knochen). In die Grundsubstanz eingelagert sind kollagene oder elastische Fasern und Gitterfasern, die sich, da sie gleichzeitig vorhanden sind, z. T. in ihren Aufgaben unterstützen.
Das embryonale Bindegewebe (Mesenchym) ist das Ausgangsgewebe, aus dem sich die verschiedenen Bindegewebsarten entwickeln (Abb. 1.13).
Retikuläres Bindegewebe (Abb. 1.13a)
Es ist das netzartige Grundgerüst in Milz, Lymphknoten und Knochenmark. Aus den Retikulumzellen der Milz und der Lymphknoten entstehen Lymphozyten, aus denen des Knochenmarks die Erythrozyten und Leukozyten.

Abb. 1.13: Unterschiedliche Bindegewebsarten. (a) retikuläres Bindegewebe, (b) straffes Bindegewebe, (c) Fettgewebe.
Retikulumzellen können Stoffe speichern, z. B. Fett im Knochenmark oder Staubteilchen in den Lungenlymphknoten. Sie sind außerdem zur Phagozytose fähig (zelluläre Abwehr). In der Milz werden unbrauchbare Erythrozten von den Retikulumzellen abgebaut.
Das Fettgewebe ist ebenfalls ein retikuläres Gewebe. Die Zellen können sich abrunden, der Kern ist dann randständig (Siegelringform der Zelle) und das Innere der Zelle ist mit Fett gefüllt. Außen werden die Fettzellen von Gitterfasern umsponnen, die zusammen mit elastischen Fasern den mechanischen Außendruck auf die Fettzelle auffangen.
Fettgewebe (Abb. 1.13c) dient zur Speicherung des Depotfetts, als Druckpolster und Wärmeschutz (Nierengegend), formt die Körpergestalt, bildet das Kammfett bei Hengst und Bulle und kann auch fettlösliche Substanzen (z. B. Vitamine) speichern.
Lockeres Bindegewebe
Als faseriges Gebilde füllt das lockere Bindegewebe die Räume zwischen den Organen und Spalten zwischen Gewebsschichten, verbindet Organteile und ermöglicht teilweise ein Gleiten der Organteile gegeneinander. Bindegewebe befindet sich in der Unterhaut und zwischen Muskelbündeln und es bildet das interstitielle Gerüst verschiedener Organe (z. B. Leber). Es wird als Füll- und Verschiebegewebe bezeichnet. In ihm sind die Nerven, Blut- und Lymphgefäße eingebettet und es dient als Wasserspeicher. Besondere Bedeutung hat es für die Narbenbildung nach Verletzungen.
Die Zellen des lockeren Bindegewebes sind die Fibrozyten.
Es lassen sich aber auch noch andere, freie Zellen nachweisen: Histiozyten, Plasmazellen, Lymphozyten, Leukozyten. Diese Zellen beteiligen sich an der Abwehrfunktion.
Straffes Bindegewebe (Abb. 1.13b)
Straffes Bindegewebe besteht aus Bündeln dicht gelagerter, meist kollagener Fasern mit wenigen Fibrozyten. Die parallele Bündelung der Fasern ist für die Beanspruchung durch Zug bei Sehnen und Bändern notwendig. Straffes Bindegewebe ist außerdem in der Lederhaut, den Gelenkkapseln, den Organkapseln, der Knochenhaut, dem Herzbeutel und in den Faszien zu finden. Elastisches Bindegewebe ist durch ein Überwiegen der elastischen Fasern gekennzeichnet, z. B. im Nackenband, in der Blutgefäßwand und in der Pleura.
Knorpelgewebe (Abb. 1.14)
Nach der Beschaffenheit der Grundsubstanz lässt sich Knorpelgewebe in hyalinen Knorpel, Faserknorpel und elastischen Knorpel einteilen. Die Knorpelzellen (Chondrozyten) liegen in Gruppen oder einzeln in einer weichen Kapsel innerhalb der Grundsubstanz. Der Knorpel selbst hat keine Blutgefäße, er wird über die ihn umgebende Knorpelhaut ernährt. Knorpel ist sehr druckelastisch.

Abb. 1.14: Knorpelgewebe. (a) hyaliner Knorpel, (b) Faserknorpel, (c)elastischer Knorpel.

Abb. 1.16: Muskelgewebe im Längs- und Querschnitt. (a) glatte Eingeweidemuskulatur, (b) quergestreifte Skelettmuskulatur, (c) quergestreifte Herzmuskulatur.
Beim hyalinen Knorpel (Glasknorpel) sind in die Grundsubstanz kollagene Fasern eingelagert, die im Lichtmikroskop nicht sichtbar sind, weil sie die gleiche Lichtbrechung haben wie die Zellgrundsubstanz. Der hyaline Knorpel kommt im Körper häufig vor, z. B. als Rippenknorpel, Gelenkknorpel, Trachealring und Nasenscheidewand.
Der Faserknorpel enthält weniger Zellen, aber viele kollagene Faserbündel, die dem Knorpel besondere Festigkeit verleihen, z. B. Hufknorpel, Menisken des Kniegelenks und an den Zwischenwirbelscheiben.
Der elastische Knorpel enthält besonders viele elastische Fasern, was eine höhere Biegsamkeit des Knorpels ermöglicht, z. B. Ohrmuschelknorpel, Kehldeckel.
Knochengewebe (Abb. 1.15)
Das Knochengewebe gehört wie das Knorpelgewebe zum stützenden Teil des Bindegewebes. Die Knochenzellen (Osteozyten) sind längliche Zellen mit vielen, sehr feinen Fortsätzen, die eine Verbindung von Zelle zu Zelle herstellen. Reife Knochenzellen bilden Knochenlamellen, deren Hauptbestandteile kollagene Faserbündel und die in der Grundsubstanz eingelagerten Mineralstoffe sind. Die Knochenlamellen sind zirkulär (kreisförmig) um einen zentralen Blutgefäßkanal (Haversscher Kanal) angeordnet. Diese Einheit ist ein Osteon. Die Osteone werden durch Schaltlamellen miteinander verbunden. In der Außenschicht des Knochens verlaufen die parallel angeordneten Generallamellen. Die Haversschen Kanäle haben Verbindung zu größeren, sog. Volkmannschen Kanälen und zu den Blutgefäßen der Knochenoberfläche.
Die Anordnung der Lamellen, ihre Form und Größe, die Fasern der Zellgrundsubstanz und besonders die eingelagerten Mineralstoffe (Kalzium-, Magnesium-, Phosphorverbindungen) sorgen für die Stabilität des Knochens.
Das Zahnbein (Dentin) der Zähne ist ein abgewandeltes Knochengewebe.
Muskelgewebe (Abb. 1.16)
Die Bewegung des Körpers oder im Körper ist u. a. durch die Kontraktionsfähigkeit der Muskelfasern (Myofibrillen) im Muskelgewebe möglich. Dieses steht mit dem benachbarten Bindegewebe in direkter Verbindung (z. B. die Sehnen der Skelettmuskulatur), so dass die Kontraktionskraft des Muskels auf den Knochen übertragen werden kann. Als Muskulatur wird die Gesamtheit der Muskeln bezeichnet.
Nach dem Bau und der Funktion lassen sich aber drei verschiedene Muskelgewebearten unterscheiden:
• glatte Eingeweidemuskulatur
• quergestreifte Skelettmuskulatur
• quergestreifte Herzmuskulatur
Glatte Eingeweidemuskulatur
Die glatte Eingeweidemuskulatur besteht aus spindelförmigen Zellen, deren Kern zentral in der Zelle liegt. Das Zytoplasma wird als Sarkoplasma bezeichnet und enthält neben den Organellen die Myofibrillen. Die Zellmembran ist von einer Gitterhülle umgeben, die in Verbindung zum intramuskulären Bindegewebe steht. Parallel zu Bündeln geordnete Muskelzellen bilden die Muskelfasern. Glatte Muskulatur existiert im Verdauungstrakt, Harn- und Geschlechtsapparat, in den tiefen Atemwegen, den Gefäßen und an Drüsen und Haaren.
Quergestreifte Skelettmuskulatur
Die quergestreifte Skelettmuskulatur liefert im histologischen Aufbau ein völlig anderes Bild als die glatte Muskulatur. Die Zellen zeigen – mikroskopisch sichtbar – helle, einfachlichtbrechende Streifen und dunkle, doppellichtbrechende Streifen der Myofibrillen.
Die Skelettmuskelzellen (hier spricht man von Muskelfasern) sind mehrere Zentimeter lang und haben, da es sich um einen langen »Sarkoplasmaschlauch« handelt, auch viele Kerne. Die Anzahl der Kerne ist von der Größe der Zelle abhängig. Alle Kerne liegen peripher der Zellmembran an.
Neben den Zellorganellen und Myofibrillen enthalten die Zellen der Skelettmuskulatur den Farbstoff Myoglobin. Er ist wie das Hämoglobin zur Sauerstoffbindung befähigt. Die Zellen können außerdem gespeichertes Glykogen und Fett enthalten. Zwischen den Muskelfasern liegt in dünner Schicht lockeres Bindegewebe mit vielen Kapillaren. Jede Muskelzelle hat Kontakt mit Nervenfasern. Die Verbindungsstelle ist die sog. motorische Endplatte, von der aus die Erregung auf die Muskelzellmembran übertragen wird.
Quergestreifte Herzmuskulatur
Die quergestreifte Herzmuskulatur weist wie die Skelettmuskulatur die Querstreifung der Myofibrillen auf. Jede Zelle enthält meist nur einen, zentral liegenden Kern. Alle Zellen sind durch Glanzstreifen miteinander verbunden und vereinigen sich netzartig zu den Herzmuskelfasern. Die Glanzstreifen sind mikroskopisch als Quergrenzen der Herzmuskelzellen zu erkennen. Im Sarkoplasma sind viele Mitochondrien zu finden, deren Anzahl aber schwankt und mit der Arbeitsleistung der verschiedenen Herzmuskelabschnitte zu tun hat. In der Muskulatur der Herzkammern gibt es weit mehr Mitochondrien als in der Vorhofmuskulatur.
Der Herzmuskel ist reichlich mit Kapillaren im Interstitium ausgestattet. Dies ist notwendig für die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff, der durch das Myoglobin der Herzmuskelzelle gebunden wird.
Eine besondere Art der Herzmuskelfasern stellen die Purkinjeschen Fasern dar. Ihre Zellen haben weniger Myofibrillen, dafür einen höheren Glykogengehalt. Sie bilden mit dem His-Bündel das Erregungsleitungssystem des Herzens.

Abb. 1.18: Synapse und Ausschnitt einer Nervenzelle.
Nervengewebe
Das Nervengewebe ermöglicht die Auseinandersetzung des Lebewesens mit der Umwelt. Es werden Reize aufgenommen, weitergeleitet, verarbeitet und Reaktionen als Antworten abgegeben und dem Erfolgsorgan übertragen. Diese Leistungen werden vom Nervensystem erbracht.
Die kleinste Einheit des Nervensystems ist das Neuron (Abb. 1.17, 1.19).
In der Nervenzelle liegen ein großer Kern, ausgeprägtes endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Apparat und sehr viele Mitochondrien sowie Neurofibrillen. Es besteht ein reger Stoffwechsel, der viel Energie und Sauerstoff benötigt. Kommt es zur Nachschubbehinderung, können bereits nach zwei Minuten irreversible Schäden auftreten. Nervenzellen können sich nicht teilen und nicht erneuern.
Die Dendriten der Neurozyten mit ihren zahlreichen Verzweigungen stellen eine Oberflächenvergrößerung dar und ermöglichen einen vielzähligen Kontakt mit anderen Nervenzellen. Die Dendriten nehmen die Erregung auf (afferente Fortsätze), der Neurit als lange Nervenfaser (efferenter Fortsatz) dient der Weiterleitung an andere Nervenbahnen und Körperzellen, z. B. Muskel- und Drüsenzellen.
Der Neurit ist von einer Scheide aus Schwannschen Zellen – das sind Gliazellen – umhüllt. Die Hülle zeigt Unterbrechungen, die sog. Ranvierschen Schnürringe, die eine Bedeutung für die Weiterleitung der Erregung haben. Die Gliazellen dienen dem Schutz, der Stützung und Ernährung der Nervenzellen.
Mehrere Nervenfasern bilden ein Faserbündel. Mehrere Nervenfaserbündel bilden den Nerv. Der Nerv kann sehr lang sein, z. B. kann er vom Großhirn bis zum Ende des Rückenmarks reichen.
Die Synapsen sind die Schaltstellen im Nervensystem (Abb. 1.18). Sie übertragen die Erregung von einem Neuron zum nächsten.
Die präsynaptische knopfartige Endverdickung einer Nervenzelle liegt in der postsynaptischen Vertiefung der Empfängerzelle. Zwischen beiden Zellen besteht ein Spalt. In der präsynaptischen Endverdickung sind Bläschen mit Überträgerstoffen, sog. Transmittern. Sie werden in den Spalt ausgeschüttet und aktivieren die postsynaptische Membran. Synapsen befinden sich an den Dendriten und dem Neurit der Nervenzelle. Die Anzahl der Synapsen zwischen zwei Neuronen kann erheblich schwanken.

Abb. 1.19: Aufbau eines Neurons.
Wichtige Begriffe aus der Zell- und Gewebelehre
| Anatomie | Lehre vom Bau des Körpers |
| Physiologie | Lehre von den normalen Lebensvorgängen |
| Funktion | Tätigkeit, Ablauf von physikalischen und chemischen Vorgängen |
| Zytologie | Lehre von den Zellen |
| Histologie | Lehre von den Geweben |
| Epithelgewebe | Oberflächen- oder Deckgewebe |
| Zellmembran | Zellhäutchen |
| Zytoplasma, Protoplasma | Zellkörper |
| Zellorganellen | spezialisierte Strukturen in der Zelle |
| Ribosomen | Zellorganellen für die Eiweißsynthese |
| Mitochondrien | Energielieferanten der Zelle |
| endoplasmatisches | Netzwerk von wichtigen Zellbestandteilen |
| Retikulum | im Zellkörper |
| Nukleus | Zellkern |
| Chromosomen | Zellschleifen, Erbanlagenträger |
| Zentriolen | Bildner der Teilungsspindel |
| Neuron | Nervenzelle mit ihren Fortsätzen |
| Ganglienzellen, Neurozyten | Nervenzellen |
| Dendriten, Neurit | Fortsätze der Nervenzellen |
| Synapse | Schaltstelle im Nervensystem |
| Neurofibrillen | feinste Fäserchen der einzelnen Nervenfaser oder Nervenzelle |
| Gliagewebe | Nervenstütz- und -nährgewebe |
LERNFELD 2 |
PATIENTEN UND KLIENTEN EMPFANGEN UND BIS ZUR BEHANDLUNG BEGLEITEN |
Die TFA ist häufig die erste Person, mit der die Klienten einer Tierarztpraxis in Kontakt treten. Daher sind das Auftreten und die Kompetenz auf fachlichem und kommunikativem Gebiet mitunter entscheidend dafür, ob die Praxis auf Klienten einen positiven Eindruck macht. Auch die Gestaltung des Arbeitsbereiches an der Anmeldung und im Wartebereich gehört zum Gesamtbild der Praxis. Die TFA ist angehalten, ihre Arbeitsbereiche selbst zu organisieren. Sie muss dabei Aspekte der Psychologie, Hygiene und Kommunikation berücksichtigen. Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen in das Befinden von Klienten und Patienten sind Eigenschaften, die von der TFA zu Recht erwartet werden. Auch die Fähigkeit, souverän mit psychischen Ausnahmesituationen und Konflikten umzugehen, zeichnet eine kompetente TFA aus.
Bei allen Tätigkeiten innerhalb der Praxis, also bereits vor der eigentlichen Behandlung der Patienten durch den Tierarzt, müssen hygienische Standards beachtet und realisiert werden. Insbesondere im Bereich der Kunden- und Patientenaufnahme sind die TFA oft selbstständig für die Umsetzung des praxisspezifischen Hygieneplans verantwortlich.  LF 3: Praxispflege und Hygiene
LF 3: Praxispflege und Hygiene
Praxisbeispiel 1
Herr Dösig hat sich eine Katze angeschafft und betritt zum ersten Mal die Praxis. Er möchte die Katze untersuchen und impfen lassen und weiß nicht, welche Impfungen notwendig und sinnvoll sind.
Praxisbeispiel 2
Die langjährige Klientin Frau Lieblich ist Halterin von vier Reitpferden und kommt zur Anmeldung, um bei der TFA für alle vier Pferde Wurmkuren zu kaufen. Sie weiß, welches Präparat sie immer vom Tierarzt bekommt und hat es eilig. Der Tierarzt ist momentan unterwegs und telefonisch nicht zu erreichen, und die TFA soll der Klientin nun die Arzneimittel ohne tierärztliche Anweisung verkaufen.
Praxisbeispiel 3
Die TFA hat den Auftrag, einen Bogen zum Ausfüllen für die Klienten zu entwerfen, der die Stammdaten der Klienten und Patienten und den Vorbericht beinhaltet. In einer Besprechung teilt der Tierarzt der TFA mit, welche Fragen hier schon gestellt und beantwortet werden sollen.
Leitfragen
• Welche Aufgaben haben Sie im Praxisalltag?
• Welche Aufgaben haben Sie im Anmeldebereich?
• Wie organisieren Sie die Klientenbetreuung bis zur medizinischen Behandlung der Patienten?
• Worauf achten Sie bei der Kommunikation im Anmeldebereich?
• Worauf achten Sie speziell beim Telefonieren?
• Wie gehen Sie auf die Patienten zu?
• Wie gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich an der Anmeldung?
• Wie gestalten Sie den Wartebereich?
• Wie erstellen Sie einen Hygieneplan?
• Wie kontrollieren Sie die Einhaltung des Hygieneplans?
• Welche Leistungen bietet die Praxis?
• Wie präsentieren Sie den Klienten das Leistungsangebot der Praxis?
• Wie verhalten Sie sich den verschiedenen Klienten gegenüber?
• Wie reagieren Sie auf verschiedene Ausnahmesituationen?
• Welche Konflikte können bis zur Behandlung auftreten?
• Wie reagieren Sie auf Konfliktsituationen?

2.1 Aufnahme des Patienten
2.1.1 Signalement und Anamnese
Bei der Vorstellung eines Patienten in der Praxis wird als Erstes ein Vorbericht (Anamnese) erhoben (Tab. 2.1). Bestehen Zweifel bei der Aufnahme der Kennzeichen eines Patienten, wird die Zuhilfenahme einer Rassenkunde notwendig (Tab. 2.2).
Durch entsprechende Literatur kann sich die TFA ausreichende Kenntnisse über die Rassenunterschiede bei den einzelnen Tieren aneignen.
Kennzeichnen der Tiere
Zur genauen Befunderhebung und Unterscheidung der Tierpatienten ist eine ausführliche Beschreibung der Kennzeichen (Signalement, Nationale) erforderlich.
Zusätzliche Kennzeichnung von Tieren
Im Allgemeinen werden Tiere zur Markierung mit Ohrmarken oder Schenkelbrand versehen, beringt oder tätowiert.
Die Identifikation von Tieren (Pferde, Kleintiere, Vögel) wird heute aber vielfach mithilfe eines elektronischen Markierungssystems vorgenommen. Zur Kennzeichnung dient ein Transponder-Mikrochip, der als Implantat unter die Haut oder intramuskulär im Halsbereich gesetzt wird. In ihm ist ein einmalig vergebener Nummern-Code gespeichert. Mit einem elektronischen Lesegerät kann die Nummer gelesen werden. Eine Normierung durch die internationale Standardorganisation (ISO) sorgt dafür, dass eine Identifikation in vielen Ländern möglich ist.
Tabelle 2.1: Checkliste Vorbericht (Anamnese)
Name, Anschrift und Telefonnummer des Tierbesitzers |
|
Den Patienten betreffend: |
|
• Herkunft des Tieres | (z.B. Ausland, Züchter, Tierheim) |
• Gebrauchszweck | (z.B. Reitpferd, Jagdhund) |
• Dauerdiagnosen | (Diabetes, Allergie, Herzfehler u.a.) |
• Wie lange krank? | (Krankheitsdauer) |
• Was wurde beobachtet? | (Krankheitserscheinungen) |
• Wann aufgetreten? | (plötzlich, allmählich, Gleichbleiben oder Zunahme der Krankheitserscheinungen) |
• In welchem Zusammenhang? | (Haltung, Futteraufnahme, Giftaufnahme, Unfall, Ansteckung) |
• Wie viele Tiere erkrankt? | (Einzel-, Stall-, Herdenerkrankung) |
• Regelmäßige Impfungen? | (ausreichender Impfschutz) |
• Haltung | (Stall, Zwinger, Wohnung) |
• Fütterung? | (mögliche Falsch- oder Mangelernährung) |
• Wurde bereits tierärztlich oder durch den Besitzer behandelt? | (wie, mit welchen Medikamenten; evtl. auch schon länger zurückliegend) |
• Gewicht | (aktuelles Gewicht ermitteln) |
• Zusätzliche Äußerungen des Tierbesitzers | |
Tabelle 2.2: Kennzeichnung (Signalement)
| Kennzeichnung | Beispiel 1 | Beispiel 2 |
| Tierart | Pferd | Hund |
| Rasse | Warmblut | Vorstehhund |
| Geschlecht | Stute | Hündin |
| Farbe | Fuchs | Braun |
| Abzeichen | Blesse | Stichelhaare |
| Besondere Kennzeichen | Schenkelbrand, Transponder | Tätowierung, Transponder |
| Alter | ||
| Tiername | ||
| Größe | Schulterhöhe in Zentimeter | Schulterhöhe in Zentimeter |
Die Kennzeichnung mit dem Transponder eignet sich z. B. für den Identitätsnachweis im Reiseverkehr, auf Turnieren und Ausstellungen, bei Zuchttieren, bei den Auflagen des Artenschutzes und für die Identifizierung (über Registrierungszentralen) herrenlos aufgefundener Tiere. Der Einsatz des Chip ist bei Trabern von besonderer Bedeutung, weil bei dieser Pferderasse häufig keine Abzeichen vorhanden sind. Bei Rindern gilt für die Kennzeichnung EU-weit seit 1.1.1998 die einheitliche Vorschrift, dass alle ab diesem Datum geborenen Rinder zwei Ohrmarken, je Ohr eine Marke mit gleicher Nummer tragen müssen. Dies ist eine Forderung der Tierseuchenbekämpfung und wurde durch die BSE-Bekämpfung aktuell.
Für jedes Rind sind außerdem ein Tierpass und eine Eintragung im Bestandsregister notwendig. Seit dem 1. Juli 2000 müssen alle Einhufer (Pferde, Ponys) auch beim innerstaatlichen Transport ein Dokument zur Identifizierung, den sog. »Equidenpass«, mitführen.  LF 3: Equidenpass
LF 3: Equidenpass
2.2 Einführung in die medizinische Fachsprache
Wie in vielen anderen Berufen ist auch in den Heilberufen die Kenntnis einer Fachsprache (Terminologie) notwendige Voraussetzung für ein einheitliches Verständnis der vielfältigen medizinischen Begriffe.
Es ist eine Aufgabe der Ausbildung zur TFA, eine Einführung in die medizinische Terminologie zu geben, damit sie die in der Praxis üblichen Fachausdrücke auch anwenden und ein medizinisches Wörterbuch lesen kann. Medizinische Fachbegriffe werden lateinisch geschrieben und entstammen zum weitaus größten Teil den klassischen Sprachen Griechisch und Latein und nur zu einem geringen Prozentsatz anderen Sprachen.
Die lateinische Sprache hat viele Bezeichnungen selbst gebildet, aber noch mehr als Fremdwörter von der griechischen Sprache übernommen und »latinisiert«, d. h. in die eigene sprachliche Form umgebildet.
2.2.1 Verwendung von Fachbegriffen
Bildung medizinischer Begriffe
Für die Bildung medizinischer Begriffe auf der Grundlage der lateinischen und griechischen Sprache stehen verschiedene Wortelemente zur Verfügung (Tab. 2.3–2.6):
• Vorsilben (Präfixe) z. B. endo = innen
• Wortstämme mit Endungen (v. a. Haupt- und Eigenschaftswörter) z. B. Tonus = der Druck, die Spannung
• Bindevokale z. B. Psych-o-logie = Seelenkunde
• Nachsilben (Suffixe) z. B. Hepat-itis = Leberentzündung
Terminusbildung durch verschiedene Attribute
Die Begriffsbildung (Terminusbildung) kann erstens aus einzelnen Wörtern durch Attribute entstehen, z. B. Arteria pulmonalis = Lungenarterie.
Dabei stehen im Lateinischen die das Hauptwort (Substantiv) näher bestimmenden Attribute im Gegensatz zum Deutschen in der Regel hinter dem Substantiv.
Tabelle 2.3: Beispiele der Terminusbildung durch verschiedene Attribute

Terminusbildung durch Wortzusammensetzung
Die andere Möglichkeit der Terminusbildung ist die Zusammensetzung von mehreren Wortelementen.
Tabelle 2.4: Beispiele der Terminusbildung durch Wortzusammensetzung
| aus Wortstämmen | Neur-algie = Nervenschmerzen |
| aus Vorsilbe und Wortstamm | Hypo-tonus = Unterdruck |
| aus Wortstämmen und Nachsilbe | Osteo-myel-itis = Knochenmarkentzündung |
| aus Vorsilbe, Wortstamm, Nachsilbe | Peri-kard-itis = Herzbeutelentzündung |
Tabelle 2.5: Die fünf lateinischen Deklinationen (nach den verschiedenen Wortstammauslauten)
| a-Deklination: | Vena portae = die Pfortader (die Vene der Leberpforte) |
| o-Deklination: | Fundus oculi = der Augenhintergrund (der Grund bzw. Boden des Auges) |
| u-Deklination: | Exitus letalis = der Tod (der tödliche Ausgang) |
| e-Deklination: | facies = das Gesicht |
| konsonantische Deklination: | foramen occipitale = das Hinterhauptsloch (das Loch des Hinterhaupts) |
Tabelle 2.6: Übersicht über wichtige Vorsilben
| Vorsilbe | Bedeutung | Beispiel |
| a- | Verneinung | Avitaminose |
| an- | Anämie | |
| anti- | gegen | Antigen |
| dys- | Normabweichung | Dyspnoe |
| ekto- | außen | Ektoparasit |
| endo- | Innen | Endothel |
| epi- | auf, bei | Epidermis |
| ex- | aus, heraus | Exkret |
| extra- | außerhalb | Extrasystole |
| hypo- | unter, Unterfunktion | Hypoglykämie |
| hyper- | über, Überfunktion | Hypertonie |
| para- | daneben | Parasympathikus |
| peri- | um, herum | Periost |
| post- | hinter, danach | Postoperativ |
| pro- | vorher, davor | Prognose |
| syn-, sym- | mit, zusammen | Symptom |
| Vorsilben mit quantitativer Bedeutung | ||
| hemi- | halb | Hemiplegie |
| holo- | ganz | Holosystolisch |
| mikro- | klein, kurz | Mikrobiologie |
| makro- | groß, lang | Makroskopisch |
| oligo- | wenig, selten | Oligurie |
| poly- | viel, häufig | Polydipsie |
Lateinische Formenlehre
Für das Verständnis der medizinischen Begriffsbildung sind Grundkenntnisse der lateinischen Formenlehre notwendig. Die lateinische Sprache unterscheidet mehrere Beugungen von Haupt- und Eigenschaftswörtern, sog. Deklinationen, bei denen drei Merkmale beachtet werden müssen:
• die Einzahl (Singular) oder die Mehrzahl (Plural)
• der Fall (Casus)
• Berücksichtigung finden in der medizinischen Fachsprache nur der Nominativ (1. Fall) und der Genitiv (2. Fall)
• das Geschlecht (Genus)
• Maskulinum = männlich (z. B. Endung -us)
• Femininum = weiblich (z. B. Endung -a)
• Neutrum = sächlich (z. B. Endung -um)
Im Gegensatz zum Deutschen fehlt im Lateinischen ein Artikel. Deshalb kommt es bei der Deklination der Substantive und Adjektive allein auf die Endungen an, die an den Wortstamm angehängt werden.
Vorsilben (Präfixe) und Nachsilben (Suffixe).
Die medizinische Fachsprache kennt zahlreiche Vorsilben und Endungen, die den eigentlichen Begriffen eine spezifische Bedeutung verleihen (Tab. 2.7).
Tabelle 2.7: Übersicht über wichtige Nachsilben
| Nachsilbe | Bedeutung | Beispiel |
| -itis | Entzündung | Gastritis |
| -osis (-ose) | degenerativer Prozess | Arthrosis |
| -om | Anschwellung, Tumor | Hämatom |
| -id (-idea, – idea) | ähnlich | Thyreoidea |
| -ase | Enzym (Ferment) | Lipase |
| -phil | freundlich | Lipophil |
| -phob | fürchtend | Hydrophob |
Schreibweise, Aussprache, Betonung. In der lateinischen Sprache gibt es außer am Satzanfang und bei Eigennamen keine Großschreibung. Ebenso fehlen die Konsonanten »k« und »z« und die Umlaute. Im deutschen Sprachbereich werden viele Fachbegriffe in eingedeutschter Form geschrieben. Aus »c« wird dann »z« oder »k« und aus ae, oe und ue werden die entsprechenden Umlaute. Beispiel: carcinom = Karzinom; oesophagus = Ösophagus.
Die Buchstabenverbindung -ti- wird vor Vokalen als -zi- gesprochen und in eingedeutschter Form am Wortende mit »z« geschrieben. Beispiel: substantia = Substanz.
Die Betonung liegt im Lateinischen immer auf der vorletzten oder drittletzten Silbe, was auch für latinisierte griechische Wörter gilt.
Die Betonung hängt dabei immer von der Länge oder Kürze der vorletzten Silbe und seiner Vokale ab. Beispiel: musculus: Betonung auf drittletzter Silbe; duodenum: Betonung auf vorletzter Silbe.
2.3 Einteilung des Tierkörpers und der Körperregionen
Der Körper (Organismus) des Tieres setzt sich wie der menschliche Körper aus mehreren Organsystemen zusammen. Die Organsysteme sind ihrerseits aus vielen Organen aufgebaut, die wiederum aus verschiedenen Geweben bestehen, deren kleinste Funktionseinheit die Zelle ist. Die lateinischen Lage- und Richtungsbezeichnungen dienen der eindeutigen Lagebeschreibung von Einzelteilen des Tierkörpers (Abb. 2.1–2.3).
2.3.1 Einteilung der Körperregionen (Abb. 2.1–2.3)
Man teilt den Tierkörper in seine deutlich gegeneinander abgesetzten Hauptteile ein:
• Kopf
• Stamm (bestehend aus Hals, Rumpf und Schwanz)
• Gliedmaßen
Am Kopf (Caput) unterscheidet man den Gehirnteil und den Gesichtsteil. Beide gehen ohne scharfe Grenze ineinander über.
Den Übergang vom Kopf zum Hals bildet die Genickgegend (mit Hinterhauptsbein und erstem Halswirbel), zwischen Unterkieferast und erstem Halswirbel die Ohrspeicheldrüsengegend (Parotisgegend), medial von dieser die Schlundkopfgegend und in kaudaler Fortsetzung des Kehlganges die Kehlkopfgegend.
Am Hals (Collum) unterscheidet man:
• die Halsgegend mit dem Kamm (beim Pferd die Mähne tragend) und den Seitenflächen
• die Drosseladerrinne (besonders deutlich beim Pferd erkennbar), ventral am Hals die Kehle mit der Luftröhrengegend
Der Übergang des Halses in den Rumpf, der sog. Halsaufsatz, wird seitlich als Vorschultergegend bezeichnet.
Der Rumpf (Truncus) besteht aus Brust (Pectus), Bauch (Abdomen) und Becken (Pelvis), dem sich der Schwanz (Cauda) anschließt.
Wichtige Lage- und Richtungsbezeichnungen
| sinister, -tra, -trum | links, der linke … |
| dexter, -tra, -trum | rechts, der rechte … |
| externus, -a, -um | außen liegend |
| internus, -a, -um | innen liegend |
| superior | (weiter) oben liegend |
| inferior | (weiter) unten liegend |
| kranial (anterior1) | vorn, vorderer Teil kopfwärts |
| kaudal (posterior1) | hinten, hinterer Teil, schwanzwärts |
| profundus | tief liegend |
| superficialis | oberflächlich liegend |
| rostral (nasal1) | nasenwärts |
| oral | den Mund betreffend |
| labial | die Lippen betreffend |
| zervikal | halswärts |
| dorsal | rückenwärts |
| thorakal | brustwärts |
| ventral | bauchwärts |
| medial | zur Körpermitte hin |
| lateral | seitwärts, zur Seite hin |
| median | in der Mittellinie des Körpers |
| palmar (volar1) | die Handfläche betreffend (Beugeseite am Vorderfuß) |
| plantar | die Fußsohle betreffend (Beugeseite am Hinterfuß) |
| proximal | körpernah |
| distal | körperfern (besonders an der Gliedmaße) |
1 veraltete Bezeichnung
Die Brust (Pectus) teilt man ein in:
• dorsalen Brustrücken (beim Pferd: Widerrist kranial hervortretend)
• Seitenbrustgegend
• Vorderbrust
• Unterbrust (Ventralfläche der Brust)
Den Bauch (Abdomen) gliedert man in drei hintereinander liegende Abschnitte:
• vordere Bauchgegend (kraniales Abdomen)
• mittlere Bauchgegend (mediales Abdomen)
• hintere Bauchgegend (kaudales Abdomen)

Abb. 2.1: Lage- und Richtungsbezeichnungen am Tierkörper (dorsale und kaudale Ansicht).

Abb. 2.2: Lage- und Richtungsbezeichnungen am Tierkörper (laterale Ansicht).
Das Becken (Pelvis) besteht aus der Kreuzgegend, seitlich anschließend der Gesäßgegend und der Hüfthöckergegend sowie kaudal der Aftergegend. Zwischen After und den äußeren Geschlechtsorganen erstreckt sich der Damm (Perineum), auch Mittelfleischgegend genannt. Kreuz- und Gesäßgegend bilden die Kruppe.
Der kaudale Ausläufer des Stammes ist der Schwanz (Cauda) mit seinem Ansatz (Schwanzwurzel) und der Schwanzspitze.
Man unterscheidet zwei Gliedmaßenpaare (Extremitäten):
• die Vorder- oder Schultergliedmaßen
• die Hinter- oder Beckengliedmaßen
An den Gliedmaßen unterscheidet man folgende gleichartige Abschnitte:
• der dem Rumpf eng verbundene Schulter-bzw. Beckengürtel
• die Gliedmaßensäule (bestehend aus Ober- und Unterarm, bzw. Ober- und Unterschenkel)
• die Gliedmaßenspitze
Die Gliedmaßenspitze besteht aus:
1. der Fußwurzel
• Vorderfußwurzel (Carpus)
• Hinterfußwurzel (Tarsus)
2. dem Mittelfuß (beim Pferd Röhrbein)
• vorderer M. (Metacarpus)
• hinterer M. (Metatarsus)
3. den Zehen (Digiti)
Die Zehen bestehen aus drei Gliedern (Phalanges):
• erstes Zehenglied (Phalanx I) – beim Pferd: Fesselbein
• zweites Zehenglied (Phalanx II) – beim Pferd: Kronbein
• drittes Zehenglied (Phalanx III) – beim Pferd: Hufbein; bei Wiederkäuer und Schwein: Klauenbein; beim Fleischfresser: Krallenbein
2.3.2 Organsysteme und Organe
Der Tierkörper lässt sich in einzelne Organe gliedern, wobei mehrere aufgrund ihrer Funktionen zu Organsystemen zusammengefasst werden. Organe sind Gewebs-/Zellverbände, die (funktionell und strukturell) eine Einheit bilden (Tab. 2.8).
Tabelle 2.8: Organsystem und Organe
| Organsystem | Organe | |
| Bewegungssystem | Skelettsystem | Knochen, Gelenke |
| Skelettmuskelsystem | Skelettmuskeln, Sehnen | |
| Eingeweidesystem | Geschlechtssystem | Hoden, Samenleiter, akzessorische Geschlechtsdrüsen, Penis |
| Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Scheide | ||
| Stoffwechselsystem | ||
| Atmungssystem | Nase, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Lunge | |
| Verdauungssystem | Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse (exokrines Pankreas), Leber | |
| Harnsystem | Nieren, harnableitende Wege | |
| Kreislauf- und Abwehrsystem | Blutgefäßsystem | Herz, Blutgefäße |
| lymphatisches System | Milz, Lymphknoten und -gefäße, Mandeln, rotes Knochenmark, Thymus, lymphatische Einrichtungen der Haut, des Atmungs-, Geschlechts- und Verdauungstraktes | |
| Steuerungs- und Regelsystem | Nervensystem | Zentrales Nervensystem (Gehirn und Rückenmark), peripheres Nervensystem vegetatives Nervensystem |
| endokrines System | Zirbeldrüse, Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Bauchspeicheldrüse (endokrines Pankreas), Nebennieren, Eierstöcke, Hoden | |
| Sinnesorgane | Augen, Ohren, Nase, Mundhöhle, äußere Haut | |
| Äußere Haut | äußere Haut inkl. Hautanhangsorgane (z. B. Zehenendorgane, Milchdrüse) | |
2.4 Umgang mit dem Klienten
2.4.1 Kommunikationsregeln
Mitunter ist die TFA, wenn sie am Anfang ihres Berufslebens steht, noch unsicher bei der Kommunikation mit Menschen, die zunächst fremd sind. Jeder kennt es: Selbst im persönlichen privaten Umfeld kommt es immer wieder zu Störungen und Konflikten, die auf Missverständnissen beruhen. Und jeder weiß, welch große Bedeutung wir alle den Äußerungen und Botschaften unserer Mitmenschen beimessen. Welche Botschaften wir empfangen, sagt uns, ob uns eine Person sympathisch ist, ob wir ihr vertrauen und welche Charaktereigenschaften sie wahrscheinlich hat. Umso wichtiger ist es, in einem Beruf, in dem man in Kontakt mit vielen verschiedenen, häufig fremden Menschen kommt, die eigene Kommunikation bewusster zu gestalten. Denn den Klienten einer Tierarztpraxis geht es selbstverständlich genauso wie uns selbst.
Äußerlich unterscheidet man zwei Formen der Kommunikation:
1. Verbale Kommunikation: Darunter versteht man die wörtliche Rede, also die Worte, die gesprochen/geschrieben werden.
2. Nonverbale Kommunikation: Hier sind alle Aspekte und Möglichkeiten gemeint, die die wörtliche Rede unterstützen.
Verbale Kommunikation
In der verbalen Kommunikation existieren – teilweise kulturell bedingte – Regeln, die die TFA, sofern sie sich noch nicht damit beschäftigt hat, beherzigen sollte, um nicht unhöflich oder unfreundlich zu wirken. Zu diesen Regeln gehören:
Zuhören. Es ist bisweilen nicht einfach und erfordert Erfahrung und Übung, den Klienten (oder Kollegen) so lange sprechen zu lassen, bis er sein Anliegen wirklich vorgebracht hat. Auf der anderen Seite ist es manchmal nötig, mit gezielten Fragen und weiter führenden Bemerkungen oder Anweisungen das Gespräch zu führen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Kommunikationsebenen erkennen und analysieren. Jeder ausgesprochene Satz hat auf verschiedenen Ebenen eine Bedeutung. Es gibt eine Sachebene, auf der nur die inhaltliche Bedeutung zählt. Beispiel: Der Klient sagt: »Ich habe um 17.00 Uhr einen anderen Termin.« Auf der Sachebene ist dies eine reine Information, nämlich dass der Klient zu einer bestimmten Zeit einen Termin hat. Da die TFA den Klienten nicht persönlich kennt und mit seinen Terminen nichts zu tun hat, ist diese Information für sie völlig unbedeutend. Auf der Beziehungsebene drückt der Satz vielleicht aus: »Ich mag Sie und möchte Ihnen keinen zusätzlichen Stress machen.« Auf der Prozessebene versucht der Klient, den Prozess des Tierarztbesuchs selbst mitzusteuern. Er meint möglicherweise: »Sorgen Sie dafür, dass ich früh genug mein Tier dem Tierarzt vorstellen kann, damit ich meinen Termin noch wahrnehmen kann.« Die Ebenen zu erkennen, ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Die Analyse ist immer eine persönliche Interpretation! Man kann in seiner Einschätzung, was die andere Person gemeint haben könnte, auch ganz falsch liegen. Nachfragen hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Auch die Analyse kann man trainieren. Man wird dabei feststellen, dass es fast immer verschiedene Möglichkeiten gibt, die Bedeutung der Worte auf der Beziehungsebene und der Prozessebene zu finden.
Wortwahl und Ausdrucksweise. Je authentischer man spricht, desto glaubwürdiger ist es. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man mit vielen Fremdwörtern und gezierter Sprache sein Gegenüber positiv beeindrucken würde. Jeder sollte im Berufs- wie auch im Privatleben seine persönliche Art zu sprechen bewahren. Dazu gehört allerdings auch, dass man sich seine Wortwahl und Ausdrucksweise bewusst macht und gegebenenfalls bestimmte Ausdrücke nicht benutzt.
Nonverbale Kommunikation
Paralinguistik fasst die Aspekte zusammen, die neben den Wörtern selbst die wörtliche Rede bestimmen. Dazu gehören Sprechtempo, Tonhöhe und Lautstärke. Alle drei können und sollten während des Sprechens variiert werden. Das gibt der Sprache neben dem Wort die persönliche Note. Achten Sie darauf, dass Ihre Paralinguistik Ihrem Wesen entspricht und nicht aufgesetzt wirkt. Beispiel: Man kann oft beobachten, dass Menschen in Dienstleistungsberufen künstlich hoch sprechen, um freundlich zu wirken. Freundlichkeit ist jedoch keine Äußerlichkeit, die man auf Knopfdruck hervorholen kann, sondern sie entspringt einem freundlichen Wesen und einer positiven Einstellung Menschen gegenüber! Seien Sie authentisch, und wenn Sie feststellen, dass Sie »von Natur aus« unfreundlich oder gelangweilt sind, arbeiten Sie an Ihrer inneren Haltung. Die nonverbale Kommunikation sollte im Einklang mit der verbalen Kommunikation stehen.
Körpersprache
Man erkennt und analysiert automatisch und oft unbewusst die nonverbale Kommunikation (Körpersprache) seines Gegenübers. Der Körpersprache wird in den allermeisten Fällen die größere Bedeutung beigemessen! Das bedeutet, dass bei widersprüchlichen Botschaften der wörtlichen Rede und der Körpersprache hauptsächlich die Botschaft der Körpersprache als die eigentliche Aussage wahr genommen wird. Unsere eigene Körpersprache ist uns viel weniger bewusst als unsere wörtliche Rede, und sie lässt sich auch weniger steuern, denn über die Körpersprache drücken wir das aus, was wir wirklich meinen – sie ist wahrhaftiger. Wer grundsätzlich das ausspricht, was er tatsächlich sagen möchte, ist in jedem Fall glaubwürdiger und wird eher ernst genommen als eine Person, die eine Aussage macht und diese gleichzeitig mit ihrer Körpersprache widerlegt. Beispiel: Ihr Chef steht mit verschränkten Armen und zusammengezogenen Augenbrauen dicht vor Ihnen, blickt Ihnen aber nicht ins Gesicht, sondern an Ihnen vorbei. Gleichzeitig sagt er: »Sie machen Ihre Arbeit sehr gut. Ich kann Sie richtig gut leiden.« Bestenfalls sind Sie nun verwirrt. Welche Aussage halten Sie für ehrlich?
Mimik. Darunter versteht man die Bewegungen des Gesichts und den Gesichtsausdruck. Beispiele: Lächeln, geöffnete/geschlossene Augen, Stirnrunzeln, geöffnete/geschlossene/zusammengepresste Lippen.
Blickkontakt. Der Blickkontakt zum Gesprächspartner sollte vorhanden sein, jedoch nicht in ein Anstarren oder Belauern ausarten. Wenn Sie mit einer Gruppe von Menschen reden, z. B. mit den Personen im Wartebereich der Praxis, sollten Sie abwechselnd mit allen Personen Augenkontakt aufnehmen. Tun Sie das in Ruhe und hetzen Sie nicht von einer Person zur anderen; dadurch würden Sie nervös und unsicher wirken.
Gestik. Die Gesten umfassen alle Bewegungen, insbesondere der Hände und Arme. Auch Veränderungen der Körperhaltung sind Gesten. Beispiele: Hände reiben, am Kopf kratzen, Arme verschränken, Hände in die Hüften stemmen, Ärmel aufkrempeln, Kopf senken, Beine kreuzen, Haarsträhne um den Finger wickeln, Zeigefinger heben.
Körperkontakt. Mit Berührungen muss man bei fremden Menschen sehr vorsichtig sein. Nicht jede Person möchte, dass man sie anfasst, um einer Aussage mehr Nachdruck zu verleihen. Auch in schwierigen Situationen, z. B. bei der Trauer um ein totes Tier, hilft es nicht allen Menschen, wenn sie tröstend am Arm berührt oder gedrückt werden. Es kommt natürlich auch vor, dass Menschen aus Ihrer Umgebung Sie anfassen, sei es in Form eines Schulterklopfens, einer Umarmung oder eines Schiebens in eine bestimmte Richtung. Sollte Ihnen solch ein Körperkontakt unangenehm sein, sprechen Sie Ihr Unbehagen aus. Die andere Person weiß vielleicht nicht, dass es Ihnen unangenehm ist und meint, dass sie dadurch leutselig und aufgeschlossen wirkt.
Körpernähe/-distanz. Jeder Mensch hat seine eigene Grenze, ab der es ihm unangenehm ist, wenn eine andere Person sie überschreitet. Dabei spielt es eine große Rolle, wie nahe stehend die Person ist. Fremde Menschen dürfen normalerweise weniger nah an uns herantreten als Freunde oder Verwandte. Testen Sie aus, wie nah fremde Menschen Ihnen kommen können, ohne dass Sie sich unwohl oder bedrängt fühlen und sorgen Sie selbst dafür, dass Ihre Mitmenschen die Grenze nicht überschreiten, notfalls mit einem Schritt zurück. Ihr Gegenüber wird diesen Schritt wahrnehmen und ihn respektieren. Tut er das nicht, sprechen Sie ihn darauf an und bitten Sie ihn darum. Umgekehrt sollten auch Sie die Grenze Ihres Gegenübers achten. Zahlreiche Redewendungen legen Zeugnis über diesen Umstand ab; sie sind sehr aussagekräftig. Beispiele: Eine nahe stehende Person; jemandem zu nahe treten; mit einem Anliegen an jemanden herantreten.
Sich dieser Aspekte bewusst zu werden, ist schon der erste Schritt in Richtung einer kompetenten Kommunikation. Die Theorie allein reicht aber nicht aus. Man muss üben, um immer besser zu werden. Im privaten und vertrauensvollen Umfeld sollte man um Rückmeldung bitten, welchen Eindruck die eigene Art zu kommunizieren bei anderen Menschen hinterlässt. Oft ist man verblüfft, wie sehr sich die Selbstwahrnehmung von der Fremdwahrnehmung unterscheidet. Um seine eigene Persönlichkeitsentwicklung positiv zu beeinflussen, ist dieser Blick von »außen« enorm wichtig. Unbewusste verbale und nonverbale Kommunikationsformen schleichen sich als Angewohnheiten ein. Diese kann man sich jedoch auch gezielt wieder abgewöhnen!
Kommunikationsstörungen sind in den meisten Fällen Missverständnisse. Diese Missverständnisse treten auf allen Ebenen der Kommunikation auf. Die TFA muss sehr viel mit Menschen kommunizieren, und Missverständnisse stören den reibungslosen Praxisalltag. Zudem tragen sie zu Missgestimmtheit, Stress und Unwohlsein aller Beteiligten bei.
Einige Kommunikationsregeln
Es gibt einige recht einfach auszuführende Verhaltensregeln, die helfen, Missverständnisse zu vermeiden:
Aktives Zuhören. Wenn ein Klient (oder Kollege, Vorgesetzter) etwas berichtet, ein Anliegen vorbringt oder ähnliches, hören Sie zu und vergewissern Sie sich direkt durch Nachfragen, ob Sie alles richtig verstanden haben. Beispiele: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie, dass …; Sie wollen also sagen, dass …; Habe ich das richtig verstanden, dass Ich wiederhole noch einmal, um sicher zu gehen, dass ich alles richtig verstanden habe.
W-Fragen. Stellen Sie an den Anfang Ihrer Frage ein Fragewort. So fällt es Ihrem Gegenüber leichter, eine konkrete Aussage zu machen. Beispiele: Wie lange ist die Katze schon krank? Wann kann ich nächsten Dienstag Feierabend machen? Was genau meinen Sie damit? Welches Desinfektionsmittel muss ich dafür verwenden?
Ich-Botschaften. Eine Ich-Botschaft verknüpft ein bestimmtes Verhalten des Gegenübers oder gegebene Umstände mit einem eigenen Gefühl. Wesentlich dabei ist, Vorwürfe und Unterstellungen zu vermeiden. Besonders in Konfliktsituationen ist eine Ich-Botschaft wesentlich konstruktiver als z. B. ein Vorwurf. Man demonstriert damit, dass man bereit ist, sich selbst bis zu einem gewissen Grad einzubringen und zu offenbaren, und signalisiert gleichzeitig, dass man die andere Person nicht beschuldigt. Man sollte allerdings mit Ich-Botschaften nicht zu verschwenderisch sein. Dabei besteht die Gefahr, dass man mehr von sich preisgibt als beabsichtigt und Mitmenschen sich mehr anhören müssen als sie möchten. Beispiele: Ich bin etwas nervös, wenn Sie so dicht bei mir stehen. Ich fühle mich verunsichert, wenn Sie mir keine Rückmeldung über meine geleistete Arbeit geben. Wenn Sie so viele Fragen stellen, behindert mich das in meiner Arbeit. Ich bin heute besonders glücklich, weil ich zum Geburtstag eine Reise geschenkt bekommen habe. Ich habe mich zu Unrecht beschuldigt gefühlt, als Sie mich für die Panne im Labor verantwortlich gemacht haben.
Schweigepflicht
Die TFA unterliegt der beruflichen Schweigepflicht; d. h., sie hat gegenüber praxisfremden Personen Stillschweigen in Bezug auf Tierbesitzer und Patient zu bewahren.
Schweigepflicht und Zeugnisverweigerungsrecht des Tierarztes und seiner Hilfskräfte
Nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch (StGB) macht sich derjenige Tierarzt strafbar, der unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum Lebensbereich oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm anvertraut worden ist oder sonst bekannt geworden ist. Damit gehört die Wahrung des Berufsgeheimnisses zu den zentralen Fragen der Ausübung tierärztlicher Tätigkeit. Das Vertrauen darauf, dass alles, was im Rahmen einer tierärztlichen Behandlung dem Tierarzt anvertraut oder bekannt wird, auch vertraulich bleibt, ist Voraussetzung einer wirksamen Behandlung im Verhältnis Tierarzt-Tierhalter.
Nach § 203 Abs. 3 StGB gilt dieses Schweigegebot gleichermaßen auch für das tierärztliche Hilfspersonal und für in der Berufsausbildung Stehende.
2.4.2 Kommunikation mit Tierbesitzern
Meistens nimmt die TFA den ersten Kontakt mit den Tierbesitzern auf, sowohl an der Pforte als auch am Telefon. Aus Sorge um ihr Tier haben Besitzer oft das Bedürfnis, sich sofort ausführlich der TFA mitzuteilen.
Sie befinden sich manchmal sogar in einem »psychischen Ausnahmezustand«, d. h. sie sind in großer Anspannung, überbewerten harmlose Äußerungen Dritter oder dramatisieren die Situation. Die TFA kann dann versuchen, mit Geduld, Höflichkeit und Freundlichkeit das Gespräch auf die notwendigen Angaben zur Aufnahme der Personalien und zu Fragen des Vorberichtes zu lenken.  2.1
2.1
Beides wird möglichst nicht im Beisein Dritter aufgenommen. Es gibt Tierbesitzer, die sich einer gewissen Schuld an der Erkrankung des Tieres bewusst sind und im Beisein anderer Personen anamnestische Daten und Fakten nicht bekannt geben wollen, obgleich diese Daten für den Tierarzt sehr wichtig wären.
Die TFA ist nicht berechtigt, irgendwelche Kritik oder Bewertung einer bisher durchgeführten Behandlung zu äußern oder nach dem Namen des vorbehandelnden Tierarztes zu fragen. Nie sollte die TFA Ungeduld oder Zeitdruck, unter dem sie stehen kann, zu erkennen geben. Diskussionen über die Dringlichkeit eines Falles (notfalls muss der Tierarzt eingeschaltet werden) sind genauso zu vermeiden wie Erziehungsversuche am Tierbesitzer. Der Umgang wird umso leichter, je beruhigender die TFA auf den Tierbesitzer einwirken kann.
Tiere, die zur Untersuchung gebracht werden, sollten außerhalb des Praxisraumes und ohne Weisung des Tierarztes noch nicht angefasst werden. Eine Ausnahme stellen nur die Notfälle dar, die ohnehin vorrangig behandelt werden müssen.
Telefonische Auskünfte können von der TFA unaufgefordert erteilt werden, soweit sie die Zeiten der Sprechstunde oder Anmeldungen betreffen. Terminabsprachen richten sich nach dem Bestellsystem der Praxis. Für alle anderen Auskünfte muss Rücksprache mit dem Tierarzt geführt werden. Er genehmigt die Bekanntgabe von Diagnosen, Untersuchungsergebnissen, Behandlungserfolgen und Entlassungsterminen von stationären Patienten. Medizinische Ratschläge und Verdachtsdiagnosen dürfen nicht erteilt werden. Auch kann die TFA selbstständig nicht beurteilen, ob ein vom Tierbesitzer als dringend bezeichneter »Fall« außerhalb der Sprechstunde behandelt werden muss oder warten kann.
Die Wartezeiten vor dem Sprechzimmer der Praxis können lang sein. Deshalb sollten alle Tierbesitzer und Begleitpersonen im Wartezimmer eine Sitzgelegenheit finden. Auch für kurzweilige Lektüre muss gesorgt werden; denn nicht jeder Tierhalter sucht das Gespräch mit seinem ebenfalls wartenden Nachbarn. Ein ausreichender Abstand zwischen den Stühlen ist günstig, damit es nicht zu Beißereien der Tiere untereinander kommt. Kläffende Hunde sollten, bis sie »an der Reihe sind«, außerhalb des allgemeinen Wartezimmers bleiben.
2.4.3 Erste Hilfe am Menschen
Bei großem Andrang, verbrauchter Luft und Unruhe unter den Tieren im Wartezimmer kann es zu Unpässlichkeit, Ohnmacht oder gar Bissverletzung eines Tierbesitzers kommen. Hier ist die TFA zur »Ersten Hilfe« aufgefordert. Die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs vor Beginn der Berufsausübung ist eine wünschenswerte Voraussetzung.
Bereitstellung für die »Erste Hilfe« am Menschen:
• Rufnummer der Rettungsleitstelle oder des Notarztes
• Notliege mit Decke
• verfügbares Beatmungsgerät
• sauberes Wasserglas
• Verbandsmaterial
Bei Unpässlichkeit genügt es meistens, wenn für ausreichend frische Luft gesorgt wird. Bei Ohnmachtsanfällen wird die Person auf eine Notliege – mit hochgestelltem Fußteil – gelegt und zugedeckt. Liegt jedoch ein Schockzustand mit ausgeprägter Blässe der Haut, Schweißausbruch und schneller Atmung vor, muss neben der Lagerung auf der Notliege oder in »stabiler Seitenlage« sofort der Notarzt gerufen werden.
Dem Patienten darf in keinem Fall, auch nicht bei leichten Kopfschmerzen, ein in der Praxis verfügbares Medikament angeboten oder verabreicht werden, auch nicht auf Bitten des Patienten. Die Ohnmacht oder Unpässlichkeit könnte mit einer schweren Krankheit zusammenhängen und durch die Situation im Wartezimmer ausgelöst worden sein. Eingenommene Medikamente könnten hier schlimme Folgen haben.
2.5 Umgang mit den Tieren in der Praxis
2.5.1 Tierverhalten
Im Umgang mit Tierpatienten muss die TFA die tierartlichen Unterschiede im Verhalten der Patienten kennen, um einerseits dem Tier gerecht zu werden und ihm den Tierarztbesuch nicht unnötig zu erschweren und andererseits Gefahren und Zwischenfälle, die auf eigenes Fehlverhalten dem Tier gegenüber zurückzuführen sind, zu vermeiden.
Hunde sind Rudeltiere und versuchen in neuen Situationen und im Umgang mit fremden Menschen oder Tieren, den eigenen Platz in der Rangordnung zu erkunden. Sie müssen in der Praxis (wie auch in der Familie) ihren Platz auf der untersten Stufe der Rangordnung erkennen können und respektieren. Das bedeutet, dass der Hund keine Unterstützung und Belobigungen bei offensichtlichem Fehlverhalten erhalten darf. Leckerli zur Beruhigung und Vertrauensbildung sind nur sinnvoll, wenn der Hund aus Angst und Aufregung versucht, wegzulaufen oder sich zu verkriechen. Bei Aggressivität ist anzuraten, der Situation entsprechende Fixierungsmaßnahmen zu ergreifen, um sowohl das Praxisteam als auch den Klienten vor Bissen zu schützen. Jegliche Zwangsmaßnahmen sollten ausreichend, aber nicht übertrieben sein. Bei unangemessen zwanghafter Behandlung erreicht man nur, dass der Hund sich bedrängt und verängstigt fühlt, was seine Aggressivität noch steigern kann. Auch Hunde haben eine Körpersprache, die die TFA deuten können muss. Kommt der Hund mit erhobener wedelnder Rute ohne jegliche Drohgebärde auf einen Menschen zu oder schnüffelt er interessiert an Gegenständen (z. B. an Kleidungsstücken), ist es unwahrscheinlich, dass er verängstigt oder aggressiv ist. Drohgebärden sind z. B. Zähnefletschen, Sträuben der Nacken- und Rückenhaare, Kopfsenken und Knurren. Die zwischen die Hinterbeine geklemmte Rute, das Zurückweichen und das Ducken sind Zeichen für Angst. Als Reaktion auf die Angst werden viele Hunde auch aggressiv. Sie rechnen damit, sich verteidigen zu müssen. Solche Anzeichen müssen unbedingt ernst genommen und geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Hunde mögen hohe Stimmen. Hektisches Reden kann sie allerdings nervös machen. Bei strengen Befehlen kann man zur Unterstützung des Ernstes die Stimmlage senken. Hunde beißen reflektorisch bei Schmerzen, und zwar in die Richtung, aus der die Schmerzen kommen. Bei unangenehmen oder schmerzhaften Untersuchungen und Behandlungen muss die TFA auf jeden Fall mit einem solchen Verhalten rechnen. Dieses Beißen ist kein Anzeichen von Aggressivität, sondern ein Reflex. Dieser Reflex ist Teil des normalen instinktiven Verhaltens und stellt keinen Ungehorsam dar. Viele Hundebesitzer wissen das nicht und versichern, ihr Hund würde niemals beißen. Lassen Sie sich nicht beirren und treffen Sie bei jedem Hund sinnvolle und angemessene Vorsichtsmaßnahmen!
Katzen sind ausgesprochen schnell und wendig und häufig sehr misstrauisch fremden Menschen gegenüber. Um eine Katze an der Flucht zu hindern und sie möglichst wenig zu verängstigen, sollte sie immer im Transportkäfig zum Tierarzt gebracht werden. Katzen ziehen sich gern in eine Art Höhle zurück, in der sie sich sicher fühlen. Viele Katzen reagieren sehr aggressiv, wenn man sie gegen ihren Willen anfasst und ungewohnten oder gar schmerzhaften Behandlungen unterzieht. Verängstigte Katzen haben weit geöffnete Augen mit ebenfalls weit gestellter Pupille. Das gilt auch für aggressive Katzen. Da Angst und Aggression häufig gleichzeitig auftreten, ist es wichtig, auf Anzeichen von Aggressivität zu achten. Solche Anzeichen sind, z. B. Knurren, peitschende Bewegungen des Schwanzes, Fauchen. Die Abwehrbewegungen einer Katze (Beißen, Kratzen, sich Winden) sind sehr schwer zu handhaben und erfordern neben der richtigen Technik auch viel Erfahrung.
Pferde sind Fluchttiere, die auf ungewohnte oder beängstigende Situationen oft scheu und abwehrend reagieren. Da sie ihrem natürlichen Trieb zu flüchten nicht folgen können, ist es notwendig, mit Pferden besonders beruhigend und freundlich umzugehen, um sie nicht zusätzlich zu erschrecken. Abwehrverhalten von Pferden (Beißen, Ausschlagen) kann unter Umständen für den Menschen gefährlich werden. Deshalb sollte man immer mit einem solchen Verhalten rechnen. Für die tierärztliche Untersuchung und Behandlung sollte ein Pferd grundsätzlich aufgezäumt sein. Plötzliche Bewegungen und Unruhe außerhalb des Gesichtsfeldes des Pferdes sollten vermieden werden, ebenso wie zu lautes und aggressives Sprechen. Ein kurzfristig lauter und energischer Tonfall ist bei widersetzlichen Pferden oft hilfreich. Dieses Mittel sollte allerdings nicht überstrapaziert werden, da die Pferde sonst dem gegenüber abstumpfen und immer ungehorsamer werden. Lässt sich ein Pferd nur mit massiven Zwangsmaßnahmen bändigen und untersuchen bzw. behandeln, ist es sinnvoll, den Tierhalter auf Möglichkeiten des Trainings dieser Situationen hinzuweisen. Da Pferde auch Gewohnheitstiere sind, ist diese Art der Vorbereitung durch den Tierhalter hilfreich.
Rinder reagieren weniger offensichtlich auf den Tierarzt. Sie sind im Wesen eher ruhig und geduldig, können bei unerwünschten Behandlungen aber auch abwehrend reagieren. Abwehrverhalten von Rindern ist Stoßen/Schlagen mit dem Kopf, Wegdrücken der behandelnden Person mit dem Körper, Austreten (nach allen Richtungen!) und Vorwärtsdrängen. Deshalb müssen Rinder gut und sicher fixiert werden. Schmerzäußerungen von Rindern wie Stöhnen oder Brüllen hört man erst bei großen Schmerzen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie vorher keine Schmerzen spüren! Besondere Vorsicht ist bei der Behandlung von Bullen (Stieren) geboten. Sie verfügen über ein enormes Kraft- und Aggressionspotenzial und können es auch – manchmal unverhofft – einsetzen.
Vögel reagieren je nach Art und Situation mit Flucht oder Aggression auf die Behandlung. Grundsätzlich ist es beruhigend für einen Vogel, wenn die Beleuchtung nicht zu intensiv ist. Ruhige Bewegungen und wenig Geräuschkulisse helfen, den Vogel zu beruhigen. Vergessen Sie niemals, die Fenster und Türen zu schließen, wenn ein (flugfähiger) Vogel behandelt wird! Das Abwehrverhalten von Vögeln umfasst hauptsächlich Picken/Beißen und Flügelschlagen. Eine Fixiertechnik für Vögel ist der Zangengriff (Daumen und Mittelfinger umschließen den Unterkiefer, die andere Hand umfasst Flügel, Schwanz und Ständer; kleine Vögel fixiert man einhändig, indem der Vogel mit dem Rücken in der Handfläche liegt und die freien Finger zusätzlich Ständer, Schwanz und Flügel umfassen). Greifvögel haben sehr scharfe Krallen, die sie auch einsetzen. Sie müssen bei diesen Tieren immer besonders fixiert werden.
2.5.2 Verhalten mit Tieren in der Praxis
Kein Tier wird ohne Zustimmung des Besitzers oder Aufforderung durch den Tierarzt entgegengenommen oder angefasst. Eine Befragung des Tierbesitzers nach dem Verhalten des Tieres fremden Personen gegenüber ist angebracht.
Wichtig ist, auf die Körperhaltung, Mimik und mögliche Lautäußerungen des Tieres zu achten. Besonders bei Hund und Katze kennen wir die unterschiedlichen Verhaltensweisen, die instinkt- oder anlagebedingt oder auch erworben sind (Ängstlichkeit, Nervosität, Schreckhaftigkeit, Aggressivität) und die sich als »Sprache« des Tieres äußern können.
Beim ersten Kennenlernen des Patienten sollte die Helferin das Tier ruhig, mit leiser Stimme ansprechen und sich ihm nur mit gemäßigten Schritten nähern. Nicht gleich die Hand ausstrecken, damit Drohgebärden und Abwehrhaltung vermieden werden. Günstiger ist es, sich etwas Zeit zu nehmen und durch gutes Zureden das Tier umzustimmen. Ist der erste Körperkontakt durch Streicheln des Tieres hergestellt, lassen sich weitere Vorbereitungen für die anstehenden Untersuchungen vornehmen.
Nichthaustiere, wie Zootiere und exotische Tiere, lässt man am besten vom Überbringer aus dem Transportbehältnis entnehmen und während der Untersuchung und Behandlung festhalten.
Bei den Kleinsäugern – Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Ratte, Maus – ist die Handhabung deshalb einfacher, weil sie als sog. Streicheltiere die menschliche Hand gewohnt sind.
2.5.3 Unfallgefahren beim Umgang mit Tieren
Situationen, die für das Tier ungewohnt sind, können Angst und Abwehrreaktionen auslösen. Beim Umgang mit Tieren ist es deshalb notwendig zu wissen, wie sich die verschiedenen Tierarten in abweichenden, für sie angstvollen Situationen verhalten. Gute Beobachtung des einzelnen Tieres, eigenes achtsames Verhalten und gegebenenfalls vorbeugende Maßnahmen (Fixierungsmaßnahmen) sind notwendig, um Gefahrenmomente zu erkennen und Unfälle zu vermeiden.
Rinder können treten, ausschlagen und Hornstöße versetzen.
Pferde sind Fluchttiere, die bei Angst, Erschrecken oder Schmerz sofort flüchten möchten. Die heftigen Bewegungen und ein mögliches Ausschlagen nach hinten sind dabei eine Gefahr für die umstehenden Menschen. Weitere Abwehrbewegungen beim Pferd sind das Kopfschlagen und der Huftritt.

Abb. 2.5: Blutentnahme beim Hund.

Abb. 2.6: Fixierung der Katze zur Palpation des Abdomens.

Abb. 2.7: Halten eines Kaninchens.

Abb. 2.8: Aufheben der Vordergliedmaße beim Pferd.

Abb. 2.9: Fixierung der Oberlippe zur Endoskopie.
Schweine, besonders Eber, können beißen. Auch ferkelführende Muttersauen beißen gelegentlich.
Bei den Großtieren sind stets eine vorsichtige Annäherung von vorn, beim Eber von hinten, und ein Ansprechen mit kräftiger Stimme erforderlich.
2.5.4 Methoden der Fixierung (Abb. 2.4–2.9)
• Aufheben einer Vordergliedmaße beim Pferd, Ansetzen der Oberlippenbremse (auch Nasenbremse genannt)
• Fixieren des Kopfes bei den Wiederkäuern, Ansetzen der Rinderbremse oder der Schlagfessel
• Anlegen der Schlingendrahtbremse beim Schwein
• Zubinden der Schnauze beim Hund
• Verwendung des »Katzentuches« bei der Katze
• Ergreifen der Füße beim Greifvogel
• Ergreifen des Kopfes bei Vögeln
• Fassen des Nackenfelles bei kleinen Nagetieren
Im Allgemeinen wird vor allem die Erfahrung im Umgang mit Tieren die Fähigkeit zur Fixierung ermöglichen. Je sicherer und dabei schonend das Tier während der Untersuchung und Behandlung gehalten wird, desto ruhiger ist es. Der Tierarzt kann leichter arbeiten und der Besitzer ist dankbar für den guten Umgang mit seinem Tier.
2.5.5 Vorbereitung zur Untersuchung und Behandlung
Bereits vor der eigentlichen Untersuchung des Patienten können von der TFA einige vorbereitende Arbeiten erledigt werden:
• Erstgespräch mit dem Tierbesitzer an der »Rezeption«
• Aufnahme eines allgemeinen Vorberichtes
• erstes Ansprechen, evtl. Kontaktnahme mit dem Patienten
• Zwischengespräch mit dem Tierarzt, um erste Informationen zu erhalten, besonders bei dringenden Fällen
Wird der Tierbesitzer samt Patient ins Behandlungszimmer gebeten, sind die Anweisungen des Tierarztes abzuwarten. Während seines Gesprächs mit dem Tierbesitzer kann die TFA evtl. das Körpergewicht und die Körperinnentemperatur des Tieres ermitteln und weiterhin beruhigend auf das Tier einwirken.
Bereitlegen der Instrumente für die Untersuchung
Die Zusammenstellung der Utensilien kann in den einzelnen tierärztlichen Praxen variieren. Teilweise sind die Instrumente, die besonders häufig benötigt werden, auf einem fahrbaren Tischchen sofort greifbar. Dazu gehören, z. B. die Instrumente für die Augenuntersuchung, Untersuchung des äußeren Ohres oder auch die Instrumente für die Zahnsanierung.
Vorbereitung zur Blutentnahme
Für die meisten Untersuchungen im Labor ist Venenblut erforderlich. Dazu muss eine gut zugängliche Vene für die Punktion vorbereitet werden (Abb. 2.10).
Zum Auffangen des Blutes müssen die verschiedenen Probenröhrchen bereitgestellt werden, z. B. zur Plasmagewinnung, Serumgewinnung, Hämatokritbestimmung, Blutsenkung.  13.5.2 Hämatologische Untersuchungen
13.5.2 Hämatologische Untersuchungen
Vorbereitung zur Behandlung
Schließt sich an die Blutentnahme die intravenöse Applikation von Medikamenten an, so wird statt der gewöhnlichen Punktionskanüle eine sog. Venenverweilkanüle benutzt (Abb. 2.11). Diese ist vor allem für die Infusionen, die sich teilweise über Stunden erstrecken können, unerlässlich.

Abb. 2.11: In die Vene eingeführte Verweilkanüle.
Vorbereitung zur Infusion
Zuerst müssen alle zur Venenpunktion notwendigen Gegenstände bereitgelegt werden (Schere oder Schermaschine, Alkoholtupfer, Staugummi, Venenverweilkanüle, Klebeband) und dann das Infektionsbesteck, die Infusionslösung und der Infusionsständer) (Abb. 2.12).

Abb. 2.12: Infusionsvorbereitung.
Die Füllung des Infusionsbestecks mit der gewählten Infusionslösung muss vor der Venenpunktion erledigt sein. Der Anschlusskonus des Schlauches für die Verweilkanüle muss bis dahin durch die Kunststoffkappe geschützt bleiben. Ebenso muss der Mandrin der Kanüle bis zum Ende der Infusion in der Schutzkappe aufbewahrt bleiben.
Vorbereitung zur Injektion
Medikamente, die injiziert werden sollen, müssen in entsprechende Spritzen aufgezogen werden. Größere Arzneimittelmengen können ohne aufgesetzte Kanüle der Ampulle oder Vorratsflasche entnommen werden, sehr kleine Mengen (z. B. 0,05–0,1 ml) müssen stets mit aufgesetzter Kanüle aufgezogen werden, um die genau errechnete Dosis des Mittels einhalten zu können. Luft in der Spritze wird ausgedrückt und der Flüssigkeitsspiegel bis zur Kanülenspitze hergestellt. Bis zur Injektion bleibt die Schutzkappe auf der Kanüle.
Mehrere vorbereitete Spritzen bis zur Injektion neben der entleerten Ampulle oder der Vorratsflasche liegen lassen, um Verwechslungen bei unterschiedlichen Applikationsarten zu vermeiden.
2.6 Klinische Untersuchung
Mit Diagnostik sind die Methoden und Maßnahmen gemeint, die der Tierarzt anwenden muss, um zu einer Diagnose, d. h. Erkennung einer bestimmten Krankheit, kommen zu können. Hierzu gehört auch die Kenntnis der Umwelt des Tieres, die Haltungs- und Fütterungsbedingungen, die Stallungs- und klimatischen Verhältnisse. Durch Befragung des Tierbesitzers sind möglicherweise bereits vor Beginn der Untersuchung Hinweise auf die Ursache oder auf die Krankheit unterhaltende Faktoren gegeben.
Wichtige Begriffe bei der klinischen Untersuchung
| Anamnese | Vorbericht |
| Diagnostik | Methoden zur Krankheitserkennung |
| Propädeutik | Einweisung in die Methoden der klinischen Untersuchung |
| Adspektion | Besichtigung der Körperoberfläche und der natürlichen Körperöffnungen |
| Palpation | Betasten des Körpers |
| Perkussion | Beklopfen von luft- oder gashaltigen Organen |
| Auskultation | Abhorchen von Organen, die Geräusche erzeugen, z. B. Herz, Lunge, Darm |
| Plessimeter | Rechteckige und spatelförmig gebogene Klopfunterlage zur Perkussion |
| Phonendoskop, Stethoskop | Hörrohr zur Auskultation |
| Kachexie | Auszehrung, Kräfteverfall, Abbau der Fettdepots |
| Adipositas | Fettleibigkeit |
| Exsikkose | Austrocknung durch Flüssigkeitsverminderung des Körpers |
| Anämie | Blutarmut |
| Hyperämie | verstärkte Durchblutung |
| Zyanose | bläuliche Verfärbung von Haut und Schleimhaut infolge Sauerstoffmangels |
| Ikterus | Gelbfärbung von Haut und Schleimhaut |
| Tachykardie | beschleunigte Herzaktion |
| Bradykardie | verminderte Herzaktion |
| Tachypnoe | beschleunigte Atmung |
| Bradypnoe | verminderte Atmung |
| Dyspnoe | Atembeschwerde, Atemnot |
2.6.1 Allgemeinuntersuchung
Nach Erhebung des Vorberichtes beginnt die Beurteilung des Allgemeinzustandes des Tieres:
• Ermittlung seines Verhaltens
• Ernährungs- und Pflegezustand
• Untersuchung der Schleimhäute
• Messen der rektalen Körpertemperatur
• Pulsnahme
• Überprüfung der Atmung
Verhalten des Tieres
Jedes gesunde Tier zeigt ein seiner Art, seinem Alter und Temperament entsprechendes physiologisches Verhalten. Lässt der Tierarzt äußere Reize (Anrufen, Berühren, Aufzäumen oder Auftreiben) auf das Tier einwirken, so kann er aus den Reaktionen Rückschlüsse auf eine Erkrankung der verschiedenen Organsysteme ziehen.
Ein krankhaftes Verhalten zeigen die Tiere, die z. B. matt, teilnahmslos, apathisch oder sogar bewusstlos sind (Koma). Das Verhalten kann aber auch gegenteilig sein, was sich in Schreckhaftigkeit, Unruhe, evtl. Aggressivität oder größerem Fluchtverlangen zeigt.

Abb. 2.13 Bildtafel Schleimhäute. (a) normale Mundschleimhaut (Pferd), (b) hyperämische Mundschleimhaut mit erweiterten Venen im Schock (Pferd), (c) anämische Konjunktivalschleimhaut (Hund), (d) ikterische Verfärbung der Sklera (Pferd).
Ernährungs- und Pflegezustand
Durch Besichtigen und Betasten der Körperoberfläche wird festgestellt, ob der Patient in gutem Ernährungszustand ist. Besonders im Bereich der Rippen, Lendenwirbel und Hüfthöcker kann es zu einer Bildung von Fettpolstern oder umgekehrt zu einem deutlichen Hervortreten der Knochenanteile kommen. Ist der Ernährungszustand extrem stark verändert, spricht man entweder von
• Adipositas (übermäßige Fettansammlung, Fettleibigkeit) oder
• Kachexie (Auszehrung, Abbau der Fettdepots).
Bei der Beurteilung des Pflegezustandes werden Haarkleid, Haut und Hornteile untersucht. Bei vielen Haustieren (Katzen, Nagetieren, Kaninchen und Vögeln) findet eine Selbstpflege von Fell und Gefieder statt. Bei den anderen Tieren (Großtiere und Hunde) ist die Pflege durch den Tierhalter notwendig. Infolge fehlender Pflege verfilzt das Haarkleid, verliert seinen Glanz und das Krallen- oder Hufhorn wird zu lang und kann Hornspalten aufweisen.
Untersuchung der Schleimhäute
Durch die Darstellung der Lidbindehaut, Mundschleimhaut, beim Großtier auch Nasenschleimhaut, kann eine schnelle und grobe Orientierung über mögliche Schädigungen innerer Organe gewonnen werden: Die Farbe der Schleimhaut ist Ausdruck der Durchblutung, abhängig von der durchströmenden Blutmenge und deren Gehalt an Erythrozyten bzw. Hämoglobin. Normalerweise ist die Schleimhaut blassrosa bis rosarot (Abb. 2.13).
Bei verschiedenen Organerkrankungen kann es zu Farbabweichungen kommen:
• hyperämisch: rot; stärkere Durchblutung (z. B. infolge Entzündung)
• anämisch: blass; infolge Durchblutungsstörung (durch Kreislaufschwäche) oder Blutarmut
• ikterisch: gelb; infolge Anhäufung von Gallenfarbstoffen
• zyanotisch: bläulich; durch hohen Anteil an sauerstoffarmen Hämoglobin
• verwaschen-rot: schmutzig rot; wenn es zum Plasmaaustritt aus den Kapillaren gekommen ist.
Die Kapillarfüllungszeit liefert einen wichtigen diagnostischen Hinweis bei der Beurteilung der Kreislaufperipherie.
Zur Prüfung stülpt man die Oberlippe um und erzeugt durch einen mäßigen Fingerdruck auf die Maulschleimhaut oberhalb der Schneidezähne eine kurzzeitige Anämie. Im physiologischen Zustand strömt innerhalb von ein bis zwei Sekunden das Blut wieder in die Kapillaren zurück und die Schleimhaut erhält ihre ursprüngliche Farbe.
Bei Durchblutungsstörungen, insbesondere bei Kreislaufschwäche und Schock, ist die Kapillarfüllungszeit verlängert.
Messen der Körpertemperatur
Die Körpertemperatur ist abhängig von der Durchblutung und der Wärmeproduktion des Organismus. Bei stärkerer Durchblutung, z. B. bei Arbeitsleistung, steigt die Temperatur vorübergehend an. Die physiologischen Werte der einzelnen Haustierarten (Tab. 14.1) schwanken nach Alter und Rasse.
Die Messung der Körperinnentemperatur wird beim Tier ausschließlich rektal vorgenommen. Man verwendet dazu die herkömmlichen Quecksilberthermometer. In letzter Zeit jedoch bewähren sich – vor allem bei den Kleinstsäugern und unruhigen Kleintieren – die elektronischen Thermometer mit Digitalanzeige. Sie haben den Vorteil, dass sie nicht zerbrechen können und genau das Ende der Messdauer anzeigen (Abb. 2.14).
Von einer »Temperaturerhöhung« oder subfebrilen Temperatur wird gesprochen, wenn die obere physiologische Grenze um einige Zehntel Grad überschritten wird. Eine weitere Temperatursteigerung ist als Fieber zu bezeichnen. Fieber entsteht durch Störung des Wärmeregulationszentrums im Gehirn, ausgelöst z. B. durch Bakterien oder Viren.
Pulsnahme
Durch die Untersuchung der Druckwelle in den Arterien (Puls) erhält man einen gewissen Einblick in den Zustand des Kreislaufs und in die Schnelligkeit und Regelmäßigkeit der Herzschlagfolge.
Die Pulsuntersuchung dient somit der Erkennung und Beurteilung von organischen Störungen der Kreislauftätigkeit und von Krankheiten, bei denen der Blutkreislauf nur funktionell beteiligt ist.
Die Pulsnahme erfolgt beim Großtier (Pferd, Rind) an der Innenfläche des Unterkiefers an der Gesichtsarterie (Arteria facialis). Beim Kleintier (Hund, Katze) wird der Puls an der Oberschenkelarterie (Arteria femoralis), die an der Schenkelinnenfläche verläuft, gefühlt. Eine Pulsation ist aber häufig auch anderen oberflächlich verlaufenden Arterien des Körpers festzustellen.
Zur Pulsbetastung werden die Fingerbeeren von Zeige-, mittel- und Ringfinger unter leichtem Druck der Arterie fühlend angelegt. Zur Ermittlung der Häufigkeit des Pulses pro Minute (Frequenz) wird die Anzahl der Pulsschläge in 15 oder 30 Sekunden gezählt und das Ergebnis mit 4 bzw. 2 multipliziert.
Bei unruhigen, ängstlichen oder reizbaren Tieren sollte die Pulsuntersuchung erst nach einer Beruhigung durch Streicheln, Zureden oder Darreichung von etwas Futter erfolgen.
Ein beschleunigter Puls (Pulsus frequens, Tachykardie) ist physiologisch nach Aufregung, Arbeit und gegen Ende der Trächtigkeit. Er findet sich regelmäßig bei Fieber, akuten Infektionskrankheiten, vielen Vergiftungen, Herzschwäche, Blutverlusten, im Schock und bei starken Schmerzzuständen des Körpers, z. B. Koliken.

Abb. 2.14: Fieberthermometer.
Ein verlangsamter Puls (Pulsus rarus, Bradykardie) entsteht im Zusammenhang mit Erregung des Parasympathikus (Vagus) und bei bestimmten Vergiftungen.
Die normalen Pulsfrequenzen der Haustiere sind in Tabelle 14.1 angegeben. Die Beurteilung der Regelmäßigkeit des Pulses (Rhythmus), der Pulsbeschaffenheit (Qualität) sowie des Füllungs- und Spannungszustandes der Arterie verlangt entsprechende Übung. Sie wird in der Regel durch den Tierarzt vorgenommen, ist aber auch für die TFA erlernbar und sollte vor allem am Notfall- oder Intensivpatienten vorgenommen werden.
Beurteilung der Atmung
Die Atmung wird vom Atemzentrum, das im verlängerten Mark des Stammhirns liegt, gesteuert. Im Gegensatz zum Puls ist die Atmung auch willkürlich zu beeinflussen, was die Beurteilung erschweren kann. Bei der Untersuchung der Atmung stellt man sich schräg hinter das Tier und beobachtet Brustkorb, Rippenbogen und Bauchwand. Dabei werden Häufigkeit, Typus, Regelmäßigkeit und Tiefe der Atmungsbewegungen beurteilt. Zur Ermittlung der Atemfrequenz pro Minute zählt man die Atemzüge jeweils zu Beginn der Einatmung über 30 Sekunden und multipliziert mit zwei.
Physiologische Änderungen der Atemfrequenz sind bei den Haustieren häufig durch Aufregung und Belastung gegeben. Beim Hecheln der Hunde, das der Temperaturregelung dient, ist die Atmung kurz, oberflächlich und beschleunigt. Dabei ist eine Zählung und Beurteilung nicht möglich.
Eine Atmungsbeschleunigung (Tachypnoe) beobachtet man regelmäßig im Fieber und bei starken Schmerzzuständen. Bewusstlosigkeit (Koma) und chronisches Nierenversagen sind dagegen von einer verlangsamten Atmung (Bradypnoe) begleitet.
Beim Atmungstypus wird beurteilt, in welcher Form Brust- und Bauchwand an der Atmung beteiligt sind. Als krankhaft anzusehen ist immer eine einseitig ausgeprägte Bauchatmung (abdominaler Typus), z. B. chronischen Lungenerkrankungen. Eine einseitig betonte Brustatmung (kostaler Typus) wird dagegen, z. B. bei schmerzhaften Zuständen im Abdomen, Aufblähung, Zwerchfellzerreißung und im fortgeschrittenen Stadium der Trächtigkeit beobachtet.
Als Dyspnoe wird jede krankhaft erschwerte Atmung. Je nach dem in welcher Atmungsphase die Atembeschwerde auftritt, spricht man von einer inspiratorischen bzw. exspiratorischen Dyspnoe.
Unregelmäßigkeiten der Atmung kommen bei Tieren häufig auch physiologisch bei der Witterung, beim Herumschnüffeln und bei Ablenkungen von ihrer Umgebung vor.
Besondere praktische Bedeutung hat die Beurteilung der Atmung während der Narkose, in der auch die Frequenz, Regelmäßigkeit und Tiefe der Atemzüge beachtet werden müssen.  LF 10: Narkoseüberwachung
LF 10: Narkoseüberwachung
2.6.2 Spezielle Untersuchung der Organsysteme
Die Adspektion ist das Besichtigen der Körperoberfläche einschließlich der natürlichen Körperöffnungen. Für die Betrachtung der Körperhöhlen und Hohlorgane (Inspektion) ist ein Endoskop notwendig. Mit der Adspektion lassen sich Verletzungen, Schwellungen und Tumorbildungen, Farbabweichungen und Auflagerungen feststellen.
Für die Untersuchung der Mundhöhle ist bei allen Tieren ein Auseinanderspreizen der Kiefer notwendig, um Mundschleimhaut, Zunge und Zähne genau inspizieren zu können. Für die kleinen Nager sind Spezialspreizer entwickelt worden (Abb. 2.15, 2.16).
Die Palpation ist das Betasten des Körpers von außen (äußere Palpation) und das Befühlen der erreichbaren Baucheingeweide mithilfe der rektalen Untersuchung (innere Palpation). Bei den Kleintieren werden die Bauchorgane durch die Tiefenpalpation von außen beurteilt. Auf diese Weise lassen sich Umfangsvermehrungen, Konsistenz-, Form- und Oberflächenabweichungen und eine Schmerzempfindlichkeit ermitteln.
Die Perkussion ist ein Beklopfen von luftoder gashaltigen Organen. Man verwendet dazu besonders beim Großtier einen Perkussionshammer und ein Plessimeter. Beim Kleintier wird meist ohne Plessimeter und mit dem kleinen Hammer perkutiert. Das Plessimeter dient zur Verstärkung des Klopfschalles (Abb. 2.17).
Aufgrund der Schallabweichungen von den physiologischen Werten können Rückschlüsse auf die Ausdehnung und Lufthaltigkeit des Organs, z. B. der Lunge gezogen werden.
Die Auskultation ist das Abhorchen von Organen, die durch ihre Tätigkeit Töne (Herz) oder Geräusche (Lunge, Darm) erzeugen. Das Abhorchen kann unmittelbar durch Anlegen des Ohres vorgenommen werden, besser jedoch mittelbar durch Verwendung eines Hörrohrs (Phonendoskop; Abb. 2.17). Durch das Strömen von Luft oder Flüssigkeit entstehen ganz charakteristische Geräusche, die Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des untersuchten Organs geben. Am kranken Herzen sind z. B. neben den beiden normalen Herztönen noch Geräusche, evtl. als Klappenfehler, diagnostizierbar. An der kranken Lunge treten neben den physiologischen Atmungsgeräuschen noch so gennannte Rasselgeräusche auf, wenn es zu einer Schleim- oder Flüssigkeitsansammlung gekommen ist.
Blutdruckmessung
Bei der Messung des systolischen und diastolischen Drucks in den Arterien unterscheidet man zwischen einer blutigen und unblutigen Methode.
Die direkte blutige Messung, die nur durch operativen Zugang zu einer Arterie, Einführen eines Katheters und Ablesen des Druckes über ein angeschlossenes Druckmessgerät (Manometer) erreicht wird, kann in der Praxis nicht angewendet werden.

Abb. 2.15: Spezialset für Kleinnager. Oben zwei Wangenspreizer; verstellbarer Spreizer für die Nagezähne. Darunter: Spatel und Spreizspekulum.

Abb. 2.16: Darstellung der Backenzähne mithilfe des Wangen- und Nagezahnspreizers.

Abb. 2.17: Perkussionshammer, Plessimeter, Phonendoskop (Schlauchstethoskop).
Bei der üblichen, unblutigen Methode wird durch Aufpumpen einer angelegten Gummimanschette (beim Mensch am Oberarm, beim Pferd an der Schweifrübe, beim Kleintier am Bein [Abb. 2.18]) ein künstlicher Druck erzeugt, der zum Verschwinden der Pulsation einer Arterie erforderlich ist. Wenn der Puls dann nicht mehr tastbar ist, entspricht der künstlich erzeugte Manschettendruck mindestens dem systolischen Blutdruck in der Arterie.
Nach Druckentlastung durch langsame Öffnung des Manschettenventils kann man durch Auskultation der Arterie distal der Manschette ein Strömungsgeräusch (Korotkow-Geräusch) hören. Beim Hörbarwerden des Pulsgeräusches erhält man den systolischen Druck. Dabei beginnt die Quecksilbersäule am Manometer sich auf und ab zu bewegen. Das völlige Verschwinden des Geräusches zeigt den diastolischen Druck an. Gleichzeitig hört die Bewegung der Quecksilbersäule auf. Die entsprechenden Messwerte werden in mmHg am Manometer abgelesen.

Abb. 2.18: Blutdruckmessung medial am Unterschenkel beim Hund.
Die geschilderte Methode nach Riva-Rocci hat beim Mensch sehr große praktische Bedeutung in der schnellen Erkennung und Kontrolle der häufigen Krankheitsbilder mit Bluthochdruck.
Beim Haustier spielt die Blutdruckmessung eine viel geringere Rolle. Einerseits bestehen technische Schwierigkeiten beim Anlegen der Manschette und der Ermittlung von zuverlässigen Blutdruckwerten, die bei nicht narkotisierten Tieren durch Unruhe und Erregung sehr stark schwanken. Andererseits kommen beim Haustier Hochdruckerkrankungen wie beim Menschen viel weniger vor.
Zur Überwachung des Blutdrucks während Operationen werden heute auch in der Tiermedizin vielfach elektronische Geräte verwendet. Der Blutdruck wird dabei mit anderen Methoden, z. B. Messung pulsatorischer Druckschwankungen in der Blutdruckmanschette durch Oszillometrie, ermittelt.
Transrektale Untersuchung
Die transrektale Untersuchung (Palpatio rectalis) besteht in der inneren Betastung des Beckens und der beckennahen Bauchorgane vom Rektum ausgehend. Beim Großtier erfolgt die Untersuchung mit dem durch den After eingeführten Arm, der durch einen langen Gummihandschuh mit dichtem Armabschluss bzw. einem Einweghandschuh mit dichtem Armabschluss vor Verunreinigungen geschützt wird. Der Handschuh wird mit einem Gleitmittel schlüpfrig gemacht.
Die planmäßige Durchtastung der Bauchorgane, die sich im Bereich der untersuchenden Hand befinden, ist bei Pferd und Rind eine wichtige diagnostische Hilfe. Bei vielen Erkrankungen des Abdomens, besonders bei solchen, die Koliksymptome aufweisen.
Die palpierbaren Organe und sonstigen Gebilde im Abdomen können dabei nach Lage, Größe, Oberfläche, Konsistenz, Beweglichkeit und Schmerzhaftigkeit beschrieben werden. Regelmäßig werden bei Stuten und Kühen Palpationen der inneren Genitalorgane im Verlauf von Fruchtbarkeitskontrollen (Eierstockkontrolle, Trächtigkeitsuntersuchung) bei der künstlichen Besamung und Sterilitätsbekämpfung durchgeführt. Bei großen Schweinen ist dies ebenfalls möglich und wird insbesondere zur Prüfung der Zuchttauglichkeit vorgenommen.
Kleine Wiederkäuer (Schaf, Ziege) und der Hund können rektal nur mit einem eingeführten Finger (digitale Untersuchung) untersucht werden, wobei man einen dünnen Plastikhandschuh oder einen Gummifingerling verwendet. Auch hier kann – je nach Größe des Tieres – neben der Untersuchung des Mastdarms das knöcherne Becken abgetastet werden.
Von praktischer Untersuchung ist die rektale Untersuchung beim Hund als diagnostische Hilfe bei Störungen der Darmtätigkeit wie Koprostase, Diarrhoe und Ileus. Beim Rüden fühlt man die am Beckenboden liegende Prostata. Bei Katzen ist eine rektale Untersuchung nicht möglich.
2.6.3 Von der Diagnose zur Therapie
Der Untersuchungsgang beinhaltet außerdem die weitere Vorgehensweise. Nach der Durchführung der verschiedenen Untersuchungen fasst der Tierarzt alle erhobenen Befunde zusammen und leitet daraus die Diagnose ab. Der Begriff »Diagnose« umfasst die Erkennung und die Benennung der Erkrankung.
Im Anschluss daran oder gleichzeitig werden alle Krankheiten, die eventuell ebenfalls zu dem vorliegenden Fall passen könnten, ausgeschlossen. Die Benennung dieser anderen Krankheiten nennt man Differenzialdiagnosen. Es folgt die Prognose, also die Einschätzung über den weiteren Verlauf der Erkrankung. Abhängig von allen Ergebnissen entwickelt der Tierarzt die für den Patienten individuell passende Therapie. Sie stellt die Behandlung der Krankheit dar und bietet sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten (Arzneimittel-Verabreichung, chirurgische Maßnahmen, physikalische Therapie u.s.w.).
2.7 Einsatz medizinischtechnischer Geräte
Die Zahl der medizinisch-technischen Geräte in der Tierarztpraxis ist groß. Zu ihnen zählen zum Beispiel:
• Geräte für die Diagnostik: Röntgengerät, EKG, Ultraschallgeräte, Endoskope
• Geräte für das Labor: Photometer, Zentrifugen, Sterilisatoren (Heißluftsterilisator, Autoklav)
• Geräte für die Therapie: Inhalations-Narkosegeräte, Elektro-Chirurgiegeräte, Diathermie- und Reizstromgeräte, Lasergeräte
Zu den medizinisch-technischen Geräten gehören nicht nur energetisch betriebene, sondern auch manuell zu bedienende Geräte, z. B. Beatmungsbeutel, Blutdruckmessgeräte, höhenverstellbare Untersuchungstische.
Alle Geräte sollten nur von Personen betätigt werden, die in der Handhabung der Geräte genau eingewiesen sind. Die Einweisung umfasst: Verwendungszweck, Funktionsweise, Reinigung, Desinfektion, Sterilisation, Funktionsprüfung und Verhalten bei Störungen
Die Einweisung wird vom Tierarzt vorgenommen. Funktionsstörungen bei der Anwendung der Geräte sind ihm sofort zu melden. Die genaue Schulung am Gerät und die Beachtung der Gebrauchsanweisung sollen verhindern, dass durch falschen Gebrauch und Fehlbedienung unzureichende Sicherheit und Gefahren für den Anwender auftreten.
Verordnung für den Umgang mit medizinischen Geräten
Diese Verordnung ist für die Humanmedizin in Kraft. Aber auch im veterinärmedizinischen Bereich muss gesichert sein, dass durch die Arbeit mit diesen Geräten keine Beinträchtigung für Leben und Gesundheit von Patienten, Beschäftigten oder Dritten besteht. Die Geräte müssen also den Regeln der Technik, den Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842686977
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (August)
- Schlagworte
- Berufsausbildung Berufsschule Lernfeld Lernfeldkonzept Medizinische Assistenzberufe Medizinische Fachkunde Praxisassistenz Röntgen Strahlenschutz Tierarzthelferin Tiermedizinische Fachangestellte