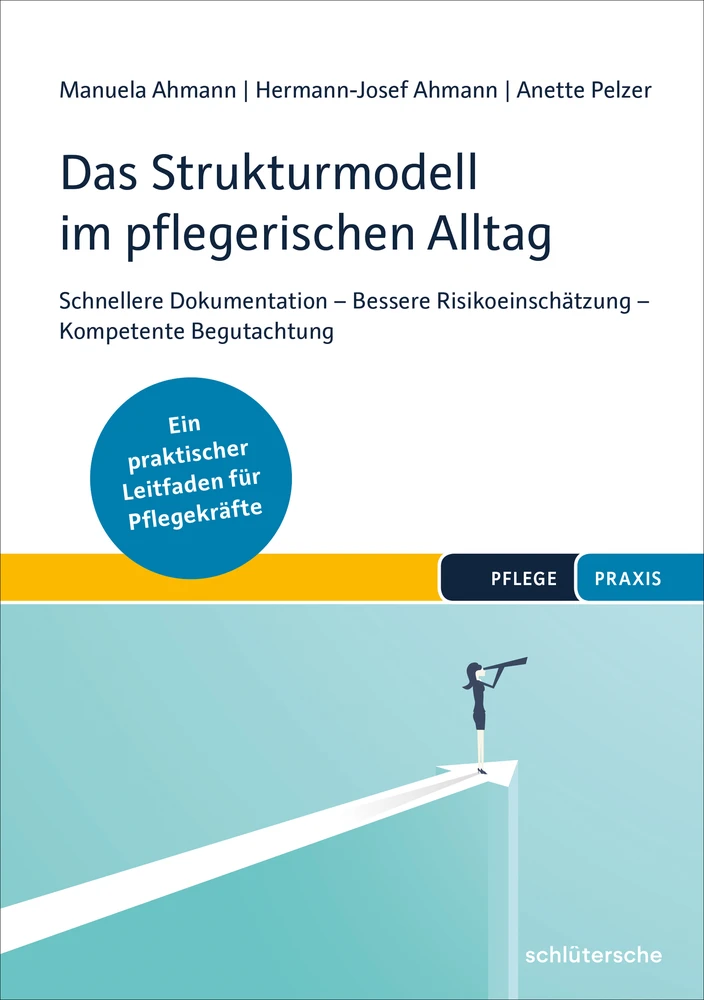Zusammenfassung
ambulanten Langzeitpflege haben sich bereits für die
Einführung der entbürokratisierten Pflegedokumentation
entschieden. Nach gut drei Jahren Praxis ist
das Strukturmodell ein Stück Alltäglichkeit geworden.
Eine Reihe von Anpassungen in Umsetzung und
Anwendung sorgte für noch mehr Praxisnähe. Neu
hinzugekommen ist das Strukturmodell für Kurzzeitund
Tagespflege.
So „schlank“ das neue Strukturmodell auch ist, in der
täglichen praktischen Anwendung zeigen sich jedoch
immer wieder Unsicherheiten:
Die praktische Umsetzung ist oft fehlerhaft.
Es kommt zu Brüchen zwischen SIS® und
Maßnahmenplanung.
Die Risikoeinschätzung fällt schwer und weist Fehler auf.
Der Zusammenhang/die Unterschiede zwischen
Strukturmodell und Begutachtung werden nicht
beachtet.
Dieses Buch bereitet das Strukturmodell praktisch
auf: Aktualisierung, Anwendungsempfehlungen und
die Zusammenhänge bzw. Unterschiede zur Begutachtung
der Pflegebedürftigkeit werden klar herausgearbeitet.
Die Handhabung des Strukturmodells im pflegerischen Alltag wird anhand vieler Beispiele erläutert
und damit nachvollziehbar.
- Fallbeispiele, praktische Tipps rund ums Strukturmodell.
- Einfach und leicht verständlich.
- Mit allen wichtigen Aktualisierungenauf dem neuesten Stand.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
»Entweder kriegen wir es jetzt hin oder wir hören auf, über die Bürokratie der Dokumentation zu schimpfen!« Diese Worte aus dem Mund des damaligen Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patienten und Patientinnen sowie Bevollmächtigten für Pflege, Staatssekretär Karl-Josef Laumann, aus dem Jahr 2014, hatten wir unserem ersten Buch »Praxisratgeber: Das Strukturmodell für die Pflegedokumentation« im Frühjahr 2016 vorausgeschickt.
Heute, Stand März 2018, kann man wohl mit Fug und Recht sagen: »… wir haben es hingekriegt!« Laut MDS hatten sich bis Mai 20171 mittlerweile ungefähr die Hälfte aller Pflegeeinrichtungen, sei es stationär, teilstationär oder ambulant, beim Projektbüro Ein-STEP registriert.
Zwar haben inzwischen Verbände wie der bpa (Bundesverband privater Anbieter ambulanter Dienste) und der BAGFW (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste sowie Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) die Arbeit des Projektbüros »Ein-STEP« (Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation) übernommen und führen die Website sowie die Weiterentwicklung fort – die frühere Registrierungsnotwendigkeit zur wissenschaftlichen Begleitung wurde aber aufgegeben.
Aus unserer Praxis wissen wir, dass Registrierung nicht auch gleichbedeutend mit Einführung des neuen Modells ist, doch wir kennen sehr viele Einrichtungen, die sich zwar nicht registriert haben, aber schon das Strukturmodell einsetzen.
Die Erfahrungen der Einrichtungen zeigen uns aber auch, dass viele Pflegefachkräfte nach wie vor unsicher bei der Umsetzung sind. Obwohl die allermeisten Beteiligten sich insgesamt sehr gut mit dem Strukturmodell identifizieren können. Schließlich ist endlich wieder die jahrelang zugunsten aller möglichen schriftlichen Einschätzungsinstrumente zurückgedrängte Pfle-gefachlichkeit bei den Mitarbeitern wieder gefragt. Doch dass man nun vieles nicht mehr dokumentieren muss, nur weil es »immer so gemacht« wird, wird noch skeptisch betrachtet.
Genau an dieser Stelle setzt die Motivation für uns Autoren ein, dieses vertiefende zweite Buch zu schreiben.
Gegenüber unserem ersten Buch von 2016 gab es einige Änderungen und Ergänzungen, die wir hier berücksichtigt haben. So gibt es neue Informations- und Schulungsunterlagen, die man von der Website www.ein-step.de herunterladen kann. Außerdem sind für die speziellen Anforderungen der Kurzzeit- und Tagespflege eigene Formulare entwickelt worden, deren Anwendung wir Ihnen hier vorstellen möchten.
Einige Fallbeispiele aus den verschiedenen Sektoren der Pflege sollen Ihnen das Verständnis für die Vorgehensweise im Strukturmodell verdeutlichen und Sie in Ihrer Arbeit unterstützen.
| Dortmund, im März 2018 | Manuela Ahmann, Hermann-Josef Ahmann & Anette Pelzer |
1 »Weniger Bürokratie durch mehr Effizienz.« Im Internet: www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/ entbuerokratisierung.html [Zugriff 2. März 2018]
1 EINFÜHRUNG
Der Dokumentationsaufwand, insbesondere im stationären und ambulanten Langzeitpflegealltag, hatte sich seit 2005 teilweise verdoppelt und verdreifacht. Aus Unsicherheit und Angst vor Prüfinstanzen entstand eine überbordende Dokumentation. Die Folge waren weniger Zeit für die Pflegebedürftigen und weniger Berufszufriedenheit der Mitarbeiter. Hinzu kam: Der Dokumentationsaufwand verschlang pro Jahr 2,7 Mrd. Euro. So errechnete es das Bundesamt für Statistik.2
Die Befreiung von unnötigem Dokumentationsaufwand im Pflegealltag war also absolut wichtig: ohne haftungsrechtliche Risiken, ohne Qualitätsverschlechterung – aber mit mehr Zeit für die Pflegebedürftigen, besserer Pflegequalität und höherer Berufszufriedenheit.
Im Juli 2013 legte Elisabeth Beikirch, die damalige Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der Pflege (OBF) im Bundesgesundheitsministeriums (BMG), dringend nötige Empfehlungen zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation vor – gemäß dem Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Diese Empfehlungen für ein Strukturmodell der Pflegedokumentation entstanden auf der Grundlage vielfaltiger Beratungen mit Experten aus Fachpraxis und Fachwissenschaften, Prüfinstanzen auf Bundes- und Landesebene sowie haftungs- und sozialrechtlicher Expertise.
Das Ergebnis: Bislang verwendete Dokumentationsmodelle, allen voran die Strukturierungshilfe »Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens« (AEDL), wurden durch eine »Strukturierte Informationssammlung« (SIS®) abgelöst.
Im April 2014 lag der Abschlussbericht zum ersten großen Praxistest des Projektes3 vor. Staatssekretar Karl-Josef Laumann beauftragte im Anschluss die IGES Institut GmbH, gemeinsam mit Elisabeth Beikirch, ein Projektbüro einzurichten, um bei der flachendeckenden Umsetzung des Projekts »Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation« zu helfen. Im Januar 2015 nahm das Projektbüro Ein-STEP seine Arbeit auf. Die Grundlage war eine Implementierungsstrategie (IMPS).4
Praxistext bestanden
Mit dem Strukturmodell konnte der Dokumentationsaufwand gesenkt werden, ohne dass die Fachlichkeit der Pflege darunter leidet. Auch in Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen hat sich das Strukturmodell mittlerweile bewährt.
Nach der erfolgreichen Implementierung des Strukturmodells wurde das Projektbüro Ein-STEP im November 2017 in die Verantwortung der beteiligten Leistungserbringer übergeben. Sie führen die Arbeit weiter. Die Ziele:
• »Die entbürokratisierte Pflegedokumentation wird fortgeführt und die fachliche Expertise damit auf allen Ebenen dauerhaft und bundesweit verstetigt.
• Die flächendeckende Akzeptanz des Strukturmodells bei Einrichtungsund Kostenträgern sowie bei den Prüfinstanzen auf Bundes- und Landesebene wird gefördert.
• Die inhaltliche und technische Umsetzung durch die Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung wird unterstützt.
• Der Zugang zu den bundesweit einheitlich festgelegten Schulungsmaterialien, Konzepten und Instrumenten – auch für Bildungsträger – wird sichergestellt.
• Die Pflegeeinrichtungen werden bei der Umstellung der Pflegedokumentation auf das Strukturmodell und den Maßnahmen zur Qualitätssicherung unterstützt.«5
Die Entscheidung eines Trägers für die neue Pflegedokumentation erfordert nach wie vor eine positive Haltung des Pflege- und Qualitätsmanagements und die erforderlichen Ressourcen. Es ist unabwendbar, dass zu Beginn der Umstellung der zeitliche und organisatorische Aufwand groß ist. Die »schlanke« Dokumentation mit verringertem Zeitaufwand stellt sich erst ein, wenn alle Mitarbeitenden genügend Routine in den neuen Prozessen haben.
Entbürokratisierung in der Praxis
Im Mittelpunkt der Entbürokratisierung stehen:
• Ein Paradigmenwechsel in der Pflegedokumentationsstruktur
• Der personenzentrierte Ansatz mit konsequenter Orientierung an den Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen der Pflegebedürftigen
• Das Vertrauen und die Stärkung der fachlichen Kompetenz der Pflegenden
• Schnelle Orientierung, Nachvollziehbarkeit, bessere Übersichtlichkeit und Zeitersparnis
• Vermittlung von Rationalität und Praxistauglichkeit im Kontext mit rechtlicher Belastbarkeit
• Aufhebung des Eindrucks, angeblich »nur« für die Prüfinstanzen dokumentieren zu müssen
Immer wieder wichtig ist der Blick ins Internet: Im Downloadbereich bei www.ein-step.de finden sich alle aktuellen Informationen, Downloads und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Interessierte finden u. a. alle bisher veröffentlichten Dokumente sowie das Strukturmodell/SIS® in vier Varianten – auch elektronisch ausfüllbar.
• Das neue Pflegedokumentationssystem bietet die Chance, einen grundlegenden Veränderungsprozess in der Pflegedokumentation einzuleiten.
• Die Medizinischen Dienste tragen diesen Prozess mit und werden ihn in ihren Qualitätsprüfungen berücksichtigen.
• Die Pflegeeinrichtungen können das neue Dokumentationssystem im Rahmen der Vorgaben des Entbürokratisierungsprojekts eigenverantwortlich umsetzen.
• Dem überbordenden Dokumentationsaufwand kann begegnet werden:
– ohne haftungsrechtliche Risiken aufzuwerfen;
– ohne Qualitätsansprüche aufgeben zu müssen;
– durch mehr Zeit für die Pflegebedürftigen;
– durch höhere Berufszufriedenheit der Mitarbeiter.
Wir möchten Ihnen die Handhabung des Strukturmodells an Beispielen erläutern und Sie im Umgang damit noch sicherer machen. Damit auch Sie am Ende sagen können: »Ja, wir sparen wirklich Zeit!«
2 Vgl. Larjow, E. (2013). Bürokratieaufwand im Bereich Pflege. In: Statistisches Bundesamt (2013). Wirtschaft und Statistik. Wiesbaden, S. 418
3 Vgl. Beikirch, E.; Breloer-Simon, G., Rink, F. & Roes, M. (2014). Praktische Anwendung des Strukturmodells – Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege. Abschlussbericht. Witten/Herdecke
4 GKV; Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW); Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) & Beikirch, E. (2014). Entwicklung einer Implementierungsstrategie (IMPS) zur bundesweiten Einführung des Strukturmodells für die Pflegedokumentation der stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen. Berlin
5 Vgl. »Entbürokratisierungskonzept der Pflegedokumentation jetzt in der Verantwortung der Trägerverbände der Pflege. Im Internet: https://ein-step.de/ [Zugriff am 5. März 2018]
2 DIE ENTBÜROKRATISIERTE PFLEGEDOKUMENTATION UND DIE SIS® – EINE ERFOLGSGESCHICHTE?
Als das Projektbüro Ein-STEP (Einführung des Strukturmodels zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation) im Januar 2015 seine Arbeit aufnahm, herrschte bei allen an dem Projekt Beteiligten (Bundesministerium für Gesundheit, die Verbände der Träger, allen voran die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrt, BAGFW, und dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, bpa, Kostenträger, Pflegekasse und Sozialämter, Prüfinstanzen, MDK/MDS und Heimaufsicht) vor allem das »Prinzip Hoffnung«. Hoffnung auf einen Durchbruch bei der Entbürokratisierung der zeitintensiven Pflegedokumentation.
Dutzende Versuche verschiedener Akteure auf Bundes- und Länderebene hatten zwar gezeigt, dass eine Reduzierung des Dokumentationsaufwandes prinzipiell möglich war, ein flächendeckender Durchbruch gelang aber niemandem.6
Als Mitte März 2015 die zentralen Schulungsunterlagen vorlagen, begann die Implementierungsphase mit der Schulung der Multiplikatoren der Verbände durch die Regionalkoordinatorinnen. Wir, die Autoren dieses Buches, gehörten zu den Multiplikatoren der allerersten Stunde. Insgesamt wurden ca. 640 Multiplikatoren und für die Verbände, mehr als 100 für die Prüfbehörden wie MDKs und Heimaufsichten geschult. Nur mit diesem Heer von Informationsverbreitern war es dann möglich, in kurzer Zeit die notwendige Zahl an Multiplikatoren auszubilden, die das Konzept des Strukturmodells in die Einrichtungen tragen konnten. Die stetig wachsende Zahl der Anmeldungen auf der Registrierungsplattform des Projektbüros zeugte dabei von dem steigenden Interesse der Einrichtungen und Dienste.
Im Rahmen der Veranstaltung des Projekts »Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation« zum Abschluss der Implementierungsstrategie im Oktober 2017 in Berlin, gab die Patientenbeauftragte und Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretärin Ingrid Fischbach, das Projekt in die Verantwortung der Trägerverbände. Die konsequente Weiterführung der Ent-bürokratisierung wird darüber hinaus weiter politisch unterstützt. Das Projekt des Bundesministeriums für Gesundheit zur »Entbürokratisierung in der Pflegedokumentation« endete am 31. Oktober 2017
Auch nach Abschaltung der Registrierung werden wir als Multiplikatoren von Einrichtungen angesprochen, die sich bisher noch nicht für die Einführung des Strukturmodells entscheiden konnten oder wollten.
Da die Verbände auch weiterhin »offizielle« Schulungen für die Ausbildung von Multiplikatoren anbieten, und die vorhandenen Multiplikatoren, so wie wir auch, nach wie vor zu Schulungen der Einrichtungen und Dienste eingeladen werden, kann man davon ausgehen, dass die Zahlen der beteiligten Einrichtungen auch weiterhin steigen werden.
Die im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes erstellte »Evaluation der Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation SV 16-9002 (EVASIS)«7 aus dem September 2017 bescheinigt dabei, das die Umsetzung des Strukturmodells in den Einrichtungen und Diensten insgesamt erfolgreich verlaufen ist und geeignet sei, die Anforderungen als Grundlage für die Qualitätssicherung zu bestehen. Allerdings wird darin auch festgestellt, dass es dauerhaft notwendig sei, das Pflegefachpersonal in der Anwendung der Elemente des Strukturmodells zu schulen und den Umgang mit den Einschätzungen, insbesondere mit der Risikomatrix, zu intensivieren. Dass in dieser Studie auch die Prüfbehörden MDK und Heimaufsichten mit ihrer Auffassung der grundsätzlich gelungenen Dokumentationspflichten zitiert werden, gibt dem gesamten Projekt sozusagen den »Ritterschlag«.
Also eine Erfolgsgeschichte?
Ja, aber eine, die nur durch Kontinuität und permanente Übung zur Vollendung gelangt …!
6 Vgl. Beikirch, E. & Nolting, H. D. (2017). Dokumentieren mit dem Strukturmodell. Hannover: Vincentz, S. 19 ff.
7 Vgl. »Evaluation der Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation – Abschlussbericht, Bremen 28. September 2017«. Im Internet: www.ein-step.de
3 DAS STRUKTURMODELL – ANWENDUNG UND AKTUALISIERTE HINWEISE FÜR DEN UMGANG
Seit dem 15. Januar 2018 stehen die aktuellen, bundesweit einheitlichen Versionen der »Informations- und Schulungsunterlagen für Pflegeeinrichtungen und Multiplikator(inn)en« Version 2.0 (Stand Oktober 2017)«, die Formularvorlagen der »SIS® (Version 2017)« sowie die »Anhänge zu den Informations- und Schulungsunterlagen für Pflegeeinrichtungen und Multiplikator(inn)en« unter der Internetseite www.ein-step.de8 für alle Interessierten zum Download zur Verfügung. Ebenso wurden die »Hinweise zu den überarbeiteten Informations- und Schulungsunterlagen zur Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege (Version 2.0 Oktober 2017)« veröffentlicht, die die Erstellung und Überarbeitung der Unterlagen notwendig machten.
Neu ist, dass es nun keine einzelnen Leitfäden für Tages- bzw. Kurzeitpflege mehr gibt. Stattdessen wurden die Schulungsunterlagen für alle Versorgungsbereiche (ambulant, stationär, Tages- und Kurzzeitpflege) aktualisiert und in einem Dokument zusammengeführt.
Die Schulungsunterlagen gelten sowohl für die ambulanten und die stationären Pflegeeinrichtungen als auch für die Tages- und Kurzzeitpflege.
Hinweis
Die Homepage www.ein-step.de wurde am 1. November 2017 in die Verantwortung der Trägerverbände übergeben. Die Downloads bleiben aber weiterhin erhalten.
Außerdem gibt es auch Ansprechpartner/-innen der Verbände auf Landesebene. Zusätzlich wurde eine zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene eingerichtet. Diese ist unter der gegenwärtig bei der BAGFW eingerichteten zentralen E-Mail-Adresse zu erreichen:
buerokratieabbau@bag-wohlfahrt.de
Alternativ auch unter Telefon 030/240 89 115
Tabelle 1 zeigt Ihnen, welche Unterlagen Sie seit Januar 2018 unter www.ein-step.de als Downloads finden.
Übrigens ist das Akronym (= die Abkürzung) SIS® seit September 2016 eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wortmarke für die Klassen 35 (Organisationsberatung etc. im Gesundheitsbereich) und 44 (Beratungsdienste zur Pflegedokumentation). Inhaber der Marke ist die Bundesrepublik Deutschland. Die Schutzdauer läuft am 30. Juni 2026 ab.
Hinweis
Trotz aller Neuerungen, eines ist geblieben: »Das Strukturmodell und die darin enthaltene Strukturierte Informationssammlung (SIS®) bilden fachlich-inhaltlich eine Einheit. Das Konzept der SIS® ist der Einstieg in den vierphasigen Pflegeprozess und kann nur von hierin geschulten Pflegefachkräften angewandt werden. Jeder Aspekt des Strukturmodells mit seinen vier Elementen ist im Entwicklungs- und Erprobungsprozess sorgfältig fachlich wie juristisch abgewogen worden.«
* Vgl. www.ein-step.de/pflegeeinrichtungen/schulungsunterlagen
Aktualisierte Varianten aller bisher erstellten Formulardokumente der Strukturierten Informationssammlung (SIS®) sowie deren technische Nutzung stehen auf der Internetseite www.ein-step.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Die »Informations- und Schulungsunterlagen zur Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege Version 2.0 Januar 2018« sind die verbindliche Grundlage für die zweitägigen (Einführungs-) Schulungen zur Neuausrichtung der Pflegedokumentation auf der Grundlage des Strukturmodells.
Nach den Einführungsschulungen bieten die Multiplikatoren oder Bildungsträger der Verbände mindestens drei Reflexionstreffen sowie zusätzliche Inhouseschulungen für Pflegeeinrichtungen an. Sog. eintägige »Updates Strukturmodell« sind übrigens inzwischen sehr beliebt: »zur Auffrischung des Wissens zum Strukturmodell, [zur] Überprüfung zum Stand der Umsetzung, [zum] kollegiale[n] Dialog offener Fragen oder zur technischen Umsetzung.«9
Tipp
Machen Sie die Schulungsunterlagen für alle Ihre Mitarbeitenden zugänglich! So haben sie den wichtigsten Begleiter bei der Umsetzung des Strukturmodells immer griffbereit.
3.1 Die Strukturierte Informationssammlung (SIS®)
Das Strukturmodell basiert auf vier Elementen, in Anlehnung an den vierphasigen Pflegeprozess der WHO:
1. Element: Strukturierte Informationssammlung (SIS®)
2. Element: Individueller Maßnahmenplan
3. Element: Berichteblatt
4. Element: Evaluation
3.1.1 Die Strukturierte Informationssammlung (SIS®)
Mit der Strukturierten Informationssammlung (SIS®) beginnt der Einstieg in den Pflegeprozess. Seit April 2017 stehen vier Versionen der SIS® zur Verfügung (vgl. Tabelle 2). Die Strukturierte Informationssammlung (SIS®) ist integraler Bestandteil des Strukturmodells zur grundlegenden Neuausrichtung der Pflegedokumentation. Sie basiert auf einem wissenschaftlichen Konzept.
Die drei Kernelemente der SIS®:
1. Eigeneinschätzung der pflegebedürftigen Person,
2. Sechs Themenfelder zur fachlichen Einschätzung durch die Pflegefachkraft und
3. Matrix zur Ersteinschätzung pflegesensitiver Risiken/Phänomene.
Generell liegt dem Strukturmodell der Kerngedanke einer personzentrierten Pflege zu Grunde. Die SIS® wird vor allem im Rahmen des Erstgespräches eingesetzt. Hier wird der Sichtweise der pflegebedürftigen Person zu ihrer Lebens- und Pflegesituation und ihren Wünschen/Bedarfe an Hilfe und Unterstützung bewusst Raum gegeben.
Die fachliche Einschätzung der Situation durch die Pflegefachkraft wird in sechs wissenschaftsbasierten Themenfeldern abgebildet. Diese fachliche Einschätzung wird verknüpft mit den sich daraus ergebenden Risiken und pflegesensitiven Phänomenen in Form der Risikoeinschätzung als Matrix.
Das bewusste Zusammenführen der individuellen und subjektiven Sicht der pflegebedürftigen Person mit der fachlichen Einschätzung durch die Pflegefachkraft, sowie das Ergebnis des Verständigungsprozesses dieser beiden Personen, bildet die Grundlage aller pflegerischen Interventionen in der Maßnahmenplanung.
Die SIS® gliedert sich formal in
• Stammdaten (A)
• Einstiegsfrage (B)
• wissenschaftsbasierte Themenfelder (C1)
• Risikomatrix (C2)

Abb. 1: Die funktionelle Aufteilung der Abschnitte der Strukturierten Informationssammlung (SIS®).
Diese Aufgliederung ist in allen Versionen einschließlich Tages- und Kurzzeitpflege erhalten.
Hinweis
Die Besonderheiten der Anwendung der SIS® in der Tages- und Kurzzeitpflege werden ausführlich im Kapitel 5 dargestellt.
Die SIS® unterscheidet sich je nach Einsatzbereich (vgl. Abbildungen 2 bis 5)

Abb. 2: SIS® ambulant.

Abb. 4: SIS® stationär.
Die Risikomatrix

Abb. 6: SIS® Risikomatrix stationär.
Der fachgerechte Umgang mit pflegerelevanten Risiken und Phänomen in der Risikomatrix ist ein zentrales Element zur sicheren Gestaltung des vierphasigen Pflegeprozesses.
Anfangs hatten die Pflegefachkräfte Schwierigkeiten im Umgang mit der Risikomatrix. Doch die gehören inzwischen der Vergangenheit an. Vertiefende Reflexionstreffen, Schulungen und Fallbesprechungen im Rahmen der Einführung des Strukturmodells führten zu einem Zuwachs der Fachkompetenz.
Durch die Nutzung der Risikomatrix und der Frage, ob eine weitere Einschätzung notwendig ist, hat sich die bisherige Praxis einer schematischen Anwendung von unterschiedlichen Differenzialassessments grundlegend verändert.
Seit Oktober 2016 wird der Begriff/Sprachgebrauch »kompensiertes Risiko‘« in den Schulungen vom Projektbüro Ein-STEP nicht mehr verwendet. Dies gilt für den stationären und ambulanten Bereich sowie für die Tages- und Kurzzeitpflege. Bei Ein-STEP war man der Meinung, dass die Option »kompensiertes Risiko« eher zu Verwirrung führte.
Hinweis
Die »häufigen Fragen zu der Verfahrensanleitung« stehen seit Januar 2018 nicht mehr zum Download zur Verfügung. Sie sind in den überarbeiteten »Informations- und Schulungsunterlagen zur Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege (Version 2.0 Oktober 2017) und den Anlagen« integriert.*
* Vgl. »Hinweise zu den überarbeiteten Informations- und Schulungsunterlagen zur Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege (Version 2.0 – Oktober 2017). Im Internet: www.ein-step.de/schulungsunterlagen/schulungsunterlagen/ [Zugriff am 2. März 2018]
In den Qualitätsprüfungs-Richtlinien heißt es dazu: »Die Qualitätsprüfungsrichtlinie verwendet den Begriff »kompensiertes Risiko« nicht. Im Rahmen von Qualitätsprüfungen ist es nicht erforderlich, den Begriff »kompensiertes Risiko« zu verwenden; hier sollte durch die Prüfer lediglich unterschieden werden, ob ein Risiko vorliegt oder ob kein Risiko vorliegt.«10
Im Feld »Sonstiges« der Risikomatrix können spezielle Risiken aufgenommen werden, insbesondere Pflegesituationen, die sich nicht über die Themenfelder abbilden lassen. Dies ist und kann sowohl eine pflegerische als auch eine juristische Entscheidung der Pflegefachkraft sein.
In der Regel werden dort keine Prophylaxen eingetragen. Notwendige Prophylaxen werden im entsprechenden Themenfeld begründet dargestellt, über den Verständigungsprozess aufgegriffen und ihre Durchführung im individuellen Maßnahmenplan beschrieben.
Die bisherige Risikoeinschätzung entlang der SIS® einschließlich der Risikomatrix und den Prinzipien des Strukturmodells (pflegefachliche Entscheidung, Abkehr von schematischen Routinen) hat weiterhin Bestand und hat sich in der Praxis bewährt.
Dies bedeutet z. B., dass durch Hilfsmitteleinsatz (z. B. Brille bei Sehstörungen oder Gehhilfe bei Balancestörungen) das Risiko/Phänomen mit »Nein« zu bewerten ist. Voraussetzung ist, dass die pflegebedürftige Person mit dem Hilfsmittel selbstständig umgehen kann. Dazu gehören natürlich auch – etwa bezogen auf die Brille – regelmäßige Arztbesuche und eine Anpassung der Sehhilfe an eine veränderte Sehfähigkeit.
Fazit
Ein Risiko kann nur als ausgeglichen gelten, wenn bereits in den Themenfeldern dargelegt und ersichtlich ist, wodurch das Risiko durch eine entsprechende Gegenwirkung aufgehoben ist.
Der Umgang mit der Risikomatrix und ihre Verbindung mit den Expertenstandards des DNQP werden detailliert in Kapitel 5 bearbeitet.
3.2 Der Maßnahmenplan
Das Strukturmodell verwendet anstelle des alten Begriffs »Pflegeplanung« den Begriff »Maßnahmenplan«. Hier werden Leistungen der pflegerischen Versorgung, der psychosozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung sowie – im stationären Bereich integriert bzw. im ambulanten Versorgungssektor separat – auch die Leistungen der Behandlungspflege einbezogen.
Der Maßnahmenplan wird nicht als einheitliches Dokument im Strukturmodell vorgegeben, wie z. B. die SIS®. Hier muss das einrichtungsinterne Pflege- und Qualitätsmanagement ein entsprechendes Formular entwickeln. Selbstverständlich unter Berücksichtigung erforderlicher und optionaler Strukturen. Dokumentationshersteller stellen ebenfalls eigene Formulare bzw. Programmmenüs zur Verfügung.
Tipp
Wenn Sie eigene Formulare bzw. Menüpunkte selbst entwickeln oder dazukaufen, müssen Sie sie immer prüfen: Entsprechen sie den erforderlichen und optionalen Strukturen eines Maßnahmenplans?
Achten Sie beim Kauf von Softwarelösungen auch auf Folgendes: Lässt sich der Maßnahmenplan auf Ihre Einrichtung anpassen? Wenn das nicht so ist, haben Sie anschließend einen erhöhten Arbeitsaufwand!
| Erforderlich | Optional |
| Name der pflegebedürftigen Person | Weitere einrichtungsinterne Identifizierungsmerkmale |
| Geburtsdatum der pflegebedürftigen Person | Grundbotschaft der pflegebedürftigen Person |
| Datum der Erstellung | |
| Handzeichen der Pflegefachkraft | |
| Spalte Zeitangabe (Zeitraum/Zeitpunkt) | Spalte für Hilfsmittel |
| Spalte Maßnahmen | Spalte für Verfahrensanleitung (Standard/Leitlinie) |
| Spalte Evaluationsdaten | Spalte für Nummer des Themenfeldes |
| Hinweis zur Behandlungspflege (integriert in die Tagesstruktur oder separat) | Spalte Leistungskomplex (ambulant) |
| Blattnummerierung (fortlaufend) | Spalte für Evaluationstext |
Die Erkenntnisse aus der SIS® bilden die Grundlage für den individuellen Maßnahmenplan, der übersichtlich und gut nachvollziehbar dargestellt wird.
Fazit
Im Maßnahmenplan werden die routinemäßigen und wiederkehrenden Abläufe in der grundpflegerischen Versorgung sowie der psychosozialen Betreuung handlungsanweisend formuliert.
Bis Anfang Januar 2018 wurden in den Informations- und Schulungsunterlagen zur Erstellung des Maßnahmenplans noch unterschiedliche Varianten der Umsetzung vorgeschlagen. Die jetzt aktuellen Versionen der »Informations- und Schulungsunterlagen für Pflegeeinrichtungen und Multiplikator(inn)en« fassend die nötigen Information in einer einzigen Schulungsunterlage zusammen.
Der Hintergrund: Die Erfahrungen aus der Praxis zeigten, dass die verschiedenen Varianten des Maßnahmenplans unterschiedlich brauchbar waren. Es empfiehlt sich, in allen Versorgungsbereichen im Maßnahmenplan eine Grundbotschaft voranzustellen. Für jeden der vier Versorgungsbereiche gibt es eigene Versionen eines Maßnahmenplans.
Grundbotschaft
»Die Grundbotschaft ist eine knappe Zusammenfassung wesentlicher Aussagen zur Selbstbestimmung und zu besonderen Eigenschaften der pflegebedürftigen Person. Mögliche Inhalte beziehen sich auf die Persönlichkeit, Antreiber, spezielle Bedürfnisse, ggf. auch auf besondere Verhaltensweisen oder psychische Problemlagen sowie Vorlieben oder Rituale. Das Voranstellen einer Grundbotschaft stellt zusätzlich sicher, dass diese Botschaften im Kontakt mit der pflegebedürftigen Person, allen an der Pflege und Betreuung Beteiligten bekannt sind und entsprechende Beachtung finden«.*
* Vgl. Die Beauftragte … 2017, S. 64
3.2.1 Varianten zur Strukturierung des Maßnahmenplans in den vier Versorgungsbereichen
Ambulanter Versorgungsbereich
Die Strukturierung des ambulanten Maßnahmenplans unterscheidet sich von der stationären Version dadurch, dass sie sich an den Rahmenbedingungen der häuslichen Versorgung zu orientieren hat. D. h. Art und Umfang sind durch die individuell vereinbarten Leistungen (gemäß dem abgeschlossenen Pflegevertrag) vorgegeben.
Tipp
Im ambulanten Bereich hat sich eine Strukturierung nach individuell ausgestalteten Leistungskomplexen in Kombination mit dem Einsatzverlauf (Pflege und Betreuungsorganisation) bewährt.
Eine weitere Variante ist die Detailbeschreibung des Einsatzes in Kombination mit den Leistungskomplexen, den Themenfeldern und zeitlichen Festlegungen individuell vereinbarter Unterstützungsleistungen.12
Teilstationärer Versorgungsbereich (Tagespflege)
Auch in diesem Versorgungsbereich bilden der Verständigungsprozess mit dem Tagesgast und seinen Angehörigen sowie die Erkenntnisse aus der SIS® die Grundlage für den individuellen Maßnahmenplan.
Hinweis
Im Vordergrund des Maßnahmenplans in der Tagespflege steht die psychosoziale Betreuung. Die individuellen pflegerischen Maßnahmen spielen nur eine begrenzte Rolle, da sie in der Regel von ambulanten Pflegediensten oder Angehörigen übernommen werden.
In den Anlagen zum Leitfaden »Anpassung des Strukturmodells an die Dokumentationsanforderungen der Tagespflege« sind drei Musterformulare als Anregung für die einrichtungsindividuelle Umsetzung hinterlegt.13
Stationärer Versorgungsbereich
Im stationären Maßnahmenplan erfolgt eine ausführliche Beschreibung der 24-Stunden-Versorgung des Bewohners, wobei regelhaft wiederkehrende pflegerische Handlungen der Pflege und Betreuung im Tagesablauf nur einmal beschrieben und in der Folge durch eine Kurzfassung im weiteren Verlauf dargestellt werden. Individuelle Festlegungen der Maßnahmen zu gewünschten Zeitpunkten und Maßnahmen der Behandlungspflege sowie eventuelle Prophylaxen werden integriert.
Im stationären Versorgungsbereich kann ein Maßnahmenplan in drei unterschiedlichen Varianten erfolgen:
1. Variante – Themenfelder kompakt
Die individuellen Wünsche und Vorlieben der pflegebedürftigen Person sind in der individuellen Tagesstrukturierung als »Grundbotschaft« vorangestellt. Die alltäglichen pflegerischen Handlungen und Betreuungsangebote sind analog zu den Themenfeldern strukturiert. Hierzu zählen auch eventuelle erforderliche Prophylaxen, die in den Ablauf der pflegerischen Handlung eingebunden sind. Maßnahmen der Behandlungspflege werden gesondert aufgeführt.
2. Variante – Tagesstruktur kompakt
Hier wird der gesamte Tagesablauf mit den täglichen pflegerischen Handlungen und Betreuungsangeboten in der zeitlichen Reihenfolge für 24 Stunden einmal beschrieben. Individuelle Festlegungen der Leistungserbringung zu gewünschten Zeitpunkten und Maßnahmen der Behandlungspflege sowie eventuelle Prophylaxen werden integriert.
3. Variante – Tagesstruktur rational
Die individuellen Wünsche und eine ausführliche Beschreibung der 24-Stunden-Versorgung werden vorangestellt. Regelhaft wiederkehrende pflegerische Handlungen der Pflege und Betreuung im Tagesablauf werden nur einmal beschrieben und in der Folge durch eine Kurzfassung im weiteren Tagesverlauf dargestellt. Individuelle Festlegungen der Maßnahmen zu gewünschten Zeitpunkten und Maßnahmen der Behandlungspflege sowie eventuelle Prophylaxen werden integriert.
Kurzzeitpflege
Grundsätzlich gelten für die Erstellung des Maßnahmenplans in der Kurzzeitpflege die gleichen Umsetzungshinweise wie für die stationäre Pflege.
Erkenntnisse aus Maßnahmenplänen von früheren Aufenthalten in der Kurzzeitpflege können – bei Wiederaufnahme der pflegebedürftigen Person – herangezogen werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sich aus der SIS® keine veränderten Informationen ergeben.
In den Anlagen zum Leitfaden »Anpassung des Strukturmodells an die Dokumentationsanforderungen der Kurzzeitpflege« finden sich zwei Musterformulare als Anregung für die einrichtungsindividuelle Umsetzung des Maßnahmenplans in diesen Einrichtungen.14
Tabelle 4: Varianten zur Strukturierung des Maßnahmenplans für alle Bereiche15

Hinweis
Die detaillierten Besonderheiten der Anwendung des Maßnahmenplans in der Tages- und Kurzzeitpflege werden ausführlich in Kapitel 4 dargestellt.
3.3 Das Berichteblatt
Das Berichteblatt ist als zentrale Informationsplattform für alle an der Pflege und Betreuung Beteiligten zu verstehen. »In dem Berichteblatt nehmen künftig alle an der Pflege und Betreuung beteiligten Personen, z. B. Angehörige anderen therapeutischen Fachberufe und der sozialen Betreuung aber auch die zusätzlichen Betreuungskräfte (gem. §§ 45b und 43b SGB XI) ihre Eintragungen vor. Hierzu bedarf es klarer Vorgaben des Qualitätsmanagements unter Berücksichtigung des Datenschutzes.«16
Fazit
Im Berichteblatt sind nicht zwingend tägliche Eintragungen erforderlich, sodass hier eine tatsächliche entbürokratisierte Entlastung und Zeitersparnis sichtbar wird.
Die Hinterlegung von schriftlichen Verfahrensanleitungen (Leitlinien, Standards etc.) für die wichtigsten Handlungen in der Pflege und Betreuung ist die Voraussetzung, um im Berichteblatt nur noch die Abweichungen zu erfassen.
Die Fokussierung auf zu dokumentierende Abweichungen im Berichtblatt (von geplanten Maßnahmen und pflegefachlichen Beobachtungen) haben gezeigt, dass hierdurch Veränderungen im Risikobereich schneller sichtbar werden. Eine häufig auftretende sinnentleerte Dokumentation oder Doppeldokumentation im Bericht konnte so verhindert werden. Abbildung 7 zeigt im Überblick Notwendigkeiten der Dokumentation im Berichteblatt.
Einrichtungsintern wird festgelegt, wenn bei pflegebedürftigen Personen mit stabilen Versorgungsverläufen über einen längeren Zeitraum keine Eintragungen im Berichteblatt vorzufinden ist, in welchen zeitlichen Abständen, auf der Grundlage einer knappen Evaluation der Situation, die Bestätigung einer unverändert stabilen Versorgungssituation dokumentiert wird.
3.3.1 Das Berichteblatt bei Menschen mit Demenz
Es ist unabdingbar – sowohl in Bezug auf die Qualitätsprüfungen durch den MDK wie auch durch die Einführung des neuen Expertenstandards »Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz« – das Wohlbefinden und das Recht auf Selbstbestimmung im individuellen Umfang und Abständen bei an Demenz erkrankten Menschen zu dokumentieren.
In den stationären Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDK/MDS heißt es zum Thema »Wohlbefinden von Bewohnern mit Demenz«: »Wie ist mit der Frage 14.6/T36 »Wird das Wohlbefinden von Bewohnern mit Demenz im Pflegealltag beobachtet und dokumentiert und werden daraus ggf. Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet?«17 umzugehen?
Der Anleitung zur Prüffrage kann entnommen werden, dass sich die Frage auf Hinweise zum Wohlbefinden bzw. zum Unwohlsein bezieht. Beobachtungen bzw. Hinweise zum Wohlbefinden bzw. Unwohlsein können z. B. im Berichteblatt (»schlüssige Darstellung der Mitarbeiter«18) vermerkt und damit als Grundlage für den Maßnahmenplan bzw. für einzuleitende Verbesserungsmaßnahmen herangezogen werden.
Im Rahmen der Evaluation müssen im Berichteblatt in individuellen Zeitabständen dazu Aussagen getroffen werden.
Bezüglich der strukturellen Anforderungen an die Versorgung, Pflege und Betreuung von Bewohnern in stationären Pflegeeinrichtungen, die demenzbedingte kognitive und/oder kommunikative Einschränkungen aufweisen, trifft das Recht auf Selbstbestimmung zu. In der stationären Pflege, Transparenzfrage 35, heißt es: »Wird bei Bewohnern mit Demenz die Selbstbestimmung bei der Pflege und Betreuung berücksichtigt?«19
Fazit
Aus der Dokumentation sollte erkennbar sein, dass Bewohner mit Demenz das Recht haben, bei der Ausgestaltung der Pflege und Betreuung aktiv mit zu entscheiden, auch wenn sie dies nur durch ihr Verhalten zum Ausdruck bringen können.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842689329
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Mai)
- Schlagworte
- Altenpflege Rechtsberatung Gesundheit & Medizin Medizin Pflege Pflegemanagement