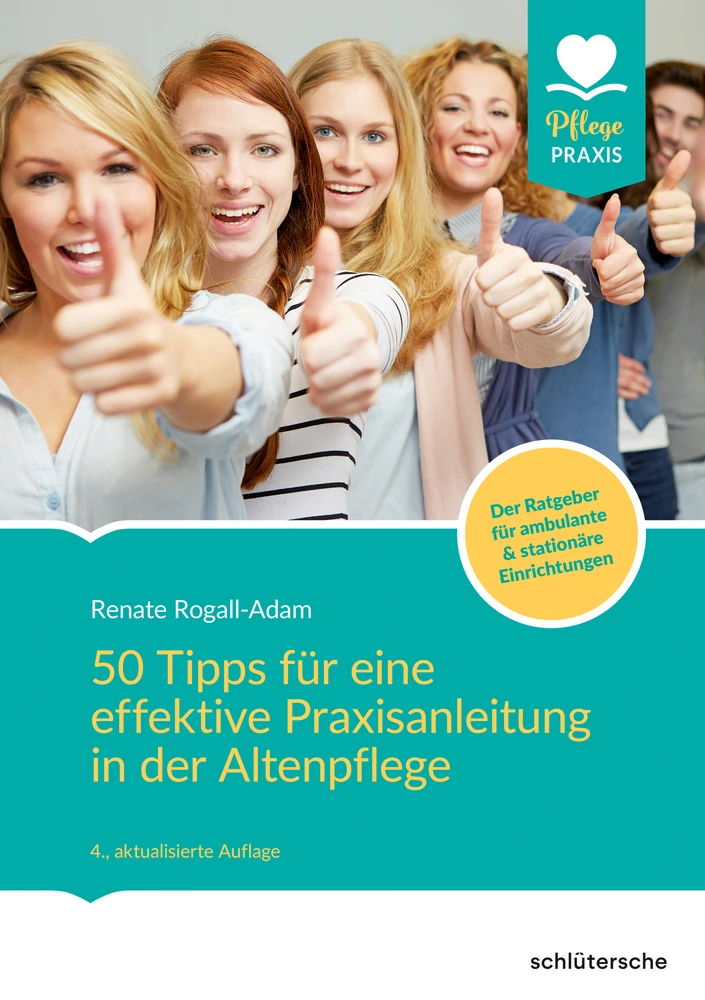Zusammenfassung
Ob ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtung – in diesem handlichen Nachschlagewerk finden sich die wichtigsten Instrumente für eine gute Beziehung zwischen Anleiter, Auszubildendem und Team.
Kritik so formulieren, dass sie auch wirkt. Sich in Konfliktsituationen sachlich und neutral verhalten. Verräterische Signale der Körpersprache etc.
Die 50 Tipps konzentrieren sich auf das Wesentliche. Renate Rogall-Adam hat sie in zahlreichen Fort- und Weiterbildungen für Praxisanleiter gesammelt und stellt sie leicht verständlich vor.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Praxisanleitung ist ein zentraler Schwerpunkt in der praktischen Pflegeausbildung. Praxisanleiterinnen führen Auszubildende schrittweise in die eigenständige Wahrnehmung und Durchführung der beruflichen Aufgaben ein. Durch Anleitung, Begleitung und Beratung prägen sie nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch die persönliche Entwicklung der Auszubildenden.
Dieses Arbeitsbuch behandelt die wichtigsten Aspekte der Praxisanleitung in insgesamt 50 Tipps. Erfahrungsberichte von Praxisanleiterinnen haben dabei die Auswahl der Themen maßgeblich bestimmt. Gute Kenntnisse in der Kommunikation und Gesprächsführung sind eine wichtige Voraussetzung für die Anleitungstätigkeit. Darum liegt in diesem Bereich ein bewusst gewählter Schwerpunkt der Tipps.
Die theoretischen Ausführungen sind eher knapp gehalten und in erster Linie für die Anleitungspersonen gedacht. Die einzelnen Tipps schließen mit Anregungen zur individuellen Weiterentwicklung der eigenen Praxis. Sie sollen den anleitenden Personen helfen, ihren eigenen Stil zu entwickeln. Deshalb wird auch die persönliche Anrede verwendet.
Das Arbeitsbuch gliedert sich in neun Themenbereiche, denen die Tipps zugeordnet sind.
1. Die Praxisanleiterin
2. Die Auszubildenden
3. Das Lernfeldkonzept als Grundlage der Anleitung
4. Kommunikation
5. Der Prozess der Anleitung
6. Die Durchführung von Gesprächen
7. Die Beurteilung
8. Umgang mit schwierigen Situationen
9. Zusatz-Tipps und Schlussbemerkung
Das Pflegeberufegesetz von 2017 löst die bisherigen Gesetze zur Alten- sowie Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung ab. Die Pflegeausbildung nach dem neuen Pflegeberufegesetz wird im Jahre 2020 beginnen. Bis dahin gelten weiterhin die bestehenden Gesetze.
Unter den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen behalten die »50 Tipps für eine effektive Praxisanleitung« weiterhin ihre volle Geltung. Kommunikation, Gesprächsführung, Beurteilung usw. sind bleibende Bestandteile jeder Praxisanleitung.
Ab 2020 wird es im Wesentlichen im dritten Themenbereich Veränderungen geben. Diese Veränderungen betreffen die Ausbildungsform und die Orientierung an Kompetenzen. Im 9. Kapitel sind daher zwei Zusatz-Tipps hinzugefügt worden.
1. 9.1 »Setzen Sie sich mit dem neuen Pflegeberufegesetz auseinander«. Hierbei geht es um die neue Gesetzeslage.
2. 9.2 »Beachten Sie bei der Praxisanleitung die unterschiedlichen Profile der Generationen«. In diesem Tipp wird die Frage der unterschiedlichen Generationsprofile aufgenommen.
Durch Rückmeldungen aus der Praxis wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass sich bei der Anleitung das Thema der Unterschiedlichkeit der Generationen vermehrt als Herausforderung erweist. Die Ausführungen in Kapitel 9.2 möchten für die Unterschiedlichkeit der Generationen sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, dass diese für eine gute Zusammenarbeit bei der Anleitung zu beachten ist.
Es freut mich, dass die »50 Tipps für eine effektive Praxisanleitung in der Altenpflege« weiterhin auf Interesse stoßen. Allen Leserinnen und Lesern der 4. Auflage wünsche ich ein gutes Gelingen beim Transfer vor Ort.
Renate Rogall-Adam
1. Tipp: Klären Sie die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen1
Im »Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG)«, das am 1. August 2003 in Kraft trat, und in der »Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers (AltPflAPrV)« vom 26. November 2002 werden die Aufgaben der Praxisanleitung folgendermaßen formuliert:
• Der Träger der praktischen Ausbildung hat die Ausbildung planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel erreicht werden kann (§ 15 (1) AltPflG).
• Die auszubildende Einrichtung stellt die Praxisanleitung durch eine geeignete Fachkraft auf der Grundlage eines Ausbildungsplanes sicher (§ 2 (2) AltPflAPrV).
• Es ist Aufgabe der Praxisanleitung, die Schülerin oder den Schüler schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heranzuführen und den Kontakt mit der Altenpflegeschule zu halten (§ 2 (2) AltPflAPrV).
Die Gesamtverantwortung für die praktische Ausbildung liegt bei der Altenpflegeschule (§ 4 (4) AltPflG). Die Altenpflegeschule unterstützt und fördert die praktische Ausbildung durch die Praxisbegleitung. Die Praxisanleitung ist durch die Einrichtung sicherzustellen. Die Einrichtung ist verpflichtet, einen Ausbildungsplan zu erstellen. Nach den gesetzlichen Vorgaben sollen Praxisanleiterinnen über eine berufspädagogische Zusatzqualifikation verfügen. In den gesetzlichen Vorgaben zur Altenpflegeausbildung wird der Umfang der pädagogischen Qualifikation offen gelassen. Die diesbezüglichen konkreten Bestimmungen finden sich in den einschlägigen Erlassen der zuständigen Ministerien der einzelnen Bundesländer.
Die Praxisanleitung wird durch gesetzliche Vorgaben und strukturelle Rahmenbedingungen beeinflusst. Eine entscheidende Rahmenbedingung der praktischen Ausbildung stellt die Pflegequalität der jeweiligen Einrichtung dar, wozu
• das Leitbild der Einrichtung und das Pflegeleitbild,
• ein Pflegemodell und ein Pflegekonzept,
• das Pflegeprozessmodell als Grundlage für die individuelle Pflege und
• eine angemessene personelle und räumliche Ausstattung gehören.
Zusätzlich nehmen auf die Organisation, den Prozess und das Ergebnis der Praxisanleitung Einfluss: die Auszubildende, die Praxisanleiterin, das Team und die Patienten/Bewohner mit ihren Angehörigen.
Mit der praktischen Anleitung von Auszubildenden übernimmt die Praxisanleiterin neben der pflegerischen Tätigkeit eine weitere Aufgabe. Diese erfordert einen zusätzlichen Zeitaufwand. Dafür sollte sie in entsprechendem Umfang freigestellt werden. Verbindliche Anhaltszahlen für den zeitlichen Rahmen sind nicht bekannt.
Wie viele Auszubildende eine Praxisanleiterin anleiten kann oder soll, ist nicht festgelegt. Aus arbeitsrechtlichen und anderen Gründen ergibt sich jedoch die Situation, dass die Anleiterin nicht immer anwesend sein kann. Auch wenn sie die Gesamtverantwortung für die Planung und Durchführung der Anleitung trägt, müssen Teilaufgaben an pädagogisch geeignete Teammitglieder delegiert werden.
Neben Auszubildenden in der Altenpflege werden in den Einrichtungen auch noch andere Gruppen angeleitet (z. B. Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege, neue Mitarbeiterinnen, Praktikanten, Pflegekräfte). Die Grundlagen der Anleitung sind unabhängig von den Personen, die angeleitet werden. Unterschiede bestehen allein im Ausbildungsstand und in den Inhalten. Inwieweit die Praxisanleiterin weitere Gruppen in der Einrichtung anleitet (wie z. B. neue Mitarbeiter oder Pflegekräfte), entscheidet der Träger der Einrichtung.

Erstellen Sie eine Stellenbeschreibung für die Praxisanleitung
• Sorgen Sie für die Entwicklung einer Stellenbeschreibung für die Funktion der Praxisanleitung. In ihr werden organisatorische Regelungen schriftlich festgelegt und aufbau- sowie ablauforganisatorische Aspekte beschrieben. Dazu gehören:
– Bezeichnung der Stelle, Zielsetzung der Stelle,
– Beschreibung der Stelle und ihrer Aufgaben,
– Anforderungen an die Stelleninhaberin,
– unmittelbare Vorgesetzte und unmittelbar Unterstellte der Stelle (Organigramm),
– Regelung der Vertretung, Befugnisse,
– Regeln der Zusammenarbeit, Beziehungen nach außen.
Eine solche Stellenbeschreibung macht transparent, wie die Praxisanleiterin im Organisationsgefüge eingeordnet ist.
• Formulieren Sie Kriterien zur Qualität der Praxisanleitung ausgehend vom Leitbild der Einrichtung und vom Pflegeleitbild.
• Klären Sie mit Ihrer Pflegedienstleitung, ob und in welcher Weise eine Dokumentation der Zeit, die für die Anleitung benötigt wird, dazu beitragen kann, zu verbindlichen Regelungen hinsichtlich des zeitlichen Rahmens zu kommen.
2. Tipp: Denken Sie an die Aufgaben der Praxisanleitung
Praxisanleitung ist die systematische und zielgerichtete Anleitung am jeweiligen Einsatzort. Dabei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der die Lernenden an pflegerisches Handeln heranführt. Die Lernerfordernisse des Lernorts Schule und die Angebote des Lernorts Praxis sind aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise entsteht eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Das Ausbildungsziel besteht darin, die zukünftigen Fachkräfte zu professioneller Pflege zu befähigen. Zu den Bereichen der Praxisanleitung gehören insbesondere:
• Einführung in die konkrete Pflegepraxis
• Zusammenführung von theoretischen Inhalten und praktischer Tätigkeit
• Entwicklung einer personen- und prozessorientiert gestalteten Pflege
• Begleitung der individuellen Lernerfahrungen der Auszubildenden
• Mitwirkung bei der Bewertung fachpraktischer Leistungen
• Pflege des Kontaktes mit dem Lernort Schule
Mit einer auf solche Weise konzipierten Praxisanleitung sind folgende Aufgaben verbunden:
• Anleitung organisieren (z. B. Mitwirkung bei der Erstellung des Ausbildungsplanes, Festlegen von gezielten Anleitungen unter Berücksichtigung der personellen Situation),
• Anleiten, Beraten und Gespräche führen (z. B. Einführung in die Einrichtung, praktische Anleitung im Pflegealltag, Lernberatung im Blick auf die praktische Ausbildung),
• Begleiten und fördern (z. B. die Auszubildenden dort abholen, wo sie »stehen«: Wenn man von den Auszubildenden ausgeht, unterstützt und fördert dies die persönliche Entwicklung),
• Kooperieren und kommunizieren (z. B. am Lernort Praxis mit den Teammitgliedern, am Lernort Schule mit den Dozenten und der Leitung),
• Beobachten und beurteilen (z. B. Beobachtung der Lernfortschritte, Anregungen zur wechselseitigen Reflexion geben, Bescheinigungen und Beurteilungen erstellen).
Dieses Aufgabenprofil erfordert bestimmte Kompetenzen, um eine qualitativ gute Praxisanleitung gestalten zu können:
• Fachkompetenz umfasst Kenntnisse, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Blick auf Pflege, den Anleitungsprozess und die Evaluation.
• Kommunikative Kompetenz bedeutet: mit Auszubildenden im Team, mit Dozenten der Ausbildung situationsgerecht auf der Grundlage von Akzeptanz, Wertschätzung und Echtheit Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren sowie Beobachtungen wertfrei zu formulieren und die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen.
• Soziale Kompetenzen sind: Offenheit, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen, Team- und Konfliktfähigkeit.
• Methodenkompetenz bedeutet, die Anleitung zielgerichtet und systematisch, aber auch prozesshaft zu gestalten.

Anregungen
• Sie haben die Aufgabe der Praxisanleitung neu übernommen, in Ihrer Praxisanleitung treten schwierige Situationen auf oder Sie möchten eine neue Konzeption für Ihre Anleitung entwickeln oder… Für solche Situationen lohnt es sich, mit anderen Kollegen gemeinsam die anstehenden Fragen zu reflektieren und zu beraten. Das schafft Zufriedenheit und trägt zur Qualität der Arbeit bei.
• Für eine solche Beratung, in der sich Kollegen gegenseitig beraten, empfiehlt sich das strukturierte Vorgehen, wie es die Arbeitsform der Kollegialen Beratung beinhaltet: Einbringen einer Situation – Rückfragen aus der Gruppe beantworten – die Situation durch die Gruppe beraten lassen – jedes Gruppenmitglied formuliert einen Lösungsweg – die problemeinbringende Person bezieht Stellung zur Beratung durch die Gruppe – Feedback aller an der Beratung beteiligten Personen.
3. Tipp: Organisieren Sie die Anleitung
Eine kontinuierliche Praxisanleitung erfordert ein planvolles Vorgehen. Dies ist in Kooperation mit der Leitung der Station zu gestalten. Dabei sind folgende Aspekte zu bedenken:
(1) Im Blick auf die Rahmenbedingungen
• Wie viel Zeit steht für die Praxisanleitung zur Verfügung?
• Wie viele Auszubildende sind anzuleiten?
• Welche räumlichen Gegebenheiten sind für die Durchführung von Gesprächen vorhanden?
• Wie ist die Vertretungsfrage bei Abwesenheit/Verhinderung (Krankheit, Urlaub) geregelt?
• Welche Unterstützung kann das Team der Praxisberaterin geben?
• Sind die Patienten/Bewohner der Einrichtung für die Anleitung geeignet und geben sie ihr Einverständnis?
(2) Im Blick auf das Ausbildungsangebot
Grundlage für die praktische Ausbildung ist der Ausbildungsplan. Jede Einrichtung hat einen solchen Plan zu erstellen. Die Inhalte richten sich nach der geltenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. In thematischer Hinsicht ist u. a. zu klären:
• Was soll gelernt werden?
• Welche Lernmöglichkeiten bietet die Einrichtung?
• Welche Lernaufgaben können gestellt werden?

Anregungen
• Reflektieren Sie vor Beginn der Anleitung die einzelnen Bereiche und stellen Sie die Aufgaben zusammen, die sich daraus ergeben.
• Teilen Sie das Ergebnis Ihrer Überlegungen der Pflegedienstleitung mit und klären Sie mit ihr verbindlich das weitere Vorgehen.
4. Tipp: Fördern Sie die Motivation
Auf eine kurze Formel gebracht bedeutet Motivation: »Ich will!« Es ist in der Regel davon auszugehen, dass jeder Mensch den Wunsch hat, etwas zu gestalten, auszuprobieren und/oder zu bewirken. Die Kraft, »etwas zu wollen« ist allerdings von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Die Beweggründe für das Handeln von Menschen sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Die Fragen nach dem »Was« und »Warum« beschreiben die »spezifische Motivation«. Diese ist bei jedem Menschen individuell ausgeprägt.
Bei den Auszubildenden kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass sie den Beruf aus Eigenmotivation gewählt haben. Es gibt unterschiedliche Motive für den gewählten Weg. Die Motivation bei der Ausbildung wird nicht zuletzt durch folgende zwei Faktoren beeinflusst:
• Die Auszubildende selbst mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Einstellungen. Diese Motivation ist eigen gesteuert und kommt von innen (intrinsische Motivation).
• Die äußeren Rahmenbedingungen: die Pflegeeinrichtung mit ihren Bedingungen, der sich die Auszubildende gegenübersieht (extrinsische Motivation).
Anregungen
• Tragen Sie dazu bei, dass die Auszubildenden von Ihnen, aber auch durch das Team und seitens der Bewohner/Patienten Anerkennung bekommen.
• Sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Einrichtung eine »Kultur der Anerkennung « gelebt wird.
• Geben Sie den Auszubildenden zu ihren Lernfortschritten, ihren positiven Verhaltensweisen und ihrer Einsatzbereitschaft ein Feedback.
• Teilen Sie den Auszubildenden aber auch mit, wenn Sie etwas von ihnen gelernt haben.
• Vermeiden Sie, dass sich Über- oder Unterforderung in Anleitungssituationen einstellen. Eine solche Erfahrung kann zur inneren Kündigung führen.
• Bedenken Sie die unterschiedlichen Profile der Generationen ( Kap. 9.2)
Kap. 9.2)
Durch das Lernangebot, durch Anerkennung und Kritik beeinflusst die Anleiterin die Lernbereitschaft und die Lernmöglichkeiten. Wo eine gute Beziehung vorhanden ist, kann sich das Lernen zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen entwickeln.
5. Tipp: Entwickeln Sie Organisationshilfen
Organisationshilfen sind »Instrumente«, mit deren Hilfe die Anleitung unterstützt und vereinfacht werden kann. Vier Instrumente werden im Folgenden beschrieben:
(1) Handbuch für die praktische Ausbildung
Ein Handbuch ist ein Leitfaden für die Auszubildenden, die Praxisanleiterin und die Fachlehrerin. Ein solcher Leitfaden enthält Informationen, Unterlagen und Formulare, die für die praktische Ausbildung erforderlich sind. Der Aufbau eines solchen Handbuches sollte flexibel gestaltet sein, um auf veränderte Anforderungen reagieren zu können.
Mögliche Inhalte sind: Plan der praktischen Ausbildung, Nachweis der Praxisbesuche, Ausbildungsplan, Ausbildungsnachweis, Protokolle und Bescheinigungen, Beurteilungsbögen, Checklisten, Lernaufgaben. Völkel (2005) hat die Inhalte eines solchen Praxishandbuches ausführlich dargestellt.
(2) Treffpunkt für Anleiterinnen
Da mehrere Mitarbeiterinnen an der Anleitung in den Einrichtungen beteiligt sind, sollte ein regelmäßiger Austausch zwischen den Anleiterinnen stattfinden. Ziel dieses Austausches ist es, jede Auszubildende mit ihren Stärken und Schwächen im Blick zu behalten. Im gemeinsamen Gespräch werden Lernfortschritte, Defizite und der Gesamteindruck besprochen und (stichwortartig) schriftlich festgehalten.
(3) Bibliothek in der Einrichtung
Es ist sinnvoll, wenn in jeder Einrichtung eine kleine Bibliothek mit Standardliteratur und Fachzeitschriften des Fachgebietes vorhanden ist. Diese ist für alle Mitarbeitenden zugänglich. Beim Erstgespräch wird die Auszubildende auf die Bibliothek aufmerksam gemacht. Es wird ihr nahe gelegt, dieses Angebot zu nutzen. Diese Bibliothek kann während der praktischen Ausbildung zur selbstständigen Erarbeitung von Arbeitsaufgaben benutzt werden.
(4) Arbeitskreis für Anleiterinnen
Zur Erarbeitung neuer Fragestellungen und Inhalte sowie zur Weiterentwicklung der Praxisanleitung ist es hilfreich, in der Region/Stadt einen Arbeitskreis für Praxisanleiterinnen zu bilden. Die Häufigkeit und Dauer der Treffen eines solchen Arbeitskreises werden sich am jeweiligen Bedarf orientieren. Sinnvoll ist es, den Ablauf solcher Treffen nach verabredeten Gesichtspunkten zu organisieren. Die Vorbereitung der Zusammenkünfte kann nach dem Rotationsprinzip erfolgen.
________________
1 Zu den Veränderungen ab 2020  Kap. 9.1
Kap. 9.1
6. Tipp: Klären Sie die Erwartungen
Die Situation der Anzuleitenden stellt sich ganz unterschiedlich dar. Auszubildende unterscheiden sich nach Herkunft, Alter, schulischem Werdegang, Ausbildungsstand und Lebenserfahrungen. Daraus ergibt sich, dass sie mit unterschiedlichen Erwartungen in die Einrichtungen kommen.
Befragt man die Auszubildenden nach ihren Erwartungen an die Praxisanleiterin, erhält man Antworten der folgenden Art:
• Man erwartet pädagogische und fachliche Kompetenz.
• Es soll ausreichend Zeit für die Anleitung vorhanden sein.
• Sie soll Freude und Interesse an der Anleitung und an der Arbeit haben.
Darüber hinaus soll die Anleiterin freundlich und offen, einfühlsam, geistig flexibel und humorvoll sein. Diese Erwartungen beziehen sich zum einen auf die persönliche Seite und zum anderen auf die pflegerische Tätigkeit der Anleiterin.
Die Auszubildenden erwarten generell, dass sie
• als Mensch mit den jeweiligen Fähigkeiten und Schwächen angenommen und integriert werden,
• klare Auskunft darüber erhalten, was von ihnen erwartet wird,
• Informationen über die Rahmenbedingungen erhalten,
• ihrem Ausbildungsstand entsprechend angeleitet werden,
• in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden,
• Rückmeldungen zu ihren persönlichen Fortschritten erhalten.
Zur Vorbereitung auf den Anleitungsprozess sind nicht allein die Absprachen und die Planung in der Einrichtung wichtig. Ebenso notwendig ist es, auch die eigene Einstellung zu den Auszubildenden mitsamt ihren Erwartungen zu bedenken.
Es kann hilfreich sein, sich im Vorfeld folgende Fragen zu stellen:
• Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie selbst an die Auszubildenden?
• Was vermuten Sie: Welche Erwartungen und Wünsche hat jemand, der angeleitet wird, an Sie, die Sie für die Anleitung zuständig sind?
Zu beiden Fragestellungen lesen Sie bitte  Kap. 9.2. Im Erstgespräch anlässlich der praktischen Ausbildungsphase sollte ein Austausch über die wechselseitigen Erwartungen erfolgen. Dies trägt zur Transparenz des Anleitungsprozesses und zu einer wechselseitigen realistischen Wahrnehmung bei.
Kap. 9.2. Im Erstgespräch anlässlich der praktischen Ausbildungsphase sollte ein Austausch über die wechselseitigen Erwartungen erfolgen. Dies trägt zur Transparenz des Anleitungsprozesses und zu einer wechselseitigen realistischen Wahrnehmung bei.
7. Tipp: Machen Sie die Auszubildenden mit ihren Aufgaben und Pflichten vertraut
Neben den persönlichen Erwartungen der Auszubildenden gibt es aber auch Aufgaben, die von ihnen wahrzunehmen sind. Sie haben die Aufgabe, die praktische Ausbildung aktiv mitzugestalten und dabei ihr theoretisches Wissen einzubringen. Dazu gehört u. a., dass sie
• über Inhalte der schulischen Ausbildung und den aktuellen Ausbildungsstand informieren,
• ihre Wünsche im Blick auf die Anleitung formulieren,
• übertragene Aufgaben gewissenhaft ausführen,
• in der Praxis Durchgeführtes nachbereiten,
• Wissenslücken schließen,
• sich auf Gespräche und die Anleitungssituation vorbereiten.
Bestimmte Pflichten ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und den arbeitsrechtlichen Grundlagen. Dazu gehören u. a.:
• Verschwiegenheitspflicht und das Einhalten der Datenschutzbestimmungen,
• übertragene Aufgaben mit Sorgfalt durchführen,
• Arbeitsunfähigkeit entsprechend den Vorschriften unverzüglich anzeigen,
• Unfallverhütungsvorschriften einhalten.
Die praktische Ausbildung baut auf den vorhandenen Kenntnissen der Auszubildenden auf. Das bedeutet aber nicht, dass sie nun über das gesamte Wissen gleich am Anfang verfügen können. Die Anwendung muss vielmehr erst schrittweise erlernt werden.

Anregungen
• Wenn Sie über Aufgaben und Pflichten informieren, achten Sie auf die Einfachheit des Ausdrucks:
– Verwenden Sie kurze Sätze und einen einfachen Satzbau.
– Erklären Sie Fachausdrücke.
– Seien Sie sparsam im Gebrauch von Fremdwörtern.
– Vermeiden Sie überflüssige Erläuterungen.
– Verzichten Sie auf unnötige Wiederholungen.
• Legen Sie dem Gespräch einen roten Faden zugrunde:
– Geben Sie zu Gesprächsbeginn einen Überblick.
– Verwenden Sie zwischendurch strukturierende Hinweise.
– Fassen Sie am Schluss das Wichtigste zusammen.
• Versuchen Sie anschaulich und abwechslungsreich zu formulieren:
– Verwenden Sie Bilder.
– Benutzen Sie Beispiele.
8. Tipp: Sorgen Sie für die Integration der Auszubildenden in das Team
Die Praxisanleiterin ist Mitarbeiterin im Pflegeteam. Während der praktischen Ausbildungsphase gehören die Auszubildenden ebenfalls zum Team. Die Art und Weise, wie man in einem Team miteinander umgeht, wird nicht zuletzt durch die zwischenmenschlichen Beziehungen und die daraus resultierende »Atmosphäre« bestimmt. Wechselseitige Akzeptanz und Wertschätzung spielen dabei eine große Rolle. Dabei ist es wichtig, auf die Einstellungen und Lebensstile der unterschiedlichen Generationen zu achten ( Kap. 9.2). Ist der Umgang miteinander durch Akzeptanz und Wertschätzung bestimmt, so können die Auszubildenden erleben und erfahren, dass
Kap. 9.2). Ist der Umgang miteinander durch Akzeptanz und Wertschätzung bestimmt, so können die Auszubildenden erleben und erfahren, dass
• neue Teammitglieder offen und freundlich aufgenommen werden,
• wechselseitige Erwartungen geklärt werden,
• zum Fragen und zum Beantworten von Fragen aufgefordert wird,
• auch die Vorschläge und Beiträge von Auszubildenden aufgenommen werden,
• Stärken genannt werden können und auf Probleme eingegangen wird,
• Lob und Anerkennung ausgesprochen werden,
• auch kritische Aussagen gemacht werden können,
• Arbeitsaufträge den Fähigkeiten entsprechend erteilt werden.
All dies führt zu einem positiven Lernklima, in dem die Auszubildenden leichter lernen können. Herrschen im Team dagegen Konflikte vor, so hat das negative Auswirkungen auf die Lernsituation. Es ist allerdings nicht die Aufgabe der Praxisanleiterin, sondern der Pflegedienstleitung, für eine gute Zusammenarbeit im Team Sorge zu tragen. Damit die Auszubildenden sich von Anfang an im Team gut aufgenommen und integriert fühlen, ist es für sie wichtig zu wissen, was das Team von ihnen erwartet.
Anregungen
• Nehmen Sie sich in einer Dienstbesprechung des Teams etwas Zeit und sammeln Sie die Erwartungen, die das Team an die Auszubildenden hat.
• Reflektieren Sie die einzelnen Erwartungen unter der Fragestellung, wie angemessen und wichtig oder evtl. auch unangemessen sie sind, und entscheiden sie dann, welche Erwartungen Sie an die Auszubildenden weitergeben wollen.
• Formulieren Sie die Erwartungen schriftlich, um Missverständnissen vorzubeugen.
• Im Erstgespräch kann die Anleiterin diese Erwartungen mit den neuen Auszubildenden besprechen.
• Regen Sie die Auszubildenden an, ihre Erwartungen an das Team zu formulieren.
9. Tipp: Machen Sie sich mit den Grundlagen des Lernfeldkonzepts vertraut
Durch die Anforderungen in der Arbeitswelt (Flexibilität, Effektivität und Anpassung an veränderte Arbeitsformen) hat sich ein grundlegender Strukturwandel vollzogen. Diese Anforderungen machen eine entsprechende Veränderung in der Berufsausbildung nötig. Mit dem Lernfeldkonzept wird auf diese Situation reagiert.
Dieses Konzept, das auch für die Pflegeausbildung relevant wurde, beruht auf der »Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz« von 2011. Danach besteht das Leitziel der beruflichen Ausbildung darin, Handlungskompetenzen zu vermitteln. Um dieses Ausbildungsziel zu erreichen, ist es nicht ausreichend, einzelne Tätigkeiten und Krankheitsbilder bzw. einzelne Fächer isoliert voneinander im Unterricht zu behandeln und zu erlernen. Eine isolierte, additive Form der Vermittlung des Fachwissens ist nur unzureichend geeignet, um in der beruflichen Praxis Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen.
Diesem Konzept entspricht eine Lernform, die bei den Interessen der Auszubildenden ansetzt und zu einer selbstständigen Bewältigung von komplexen beruflichen Lernsituationen in der Praxis führt. Die erforderlichen Inhalte zur Bewältigung einer Lernsituation werden dabei durch ein fächerübergreifendes und vernetztes Lernen erworben.
In der Ausarbeitung des Lernfeldkonzeptes für die altenpflegerische Ausbildung werden als Grundlage vier Lernbereiche (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 2002, Anlage 1) benannt:
(1) Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege.
(2) Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung.
(3) Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit.
(4) Altenpflege als Beruf.
Diesen vier Lernbereichen sind 14 Lernfelder zugeordnet:
(1) Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
• theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen
• Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren
• alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen
• anleiten, beraten und Gespräche führen
• bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken
(2) Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung
• Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen
• alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung unterstützen
• alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbst organisierten Aktivitäten unterstützen
(3) Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit
• institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen
• an qualitätssichernden Maßnahmen in der Altenpflege mitwirken
(4) Altenpflege als Beruf
• berufliches Selbstverständnis entwickeln
• Lernen lernen
• mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen umgehen
• die eigene Gesundheit erhalten und fördern
Lernsituationen und Lernaufgaben
Zu den vier Lernbereichen und den 14 Lernfeldern kommen die einzelnen Lernsituationen, die in Zusammenarbeit zwischen Schule und Einrichtung entwickelt werden. In diesen Lernsituationen können die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen gelernt, eingeübt und reflektiert werden.
Durch Lernaufgaben werden Lernsituationen bearbeitet und entsprechende Kompetenzen vermittelt und eingeübt. Manches wird durch bloßes Zusehen wahrgenommen und so auf dem Wege der Imitation gelernt. Das Lernen durch Nachahmung ist eine wichtige Form menschlichen Lernens. In unserem Leben lernen wir vieles – so nebenbei – auf dem Wege der Imitation. Die Praxisanleiterin sollte sich dessen bewusst sein: Alles, was sie tut, ist ein Lernmodell für die Auszubildenden auch ihre Handlungsweisen außerhalb der gezielten Anleitungssituation haben Vorbildcharakter für die Auszubildenden.
Bei der Ausbildung kann man es aber nicht dem Zufall überlassen, dass etwas gelernt wird – oder nicht. Deshalb kann es nicht nur um ein bloßes Zusehen gehen, sondern um eine zielorientierte Beobachtung. Diese macht aber eine klare Aufgabenstellung für die beobachtenden Auszubildenden notwendig.
Anregungen
Formulieren Sie für die gezielte Beobachtung einer Situation eine Aufgabenstellung und werten Sie diese anschließend mit den Auszubildenden aus. So kann es durch eine »zufällige« Beobachtung zu einer aktiven Mitarbeit der Auszubildenden an der Lernsituation kommen.
10. Tipp: Arbeiten Sie mit dem Lernort »Schule« zusammen
Zu den Aufgaben der Praxisanleiterin gehört es, den Kontakt mit der Einrichtung, z. B. Altenpflegeschule, zu halten (§ 2 (2) AltPflAPrV). Der Lernort Schule und der Lernort Praxis sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Ausbildungsziele erreicht werden. Dazu sind der Unterricht, z. B. in den Altenpflegeschulen, und die praktische Ausbildung inhaltlich aufeinander abzustimmen.
• Die Schule erstellt die jeweilige Ausbildungsplanung und ist zuständig für die Abstimmung der Lernangebote im Rahmen der Ausbildung.
• Die Verantwortlichen am Lernort Praxis entwickeln einen Ausbildungsplan als Grundlage der praktischen Ausbildung.
Das erfordert einen kontinuierlichen und intensiven Austausch aller am Ausbildungsprozess Beteiligten. Daher ist die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den kooperierenden Einrichtungen mit ihren jeweiligen Praxisfeldern ausgesprochen wichtig. Nur so kann der Ausbildungsordnung angemessen Rechnung getragen werden, in der es z. B. heißt: »Die Altenpflegeschule stellt durch die Lehrkräfte für die Zeit der praktischen Ausbildung die Praxisbegleitung der Auszubildenden in den Einrichtungen sicher. Aufgabe der Lehrkräfte ist es, die Auszubildenden durch begleitende Besuche in den Einrichtungen zu betreuen und zu beurteilen sowie die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter zu beraten« (§ 2 (3) AltPflAPrV).
Die Praxisbegleitung erfordert die Anwesenheit der Lehrenden vor Ort, um die Theorie-Praxis-Verknüpfung im direkten Gespräch mit der Pflegepraxis zu entwickeln. Die Fachlehrerinnen der Schule erstellen Lernaufträge und geben Projektaufgaben bzw. Arbeitsaufträge für den Praxisbesuch.
So heißt es z. B.: »Zum Ende eines Ausbildungsjahres erteilt die Altenpflegeschule der Schülerin oder dem Schüler ein Zeugnis über die Leistungen im Unterricht und der praktischen Ausbildung. Die Note für die praktische Ausbildung wird im Einvernehmen mit dem Träger der praktischen Ausbildung festgelegt.« (§ 3 (1) AltPflAPrV)
Die Praxisanleiterin benotet nicht die Leistungen der Auszubildenden. Ihre Beobachtungen und Beurteilungen haben die Funktion von Förderung und Feedback. Sie bringt allerdings auf Grund ihrer Beobachtungen wesentliche Aspekte für die Beurteilung der Auszubildenden ein. Auf diesem Wege kann sie eine wichtige Unterstützung bei der Notengebung sein.

Anregung
Definieren und formulieren Sie die einzelnen Lernsituationen und Lernaufträge gemeinsam mit der Praxisbegleitung der Schule. So entwickelt sich eine gute und effiziente Zusammenarbeit.
11. Tipp: Gestalten Sie die Lernsituationen
Lernsituationen bilden die Grundlage in der theoretischen und praktischen Ausbildung. Sie sind die kleinsten didaktischen Einheiten innerhalb des Lernfeldkonzeptes. Da die Lernsituationen am Ende des Entwicklungsprozesses stehen, ist es wichtig, dass sie die relevanten und wichtigen Prozesse und Aufgaben des Berufes widerspiegeln.
Lernsituationen werden in der Regel mit einem Fallbeispiel verknüpft. So können an einer exemplarischen Situation (z. B. in einer geplanten Anleitung) Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt und eingeübt werden. Um eine solche Anleitung effektiv gestalten und beurteilen zu können, ist es notwendig, dass die Praxisanleiterin über den aktuellen Ausbildungsstand der einzelnen Auszubildenden informiert ist.
Der praktische Teil der Ausbildung bezieht sich gemäß der Ausbildungsund Prüfungsverordnung auf die Lernbereiche »Aufgaben und Konzepte der Altenpflege« (Lernbereich 1) und »Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung« (Lernbereich 2). Diesen Lernbereichen sind Lernfelder zugeordnet ( 9. Tipp: Machen Sie sich mit den Grundlagen des Lernfeldkonzepts vertraut). Diesen Lernfeldern können Ziele für die Praxis zugeordnet werden. Dazu sind nun Pflegesituationen, die in der Einrichtung vorkommen, für die Anleitung und Prüfung zu entwickeln.
9. Tipp: Machen Sie sich mit den Grundlagen des Lernfeldkonzepts vertraut). Diesen Lernfeldern können Ziele für die Praxis zugeordnet werden. Dazu sind nun Pflegesituationen, die in der Einrichtung vorkommen, für die Anleitung und Prüfung zu entwickeln.
Beispiel
An einem Beispiel aus dem ersten Lernbereich soll dies verdeutlicht werden (vgl. Völkel 2005, S. 120 f.):
Lernbereich 1: Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege.
Lernfeld 1.1: Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen.
Ein Ziel für diesen Bereich kann sein: »Die Auszubildende kennt das in der Einrichtung angewandte Pflegemodell und richtet das Handeln in den individuellen Pflegesituationen danach aus.« Es geht um die Pflegesituation »Unterstützung alter Menschen bei der Selbstpflege: z. B. sich Mund und Zähne pflegen können.«
Die Erarbeitung der Lernsituation kann in folgenden Schritten erfolgen:
• Die Praxisanleiterin gibt einen Lernauftrag.
• Die Auszubildende überprüft anhand vorgegebener Kriterien allein oder mit Unterstützung der Praxisanleiterin ihre Kenntnisse und ihr Wissen zum Lernauftrag.
• Das fehlende Wissen wird von der Auszubildenden selbstständig erarbeitet.
• Das Ergebnis wird anhand eines Protokolls oder einer Checkliste dokumentiert.
• Das Protokoll bzw. die Checkliste wird im Praxishandbuch der Auszubildenden im jeweiligen Ausbildungsjahr abgeheftet.

Anregungen
• Die Inhalte der praktischen Ausbildung sind durch die Lernbereiche und Lernfelder in den Ausbildungsbestimmungen in grober Form vorgegeben. Erstellen Sie in Anlehnung an den Ausbildungsplan für Ihre Einrichtung eine Checkliste von Lernsituationen.
• Ordnen Sie der Lernsituationen-Checkliste folgende Angaben zu:
– Welches Wissen ist dazu notwendig?
– Welche Lernaufträge können formuliert werden?
– Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen können die Auszubildenden dadurch entwickeln?
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842689688
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (Februar)
- Schlagworte
- Altenpflege Lernmaterialien Pflegemanagement & -planung Medizin