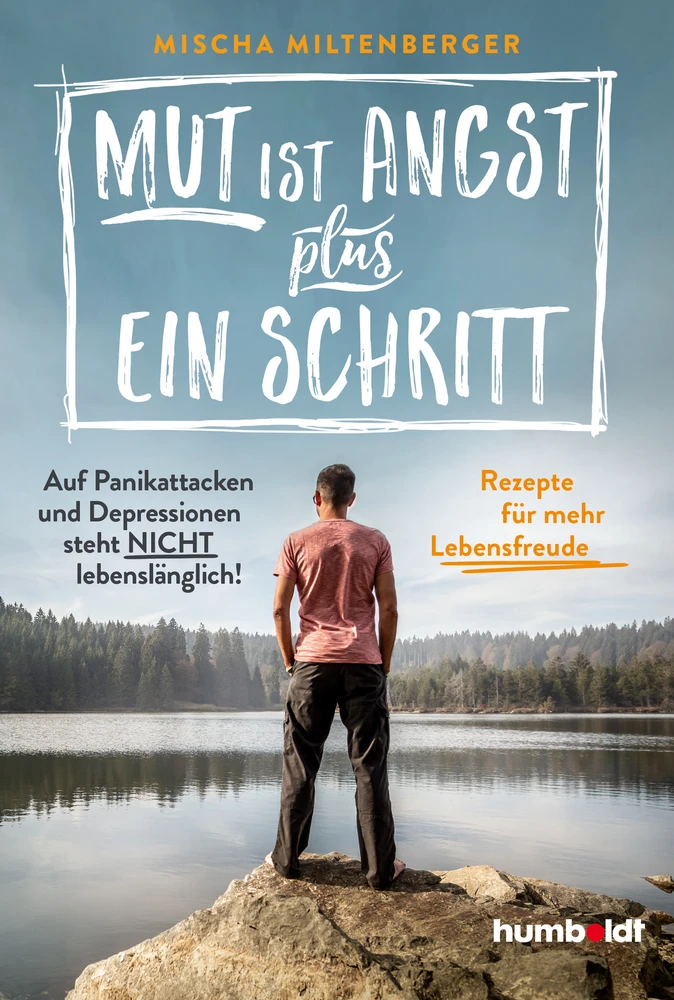Zusammenfassung
„Mut ist Angst plus ein Schritt“ ist die Antwort auf die entscheidende Frage in Mischa Miltenbergers Leben: Wie schafft man nach 20 Jahren mit Panikattacken und depressiven Episoden die Kehrtwende? Wie findet man zu einem mutigen, freudvollen und selbstbestimmten Leben? Und stimmt es wirklich, dass auf Angst und Depression nicht lebenslänglich steht? Heute ist Mischa Miltenberger Coach und Seminarleiter – doch es ist noch gar nicht lange her, da bedeutete jeder Tag für ihn ein Ritt durch die Hölle: von Panikattacken bis hin zum totalen Zusammenbruch. In seinem Buch erzählt er von seinem Kampf, dem Tag der Erlösung und wie er sich seitdem seinen Ängsten entgegenstellt und sein Leben mutig und selbstbestimmt gestaltet.
Rezepte für ein mutiges Leben
Ein Geheimrezept gegen die Angst gibt es nicht. Deshalb enthält Mischa Miltenbergers Buch keine Wissensvermittlung, keine Konzepte, Tools oder Therapiemethoden. Stattdessen berichtet er schonungslos ehrlich und mit viel Humor von seinen Erfahrungen. Die 15 Rezepte für ein mutiges Leben haben ihm dabei geholfen, seine Gedanken und Verhaltensweisen zu hinterfragen. Mit ihnen will er seine Leser inspirieren, das Leben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und Lebensfreude, Leichtigkeit und Neugier wiederzuentdecken. Sein Buch ist ein Weckruf, nicht mehr vor den eigenen Ängsten davonzulaufen – und gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Leben.
Aus dem Inhalt:
• Übernimm Eigenverantwortung und triff eine klare Entscheidung
• Bring deinen Körper in Bewegung
• Werde still
• Fühl deine Gefühle
• Sei du selbst
• Lass dir helfen
• Trau dich, hinter deine größte Angst zu schauen
• Mach dein Ding und lebe nach deinen regeln
• Mut ist ein Muskel, der sich trainieren lässt
• Die Welt braucht jeden Mutigen
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis

Das Mutigste, was wir im Leben tun können, ist authentisch zu sein und uns in all unserer Verletzlichkeit zu zeigen.

Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich liebe diesen Satz. Er gibt die perfekte Antwort auf die entscheidenden Fragen meines Lebens: Wie ist es mir gelungen, nach mehr als 20 Jahren mit Panikattacken und mehreren depressiven Episoden die Kehrtwende hinzulegen? Wie komme ich angesichts dieser Vorgeschichte dazu, heute ein mutiges, freudvolles und selbstbestimmtes Leben zu führen? Und stimmt es wirklich, dass auf Angst und Depression nicht lebenslänglich steht, wie ich immer frech behaupte?
Hätte mir Anfang 2013 jemand prophezeit, ich wäre rund fünfeinhalb Jahre später ein erfolgreicher Coach und Seminarleiter, der von einem Verlag gebeten wird, über sein ungewöhnliches Leben zu schreiben: Diesen Menschen hätte ich sanft darum gebeten, sich mal verstärkt Gedanken um seine Zurechnungsfähigkeit zu machen. Damals bedeutete jeder einzelne Tag für mich ein Ritt durch die Hölle. Tag und Nacht nur noch Panik. Ein langer, aussichtsloser Kampf bis zum Zusammenbruch – gleichzeitig der Tag der Erlösung und des Erwachens. Zum Glück fiel der Aufprall nach dem langen Sturzflug so heftig aus, dass ein „Weiter so“ nicht mehr möglich war. Seitdem besteht mein einziger Auftrag darin, mich, das Leben und die Welt aus völlig neuen Blickwinkeln zu entdecken. Ehrlich und schonungslos hinzuschauen: Was habe ich all die Jahre getan oder nicht getan, dass es so weit kommen konnte? Und was ist bitte schön los in unserem Land, in dem es laut fachärztlichen Statistiken über zehn Millionen Menschen mit diagnostizierten Angsterkrankungen gibt? Rund jeder sechste Erwachsene kennt das Thema aus eigenem schmerzhaftem Erleben. Dazu kommen nach einer WHO-Schätzung noch über vier Millionen Menschen mit Depression in Deutschland. Was läuft hier – genauso wie in vielen anderen reichen westlichen Industrienationen – so schief, dass psychische Leiden zu Volkskrankheiten geworden sind?
Meine Antwort: Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, wie sich echtes Leben anfühlt. Sie tun alles dafür, Gefahren zu minimieren. Igeln sich in ihrer Komfortzone ein. Sind erstarrt in ihrem Korsett aus vermeintlicher Sicherheit und Kontrolle. Egal ob in der Beziehung, im Umgang mit anderen Menschen, im Job und bei so vielen anderen Themen: Bitte nur kein Risiko! So funktionieren die meisten Menschen vor sich hin. Erzählen und machen das nach, was ihnen von Eltern, Lehrern und den Medien eingetrichtert wurde. Doch wenn ein Mensch wie eine gut programmierte Maschine funktioniert und nicht weiß, wofür er genau genommen auf dieser Erde ist, dann muss das auf Dauer Einfluss auf seine Psyche haben. Für diese Feststellung brauche ich kein Psychologiestudium. Da reichen mir meine eigene Geschichte, der tägliche Gang über unsere Straßen und die Gespräche mit anderen Menschen.
Wer traut sich denn, mal einen ehrlichen Blick aufs eigene Leben zu werfen? Sich zu fragen: Lebe ich wirklich? Oder werde ich gelebt? Was macht mich lebendig, bringt mein Herz zum Leuchten? Und wer ist dann noch mutig genug, die eigenen, ungeschönten Antworten darauf in Empfang zu nehmen – jenseits aller Ausreden und Programmierungen?
Wenn wir mal ehrlich sind: Es ist nicht die Angst vor der Angst, die Menschen belastet. Es ist auch nicht die Angst vor dem Tod. Es ist die Angst vor dem echten Leben. Die Angst, sich hinzustellen, seinen eigenen Weg zu gehen. Sich authentisch mit allen Facetten zu zeigen, die zu einem gehören. Seine eigene Wahrheit herauszufinden. Ungewöhnlich zu sein, aufzufallen, Wagnisse einzugehen – selbst wenn das gesamte Umfeld laut aufschreit.
Angesichts unserer angstgeprägten Gesellschaft bleibt uns also gar nichts anderes übrig, als der Angst eine völlig neue Bedeutung zuzuweisen. Wegschauen, Verdrängen, Weglaufen und Betäuben funktionieren nicht mehr. Was wäre, wenn wir die Angst als Chance sähen? Als fantastischen Hinweisgeber unseres Körpers, der uns sagt: „Okay, meine sanften Signale der vergangenen Jahre wolltest du nicht hören. Jetzt musste ich leider die dicke Keule auspacken.“ Und der damit endlich die Möglichkeit bietet, unser Leben, unsere Gedanken, Einstellungen und Verhaltensweisen offen und ehrlich zu hinterfragen. Nicht mit dem Verstand. Denn wir können das Problem nicht auf derselben Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Sondern mit dem Blick nach innen. Dem Hineinspüren. Der Zugang zu den eigenen Gefühlen erschließt im Heilungsprozess völlig neue Dimensionen. Meine spannendste Erkenntnis dabei: Hinter meiner größten Angst liegt meine größte Stärke. Verrückt, der Kalenderspruch stimmt tatsächlich!
Ich hatte mein Leben lang vor zwei Dingen eine Heidenangst: vor anderen Menschen zu sprechen und ehrlich über meine Gefühle zu reden. Heute verdiene ich damit mein Geld. Womit bewiesen ist: Krasse Veränderungen im Innen wie im Außen sind möglich, völlig unabhängig von der Ausgangssituation. Den Satz „Wenn etwas nicht funktioniert hat, mach was anders“ habe ich inzwischen fest in meinem System verankert. Das Mantra läuft in Dauerschleife.
Wenn ich daran denke, dass ausgerechnet ich meine Erkenntnisse nun weitergeben darf, muss ich mich öfter mal zwicken. Oder mir kullern ein paar Tränen der Rührung über dieses Wunder herunter. Genau genommen hatte ich mich selbst schon als hoffnungslosen Fall abgeschrieben, der seinen Alltag nur mit Hilfe von Psychopharmaka und Alkohol irgendwie bewältigen kann. Heute weiß ich: Es war nötig, all diese Erfahrungen zu machen, damit ich anderen Menschen helfen kann.
Dieses Buch ist Ratgeber und Nicht-Ratgeber zugleich. Ich sehe es als wichtigste Aufgabe, Menschen zu ihrer eigenen Wahrheit zu führen und ihnen nicht meine als die einzig richtige und wichtige zu verkaufen. Gleichzeitig werde ich hier Lösungsansätze vorstellen, die mein Leben heraus aus der Angst auf ein komplett neues Niveau katapultiert haben. Greif dir aus meiner Geschichte und meinen Tipps nur das heraus, was sich für dich richtig oder schlüssig anfühlt. Es geht nicht darum, mein Leben nachzubauen, sondern die Quintessenz daraus zu verstehen. Meiner Erfahrung nach lernen wir die wichtigsten Dinge des Lebens oft nicht durch Ratschläge, Tools und Methoden, sondern durch die Geschichten anderer Menschen und der damit verbundenen Energie. Deshalb habe ich als Ansprache bewusst das Du gewählt, weil wir damit eine ganz andere Art von Verbindung aufbauen können.
Viel Freude mit diesem besonderen Weckruf! Einer, der möglicherweise an vielen Stellen das hinterfragt, was du bisher geglaubt hast. Ich habe das Buch für dich geschrieben, weil ich weiß, wie viel Mut in dir steckt. Mein größtes Anliegen ist, dich zu ermutigen, aufzuwecken und dich zu ermächtigen, dir das Vertrauen in dich selbst zurückgeben und dich manchmal zu verrückten Dingen anzustiften. Nach der Lektüre hast du zumindest keine Ausrede mehr, wenigstens den ersten kleinen Schritt zu tun.
VOM HASENFUSS ZUM MUTMACHER
Für jeden von uns hält das Leben etwas anderes bereit. Viele Prägungen werden uns schon in der Kindheit mitgegeben, später treffen wir selbst die Entscheidungen, die unseren Lebensweg bestimmen. Wie meine ersten 40 Lebensjahre aussahen, warum ich irgendwann nicht mehr einfach so weitermachen konnte wie bisher, ohne meine psychische Gesundheit dauerhaft zu riskieren, und wie ich aus diesem Sumpf endgültig wieder herauskam, erfährst du in diesem Kapitel.

Was hast du zu verlieren, außer einem langweiligen Leben, das dich krank gemacht hat?

Lange Jahre hatte ich geglaubt, ich sei Opfer der Angst. Da muss doch einer oben auf einer Wolke sitzen, der arme, unschuldige Menschen mit Angst bewirft. Ungerecht ist der Typ auch noch, denn warum trifft er immer die Falschen? Den Gedanken, meine Panik könnte mit frühkindlicher Prägung zu tun haben, konnte ich noch akzeptieren. Aber mit meinem aktuellen Leben als Erwachsener? Was für ein absurder Gedanke! Angst und Depression sind böse Krankheiten, die mich hinterlistig überfallen haben. Davon war ich überzeugt. Zur Rache habe ich sie mit Medikamenten bekämpft.
Erst mit 41 Jahren, nach dem heftigen Erwachen, kam die schmerzhafte Erkenntnis: Meine psychischen Probleme waren keine Strafe Gottes, sondern eine fast schon logische Folge der Summe all meiner Prägungen, Gedanken, Einstellungen, Taten und Nicht-Taten. Dabei geht es nicht um Schuld. Dieses Wort, besser gesagt dieses leidbringende Konzept, habe ich aus meinem Lebensmodell gestrichen. Ich weiß heute, dass ich immer – wie jeder andere Mensch auch – nach meiner besten Option gehandelt habe, die mir in diesem Moment mit meiner damaligen Lebenserfahrung und meinem damaligen Wissen zur Verfügung stand. Gleichzeitig trage ich, spätestens als Erwachsener, die volle Verantwortung für mein Leben.
Somit durfte ich in den vergangenen Jahren viel reflektieren: Wie kam es, dass ich so eine steile Panik-Karriere einschlagen konnte? Und wieso kann ein fröhlicher Mensch schwer depressiv werden? Hier kommen einige Antworten darauf in einem kurzen Überblick meiner ersten vier Lebensjahrzehnte. Garniert mit dem mir eigenen Humor. Ich lache nämlich lieber über mich und meine Besonderheiten, als tief ins Drama einzusteigen.
Rede-Boykott im Kindergarten: 0 bis 10
Meinen ersten Sprung vom Dreimeterbrett wagte ich mit 25 Jahren (und zog mir dabei eine Bänderdehnung zu, aber das nur am Rande). Mehr muss ich zu Mut und Abenteuerlust in meiner Kindheit gar nicht erzählen. Während andere Jungs in Bäumen herumkletterten, übte ich Blockflöte. Während andere Jungs nach Ringen tauchten, gab es für mich Senfbrot am Freibadkiosk. Ich war ein Schisser durch und durch. Ein Hasenfuß von Natur aus, dafür Musterschüler. Meine Abenteuer spielten sich in den Büchern ab, die ich verschlungen habe. Ich war Meister der Theorie. Die Praxis habe ich meist lieber ausgelassen – wobei ein wenig Stuntman-Gen durchaus vorhanden war. Sobald es bei Fahrradausflügen mit der Familie auf einen Kiesweg ging, lag ich schon mit Schürfwunden im Graben. Zur Belohnung gab es das fiese orangefarbene Jod drauf. Wie gemein das brannte! Ich frage mich, ob da eine kleine masochistische Ader bei mir vorhanden ist, weil es mich so regelmäßig hingelegt hat.
Bemerkenswert war auch meine massive Höhenangst. Auf unserem Balkon hielt ich schon als kleines Kind einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zum Geländer ein, um nicht herunterzufallen. Dabei war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal halb so hoch wie die schützenden Holzbalken.
Im ersten Kindergartenjahr verweigerte ich mit vier Jahren jegliche Kommunikation. Es war im Nachbarort. Da gab es einen Jungen, der mich – vorsichtig formuliert – nicht ganz so supertoll behandelt hat. Worauf ich es vorzog, angesichts dieser Mobbinghölle dort nicht mehr zu reden und stattdessen meinen Eltern daheim die Ohren blutig zu quatschen. Worauf diese es vorzogen, mit mir zum Kindertherapeuten zu gehen. Dessen Therapieversuche erwiesen sich als ähnlich erfolgreich wie alle folgenden in den nächsten 35 Jahren. (Die Erlösung kam erst 2013 in der Klinik in Scheidegg: Psychotherapie ist doch nicht komplett sinnfrei – hurra! Doch dazu später.)
Immerhin durfte ich nach einem Jahr den Kindergarten wechseln und aufgrund meiner mobbingbedingten Sprachunlust (offiziell „Entwicklungsverzögerung“) erst mit sieben Jahren in die Schule – was zumindest später den Vorteil hatte, dass ich in der 11. Gymnasiumklasse schon 18 war, Auto fahren und mir meine häufigen Entschuldigungen selbst schreiben durfte.
Was sonst noch war: beide Eltern Lehrer, streng katholisches Elternhaus, Leistungsdruck und jede Menge Streit. Noch Fragen? Wie in unzähligen Filmen gesehen: Vorzeigefamilie nach außen, in der Innenperspektive nicht so richtig fluffig und herzwärmend. Nicht falsch verstehen: Ich liebe meine Eltern, bin ihnen unendlich dankbar und verstehe mich super mit ihnen. Und gleichzeitig nehme ich schon lange kein Blatt mehr vor den Mund, nur aus Angst, jemand könnte mir daraufhin seine Liebe entziehen.
Zuletzt sei noch der Hausarzt erwähnt, der mir mit sechs Jahren bescheinigte: „Mit deinen Platt-, Senk- und Spreizfüßen wirst du in Sport nie eine bessere Note als eine 5 bekommen.“ Eine von vielen ärztlichen Prognosen und Diagnosen, die ich im Laufe meines Lebens mit großer Freude widerlegt habe. Mehr dazu im Verlauf dieses Buchs.
Blinkender Leuchtturm in der Kirche: 10 bis 20
Ängstlichkeit, Schüchternheit, dauerndes Nachdenken über mich und die Welt, häufige Schamgefühle, relativ wenige Freunde und schon gar keine Freundin: ein ziemlich heißes Gemisch für einen Heranwachsenden. Meine Patentlösung dafür hieß Rückzug. Vormittags die Pflichtzeit in der Schule absitzen, nach dem Mittagessen einen Berg Süßigkeiten beim Bäcker kaufen, stundenlang schlafen, abtauchen in Bücher, minimalen Aufwand für die Schule betreiben, um nicht allzu negativ aufzufallen. Und dann endlich wieder schlafen, wenn der Tag herum war. Aufregende Hobbys? Den Block-flötenunterricht hatte ich schon erwähnt. Spannende Abenteuer? Den größten Adrenalinkick gab es bei der täglichen Frage, ob ich mit dem Hausaufgabenabschreiben im Bus und auf der Schultoilette in der ersten Pause rechtzeitig fertig werden und mit welchem Lehrer ich mich diesmal anlegen würde. Diesbezüglich habe ich mein Revoluzzer-Gen voll ausgelebt und hatte lustigerweise vor solchen Konfrontationen niemals Angst.
Rückwirkend betrachtet habe ich über größere Strecken eine Totalverweigerung des Lebens betrieben. Weil ich gar nicht anders konnte. Weil das, was mir alle als „echtes Leben“ vorgespielt haben – viel Vorzeigbares leisten, Druck, Streit und ausgelassene Freude nur unter Alkoholeinfluss –, so surreal war und überhaupt keinen Sinn für mich ergab. Weil es niemanden gab, mit dem der kleine oder inzwischen mittelgroße Mischa über seine massiven Ängste reden konnte. Niemand, der dem sensiblen, nachdenklichen und aufgeweckten Jungen zeigen konnte: „Hey, alles okay. Du bist gut so, wie du bist. Und auch für dich und deine Besonderheit gibt es da draußen in der Welt einen Platz.“ Weit und breit keine Menschen, die anders waren, sein durften und damit glücklich waren. Kein Freak in Sicht, der mich auf den Rücksitz seines orangefarbenen Motorrads gelupft und gesagt hätte: „Die typischen Erwachsenen haben doch alle einen Knall. Wir fahren mal los und ich zeige dir, wie lustig die Welt wirklich sein kann.“
Zu allem Überfluss ging irgendwann die Warnlampe an – und gar nicht mehr aus. Wer mich finden wollte, brauchte einfach nur nach meinem roten Kopf zu schauen. Aufgerufen werden in der Klasse? Blink! Als Ministrant in der Kirche eine Stunde lang 200 Menschen gegenüberstehen? Blink! Blink! Ein Referat halten? Blink! Blink! Blink! Ein Mädchen ansprechen? So viele Blinks haben hier gar nicht Platz. Deshalb ließ ich es meist lieber sein.
Ich fühlte mich oft fehl am Platz, gefangen in Angst und Scham. Dieses Muster hat sich damals so tief bei mir eingebrannt, dass selbst heute – unter komplett anderen Voraussetzungen – immer mal wieder letzte Überbleibsel davon ans Tageslicht kommen. Lampe an, Lampe aus: Diese Besonderheit liebend anzunehmen, fordert mich heraus wie sonst nichts anderes – im selben Maß, wie es an dieser Stelle in die Öffentlichkeit hinauszuposaunen. Dank der heilsamen Wirkung meiner gnadenlosen Offenheit werde ich auch darüber irgendwann schmunzeln und es als weitere Anekdote erzählen können.

Eine Kindheit und Jugend zwischen Kirche, Bierbank und ausgefallenem Hosengeschmack.
Zum Glück trat mit 15 der segensreiche Einfluss des Alkohols in mein Leben. Segensreich meine ich ironisch – mit dem heutigen Wissen, wie sehr die Sauferei meine Angst befeuerte und eine konstruktive Lösung meiner Themen unmöglich machte. Doch damals empfand ich sie tatsächlich als zutiefst segensreich. Wenn der Alkohol nach ein, zwei oder drei Bier so schön angeflutet war, merkte ich zum ersten Mal: Wow, mich gibt’s auch im entspannten Modus. Ausgelassen. Fröhlich. Mutig. Abenteuerlustig. Ohne Schüchternheit. Ohne Angst. Ohne Scham. Ohne Gedankenkarussell. Wo war sie denn hin, diese innere Gefangenschaft, die mich stets zu fesseln schien? Irgendwie stand fest: Das muss mein wahrer Kern sein. So bin ich wirklich. Keine Ahnung, wie ich ohne Alkohol in diesen Zustand kommen soll, doch das ist augenscheinlich die beste Version von mir. Selbst wenn die beste Version jedes Wochenende in irgendwelche Büsche kotzt und tags darauf so einen Kater mit sich herumschleppt, dass der ganze Tag gelaufen ist.
Panik vor der Nüchternheit: 20 bis 30
Abi, Zivildienst, Bewerbung für ein VWL-Studium, viele Partys und mehr Alkohol. Der Wechsel ins neue Lebensjahrzehnt bot bis auf das neue Beschäftigungsfeld wenige Neuerungen. Warum auch? In meiner Wahrnehmung fühlte sich das, was ich tat, nach einer durchaus akzeptablen Lebensform an: weiterhin möglichst geringer Aufwand bei möglichst häufiger Betäubung.
Die Idee, sich im August 1992 am letzten Urlaubstag in Lissabon mit Portwein volllaufen zu lassen und am nächsten Tag stark verkatert in der Raucherzone des Flugzeugs die Heimreise anzutreten, erwies sich allerdings als Bumerang. Gefangen in einem Metallkäfig in zehn Kilometern Höhe servierte mir das Leben meine erste Panikattacke (zumindest die erste bewusst wahrgenommene; heute bin ich mir sicher, auch als Kind schon welche erlebt zu haben). Kalter Schweiß, Herzrasen, Engegefühl in der Brust, zitternde Hände, alles um mich herum verschwimmt, ich bin der Ohnmacht nahe.
Klares Zeichen: Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Dummerweise waren es gleich drei letzte Stündlein, weil sich die Attacke so richtig entfalten und in aller Pracht zeigen wollte. Allen Experten, die behaupten, jede Attacke klinge nach spätestens 15 bis 30 Minuten automatisch ab, erzähle ich gerne von diesem Höllenritt.

Anfang 20: Reiselust, Reisefrust und kurzzeitig sogar lange Haare, mit denen sich lustige Dinge anstellen lassen.
Ach so, ich habe meine drei letzten Stündlein überlebt. Besser fühlte sich das Leben dadurch leider nicht an. Denn ab jetzt galt es aufzupassen und volle Kontrolle zu bewahren, damit so ein Ereignis nie wieder passierte. Meine Taktik: akribisch auf alle Warnzeichen des Körpers zu achten und nur keine Risiken mehr einzugehen. Die Taktik ging überraschenderweise nicht auf. Denn was passiert, wenn der Aktionsradius immer enger wird und das Gehirn die ganze Zeit unwidersprochen „Gefahr!“ rufen darf? Richtig: Panikattacken-Party. Ob Notfallambulanzen in der Uniklinik in Würzburg, im Klinikum Großhadern in München, im Krankenhaus Kaufbeuren oder der hausärztliche Notdienst in Lindau und Landshut (nur um ein paar ausgewählte Beispiele aus mindestens einem Dutzend zu nennen): Ganz schön viele Ärzte durften sich meine Todesangst live ansehen. Und sich darüber freuen, dass sie mich 30 Minuten später ohne Herzinfarktdiagnose wieder entlassen konnten. „Das ist psychosomatisch.“ Für den Satz hätte ich sie würgen können.
Am liebsten hätte ich mir damals ein Zimmer im Krankenhaus gemietet, um in Sicherheit zu sein. Für Auslandsreisen hatte ich einen Joker: Ein befreundeter Rettungssanitäter war nicht nur dabei, sondern übernahm sogar die kompletten Fahrten in seinem Wagen. Was mir wiederum die Möglichkeit für ein paar Bierchen bot, um so richtig entspannt im Süden anzukommen.
Mein VWL-Studium gab es nominell auch noch. Durch meine Psychothemen hatte ich genug Ausreden, um mich vor dem nötigen Aufwand zu drücken. Wobei es den „nötigen Aufwand“ genau genommen nur für die Menschen gab, die glaubten, man müsse ein einmal begonnenes Studium auch zu Ende bringen. Ich glaubte eher, dass a) VWL das langweiligste und freudloseste Studienfach sei, das sich ein Mensch je ausdenken konnte, b) ich sowieso nicht vor 30 in das offizielle Arbeitsleben eintreten wollte, und schon gar nicht in so einem komischem Krawattenjob, und c) ich die Zwischenzeit noch ganz gut mit dem Zelebrieren des Nachtlebens überbrücken könne.
Was mir so gut gelungen ist wie sonst kaum etwas zuvor in meinem Leben. Wenn ich nicht als DJ, Barkeeper oder Hotelnachtwächter jobbte, war ich gern gesehener Gast diverser Clubs und Kneipen Würzburgs. Ist es nicht ein Ritterschlag, wenn einen jede Menge Türsteher mit Vornamen kennen? In der Nacht fühlte ich mich sicher, in meiner Welt, in meinem Metier. Dort, wo Betäubung normal war. Dort, wo die Menschen auch mal ihre Alltagsmasken fallen ließen. Dort, wo sich alle die trafen, denen die Tagwelt suspekt war. Nachts fällt kein so helles Scheinwerferlicht auf deine Ängste. Die Nacht ist perfekt für Hasenfüße, die ein bisschen was vertragen.
Der eingesperrte Revoluzzer: 30 bis 40
Ui, schon 30 – jetzt aber mal volle Kanne rein ins seriöse Leben! Der Übergang ins neue Lebensjahrzehnt ist schnell erzählt: VWL-Studium in Würzburg kurz vor der Exmatrikulation geschmissen, Umzug nach München, um dort zu jobben und an der Fernuni Hagen das Studium (diesmal BWL, was für ein abenteuerlicher Schachzug!) fertigzubringen, meine wundervolle Frau bei einer Millenniumsparty in München kennengelernt (nur mittelstark beschwipst), Start als freier Mitarbeiter bei einer regionalen Tageszeitung in Südbayern. Nach einem Jahr guter Führung sogar die Chance auf ein Volontariat. „Sie sind 30. Das ist Ihre letzte Chance!“, ließ mich der damalige Chef der Lokalredaktion wissen. Was weder er noch ich in dem Moment ahnten: Dieser Satz würde zehn Jahre später eine völlig neue Bedeutung bekommen und mein Leben von Grund auf umkrempeln.
Endlich ein fester Job. Wie geplant mit 30. Ehrlich gesagt hatte ich nicht mehr damit gerechnet, überhaupt in der Arbeitswelt unterzukommen. Und dann auch noch mein Traumjob! Sportredakteur. Runter von der Fantribüne, rauf auf die Pressetribüne. Das zumindest war einer der spannendsten Karrieresprünge, die je im Kaufbeurer Eisstadion vollzogen wurden. Eltern, Verwandte, Freunde – alle zufrieden: Aus dem ewigen Studenten ist ja doch noch was geworden. Mein Ego in Höchstform: „Ja, jetzt gehörst du dazu!“ Meine Seele, anfangs noch ganz leise: „Bist du sicher? Bist du wirklich, wirklich sicher, dass es das ist? Du als geborener Rebell magst jetzt also viel Druck, unbezahlte Überstunden, unberechenbare Chefs, unseliges Konzerngeklüngel und dich mit Kollegen um Urlaube und Brückentage streiten? Dein Traumleben besteht darin, dich häufig zu überarbeiten, dich danach zu Hause völlig fertig aufs Sofa zu werfen und den Rest des Abends Fernsehen zu schauen?
Und dich an den Wochenenden zu betrinken und die restliche Zeit Sport im Fernsehen zu glotzen? Ist ja interessant …“
Für solch unqualifizierte Einwürfe liegt die gewohnte Lösung in meiner Hand: Öffner, Bierflasche, plopp, gluckgluck, Ruhe im Karton. Ich lass mir doch meinen Traumjob nicht madig machen. Okay, anstatt rauszugehen und geile Geschichten zu schreiben, sitze ich 90 Prozent der Zeit an meinem Schreibtisch, bearbeite fremde Texte und baue Zeitungsseiten zusammen. Ich bin top bezahlter Sachbearbeiter für Schützenvereinsartikel, muss nicht annähernd die Grenzen meiner Geniezone ausloten und verkaufe mich weit unter Wert. Ich muss mich in sinnlose Konzernhierarchien einordnen, obwohl alles in mir dagegen aufschreit. Doch deshalb lasse ich mir noch lange nicht meinen Traumjob madig machen!
Meine Seele: „Alles klar, meine sanften Hinweise sind wohl im Stadiongebrüll untergegangen. Ich leg diesmal auf die Panikattacken noch eine schwere Depression drauf. Und jetzt?“ Und jetzt, und jetzt. Es ist Anfang 2004. Ich gebe doch nach nur einem Jahr Berufsleben nicht auf. Für eine schwere Depression gibt es einen Psychiater. Der wiederum hat tolle Psychopharmaka, um die Laune wieder zu heben. Was für ein Segen! Ich brauche gar keinen Alkohol mehr. Meine Betäubung zahlt jetzt die Krankenkasse. Da hätte ich ja früher darauf kommen können. Bei vermehrter Angst und Depression nehme ich eine höhere Dosis, bei weniger Angst und Depression einfach weniger. So einfach ist das, sagt mein Psychiater.
Komisch, trotzdem folgen in den nächsten neun Jahren immer wieder Panikattacken und zwei weitere, schwere depressive Episoden … 40 Jahre lang wollte und konnte ich nicht ehrlich hinschauen. Nach außen hin führte ich spätestens ab 30 ein super Leben. Verheiratet mit einer einfühlsamen und humorvollen Frau, die mir genug Freiheit lässt. Ein sicherer und gut bezahlter Job. Genug Geld für ansehnliche Klamotten, Restaurantbesuche, tolle Wellness-Hotels und mehrere wunderschöne Urlaube pro Jahr. Ein paar gute Freunde, liebe und lustige Arbeitskollegen. Meine neue Leidenschaft „Slow Food“ in einer bunten Truppe von Menschen, denen nachhaltige Lebensmittelproduktion und leckeres, regionales Essen am Herzen liegt. Andere motivierte Menschen, mit denen ich gemeinsam Sportveranstaltungen organisierte oder im Fußballverein ehrenamtlich zusammenarbeitete. Und vielleicht das Wichtigste: mein nie versiegender Humor (außer in den akut depressiven Phasen). Es waren also durchaus gute Jahre dabei, in denen ich dachte, die Wende geschafft zu haben.

Nach außen ein normales Leben als Sportredakteur, der gerne feiern geht. Doch Alkohol und Psychopharmaka hinterlassen körperliche Spuren.
Doch das Grundproblem blieb: Wieso fesseln mich immer wieder Ängste und Depressionen, wenn ich doch eigentlich ein gutes Leben führe? Heute weiß ich: Ich war noch nicht tief genug gefallen, um auch nur ansatzweise zu verstehen, was ich mir selbst tagtäglich antue. Ein Leben, in dem ich mich kaum gespürt habe. Ein Leben, das ich mit meinem Verstand in den Griff bekommen wollte. Ein Leben abgeschnitten von meiner Gefühlswelt. Ein Leben, das sich ohne Alkohol und Medikamente nur selten so richtig lebendig und lebenswert anfühlte. Ein Leben fernab von meinen ursprünglichen Qualitäten und Bedürfnissen.
Dieses Leben ist mir Anfang 2013 um die Ohren geflogen. Aus dem, was nach dem großen Knall übrigblieb, habe ich mir ein neues aufgebaut. Im folgenden Kapitel nehme ich dich mit in die Wendejahre 2012 bis 2014 – von meinen bittersten, schmerzhaftesten Momenten bis zum katapultartigen Neustart.
Freier Fall mit hartem Aufschlag
Endlich die höchste Gehaltsstufe als normaler Redakteur erreicht. Noch mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Noch ein paar Euro mehr, die auf das Festgeldkonto wandern. Dort liegt er, der Traum von einem besseren, anderen Leben. Eine Pension wollten wir aufmachen. Menschen mit all unserer Herzensfreude betreuen, umsorgen, bekochen. Gastgeber spielen, weil meine Frau und ich das richtig gut draufhaben. Doch außer den Sparraten auf dem Konto und ein paar vagen Plänen tut sich nicht viel. Zu erschöpfend die tägliche Tretmühle, zu niedrig unsere Energie, zu wenig Leidensdruck trotz aller Probleme und augenscheinlich zu viel Schmerzensgeld in unseren Jobs.
Die 40er-Party ein rauschendes Fest. Wenn ich etwas kann, dann organisieren, die besten Leute zusammenbringen, feines Essen und leckerste Getränke im Überfluss zur Verfügung stellen. Trinken, tanzen, singen bis in die Morgenstunden.
Doch der Kater will diesmal gar nicht mehr gehen. Mitte des Jahres bekomme ich erste schwere Sehstörungen am Rechner in der Redaktion. Der Kollege, gelernter Pfleger, gibt Entwarnung: zumindest kein Schlaganfall. Das Warnzeichen kommt nun öfter. Dazu eine massive innere Unruhe und das diffuse Gefühl: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht mehr. Der dreiwöchige Trip im Sommer mit Zug, Bus und Auto durch Skandinavien bringt kurzzeitige Erleichterung. Danach startet der rasante Sturzflug.
Ich sitze bei der morgendlichen Redaktionskonferenz. Sechs oder sieben liebe Kollegen, die sich alle gut verstehen. Wir sprechen über die anstehenden Themen des Tages. Mit einem Schlag ist nichts mehr, wie es war. Herzrasen, Schweißausbruch, Zittern. Fuck, jetzt hat mich die Panik sogar im Büro erwischt! Wieso ausgerechnet hier, wo doch alles in Ordnung ist und keine Gefahren drohen? Ich schäme mich so, weil ich nichts mehr unter Kontrolle habe. Der Puls von mindestens 200 lässt mich in Schweiß ausbrechen, riesige Flecken bilden sich unter den Achseln. Was passiert jetzt, wenn alle mitkriegen, was bei mir abgeht? Niemand außer meiner Frau weiß doch von meiner Angstgeschichte. Jetzt werden sie meine langjährige Schauspielerei entlarven und feststellen, dass sie mit so einem Psycho-Heini nicht zusammenarbeiten können. Also reiß dich zusammen, spiel Normalität, in ein paar Minuten bist du in deinem rettenden Einzelbüro!
Super, hat geklappt. Keiner hat was gemerkt oder sich etwas anmerken lassen. Das Spielchen geht die nächsten Wochen und Monate so weiter. Täglich grüßt die Morgenkonferenzpanik, und niemand ahnt, was los ist. Außer einem Kollegen, der mich auf das Zittern anspricht. Von meinem Psychiater und diversen Büchern hatte ich die Kernaussage der Konfrontationstherapie gelernt: Wenn ich mich der angstauslösenden Situation nur oft genug stelle, verschwindet die Angst. Was hiermit widerlegt wäre.
Bei mir wird es schlimmer und schlimmer. Bis ich zum ersten Mal kapituliere und meiner Chefin erzähle, was los ist und dass ich von nun an nicht mehr in die Konferenz gehen kann. Auf eine wichtige Pressekonferenz schicke ich einen Kollegen, weil allein der Gedanke an so viele Menschen und auf mich gerichtete Augen Panik auslöst. Ich schleppe mich täglich in die Arbeit, kämpfe, kämpfe, kämpfe und suche verzweifelt nach dem rettenden Fallschirm. Entspannungstechniken, geführte Traumreisen, Hypnose-Akupunktur, noch mehr Medikamente, noch mehr Alkohol? Ich probiere alles – und nichts hilft mehr. Stattdessen stürze ich endgültig ab. Panik beim Spazierengehen, Panik beim Autofahren, Panik im Supermarkt, Panik in der Arbeit, Panik im Fußballverein. Mein Psychiater rät: Jeden Morgen ein starkes (und extrem schnell süchtig machendes) Beruhigungsmittel nehmen, dann käme ich prima durch den Tag. Ich bin zum Glück trotz der katastrophalen Situation noch klar und innerlich gefestigt genug, um diesen Wahnsinn nicht mitzumachen, und breche die Therapie nach zehn Jahren ab.
17. April 2013. Nichts geht mehr. Der monatelange Sturzflug endet mit einem extrem harten Aufschlag. Ich finde mich wieder am tiefsten Punkt meines Lebens. Nach einer schlaflosen Nacht die erschreckende und erlösende Feststellung zugleich: Ich kann und will nicht mehr kämpfen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich gebe auf.
Die Entscheidung meines Lebens
Der erste Reflex nach dem Zusammenbruch: Ich habe mein Leben komplett verkackt. Als bestmögliche Option für die Zukunft sehe ich mich frühverrentet und vollgepumpt mit Psychopharmaka daheim vor mich hinvegetieren. Oder wenn es ganz schlecht läuft, als Stammgast in der Klapsmühle. Nach einer Beruhigungsspritze meines Hausarztes und dem Nachholen des lang ersehnten, tiefen Schlafs wache ich endlich auf aus dem jahrzehntelangen Dämmerzustand meines Lebens. Obwohl es mir immer noch miserabel geht, ich mich saft- und kraftlos fühle und noch nicht einmal vor die Haustür traue, tauchen plötzlich so viel Klarheit und Lebenswille auf wie nie zuvor. Ein Gefühl von „Diese Katastrophe ist deine Chance. Das kann der Wendepunkt sein.“
Es fällt mir schwer zu erklären, woher diese ungeahnte Energie kam. Vermutlich war sie schon lange in mir und wartete nur auf den entscheidenden Moment, um endlich freigesetzt zu werden. Nämlich den, als ich nichts mehr zu verlieren hatte. Ganz unten am Boden liegend habe ich die Entscheidung getroffen, die mein komplettes Leben umkrempelte: Von nun an stehe ich bzw. steht meine Gesundheit an erster Stelle! Es kann jetzt nur noch besser werden. Und ich werde alles Erdenkliche dafür tun, nie mehr an diesen Punkt zurückzukommen – selbst wenn in meinem Leben kein Stein mehr auf dem anderen bleibt.
Diese unverrückbare Selbstverpflichtung bestimmt seitdem – quasi als Meta-Entscheidung – jede Entscheidung meines Lebens. Die erste logische Konsequenz, die ich damals daraus gezogen habe, war: Ich brauche endlich professionelle therapeutische Hilfe. Und zwar die beste, die es gibt. Ein Jahrzehnt lang hatte mir meine innere Stimme zugeflüstert, mich in eine psychosomatische Klinik einweisen zu lassen. Genauso lang hatte mein Verstand gebrüllt, dass ich danach einen Stempel als Irrer auf der Stirn hätte und nie mehr für voll genommen werden würde. Doch schließlich hatte ich eine Entscheidung getroffen. Die beinhaltete auch: Sendepause für den Verstand, das Bauchgefühl darf nun auch mal auf die große Bühne.
Da ich sowieso kaum Kraft hatte, mich vom Sofa zu bewegen, blieb viel Zeit für Recherchen. Die für mich beste Klinik stand schon nach kurzer Zeit fest: die Panorama Fachklinik in Scheidegg. Das Konzept des damaligen Chefarztes Dr. Christian Dogs, über das er in Interviews sprach, überzeugte mich komplett. Keine Pseudobehandlung, in der es nur darum geht, die Patienten mit Medikamenten irgendwie wieder auf Linie zu bringen und arbeitsfähig zu machen. Sondern Methoden, die mich als Individuum ganzheitlich wahrnehmen und mir neue Wege aufzeigen – und dabei mein volles Mitwirken als Patient fordern, notfalls mithilfe von ziemlich ungewöhnlichen Ansätzen.
Also auf ins Westallgäu! Dachte ich. Bis mein neuer Elan nach einem Anruf in der Klinik einen massiven Dämpfer bekam. Zehn Monate Wartezeit. Puh, den Schock durfte ich erst einmal verdauen. Es gab noch eine andere – in meinen Augen – gute Klinik am Chiemsee, die mich schneller aufgenommen hätte. Doch ich hatte mich für Scheidegg entschieden und wollte wissen, wie es trotzdem funktionieren kann. Eine Privatzuzahlung für die Chefarztbehandlung (rund 80 Euro am Tag) könne den Aufnahmevorgang deutlich beschleunigen, ließ mich die freundliche Sekretärin wissen. Jetzt konnte ich endlich mal anwenden, was ich im BWL-Studium über Investitionen gelernt hatte. Sagte entgegen dem Rat meiner Ärzte („Herr Miltenberger, Sie müssen doch für eine Kassenleistung nichts aus eigener Tasche zahlen!“) zu, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich die nächsten Monate sonst hätte überstehen sollen, und mir meine Gesundheit jeden einzelnen Cent wert war.
Gut eine Woche später brachte mich meine Frau zur Klinik. Wie ich heute weiß: Meine Entscheidung für mich, meine Gesundheit und damit auch für die Klinik in Scheidegg war die beste meines Lebens.
Tanzen bis zum Weinkrampf
„Das ist meine letzte Chance!“ Da war er wieder, der Satz. Diesmal nicht von meinem Vorgesetzten, sondern vom neuen Vorgesetzten meines Lebens: mir selbst. Im Moment der Klinikzusage tauchte mein Mantra für die nächsten Wochen auf. Der Satz war auf einmal da, und mir wurde schlagartig bewusst, wie sehr diese fünf Worte mein Leben verändern würden. Denn diese Vereinbarung mit mir selbst hieß nichts anderes, als mein Versteckspiel zu beenden. In früheren Therapien hatte ich nur das über mich preisgegeben, was unbedingt nötig war. Doch wenn ich diesmal nicht alle Karten auf den Tisch legte, würde ich die Klinikzeit als weiteres Kapitel meiner Selbstverarschung abhaken müssen. Nichts lag mir in dem Moment ferner. Ich hatte mich entschieden und wollte wissen, was mit meinem Leben passiert, wenn ich mich endlich mal ohne Schutzpanzer und Betäubung darauf einlasse.
„Das ist meine letzte Chance!“ hieß zugleich: Ich werde offen und ohne Vorurteile alles mitmachen, was die Therapeuten von mir wollen. Selbst wenn es mir noch so suspekt oder absurd erscheint, selbst wenn ich tierisch Schiss habe oder sich mein Ego massiv dagegen sträubt – und ja, meditatives Gehen mit 0,1 km/h, Maltherapie oder Sexgespräche in der Männerrunde hätten im Vorfeld alle Kategorien erfüllt. Doch die Option „Weglaufen“ kann an dieser Stelle nicht mehr angekreuzt werden.

Zurück ins Leben gekämpft: Der Klinikaufenthalt in Scheidegg zwischen Wutabbau, klarem Fokus und hoffnungsvollen Zeichen der Natur.
So marschierte ich in Scheidegg ein. Mit dem festen Willen, alles aus dieser Zeit herauszuholen, um meinem Leben die entscheidende Wendung zu geben. Und mit dem genauso festen Entschluss, danach nie mehr eine psychosomatische Klinik als Patient zu betreten. Ich wusste, was ich wollte, und hatte zugleich die Hosen gestrichen voll. Wie wohl die anderen Patienten auf einen komischen Typen wie mich reagieren würden? Einen, der seit Wochen kaum mehr unter Menschen war, der sich nicht mehr traute, in der Gesellschaft anderer Menschen zu essen, der vor so gut wie allem Angst hatte? Die Kurzantwort darauf: Die Zeit in der Klinik war voller Wunder. Seitdem hat das Wort wundervoll für mich eine völlig neue Bedeutung.
Erstes Wunder: Ich werde akzeptiert, wie ich bin. Mit all meinen Macken und Ängsten. Mein Therapeut sagt direkt nach der Begrüßung: „Es ist mir völlig egal, welche Diagnose auf Ihrer Einweisung steht. Es ist mir auch völlig egal, was Ihnen Ihre Eltern, Ihre Lehrer oder sonst wer Böses getan haben. Wir kümmern uns in den nächsten Wochen ausschließlich um Ihre Stärken und Ressourcen und schauen, wie sich damit Ihr Leben ändern kann.“ Am liebsten würde ich ihm sofort um den Hals fallen. Zum ersten Mal in meinem Leben muss ich mich nicht mehr schämen, verstecken oder irgendwelche Schwächen loswerden. Ich gehöre dazu. Ich bin ein ganz normaler Verrückter unter all diesen ganz normalen Verrückten. Diesen großartigen, sensiblen Menschen, die so viele ihrer Qualitäten unterdrückt haben, um irgendwie in unserer kranken Gesellschaft mitschwimmen zu können, und dadurch krank wurden. Ich gehöre dazu. Nicht nur das, ich bin in kürzester Zeit superbeliebt und fühle mich sehr willkommen. Soziale Ängste? Ich? Pfff, da muss ein Irrtum vorliegen.
Zweites Wunder: Ich kann mich wieder frei bewegen. Während mein Aktionsradius vorher aus Angst nur noch auf wenige hundert Meter beschränkt war, marschiere ich plötzlich los. Zuerst zwei Kilometer um die Klinik, im Laufe der fünf Wochen immer weiter. Allein. Weil ich es kann. Dazu brauche ich kein zusätzliches Medikament, keine Konfrontationstherapie, keinen Trick. Es reicht aus, dass es mir massiv besser geht, ich mich wohlfühle. Ich fasse wieder Vertrauen ins Leben allein deshalb, weil ich mich so aufgehoben fühle.
Drittes Wunder: Ich spreche vor anderen Menschen. Halte Vorträge. Weil ich Dr. Dogs schon beim ersten Gespräch verraten habe, dass dort meine größte Angst lauert. Also darf ich jetzt einmal pro Woche ran. Vor versammelter Mannschaft. Mit wackligen Beinen, feuchten Achseln, roten Ohren – doch ich tue es! Und es macht sogar Spaß. Ich ernte jede Menge Lacher, großen Applaus und viele Komplimente. Einige Mitpatienten meinen, mit meiner Geschichte gehöre ich auf die Bühne. Keiner von uns ahnte, dass es wenige Jahre später so kommen sollte …
Viertes Wunder: Mein Job passt nicht zu mir. Okay, Wunder hört sich bei dem Thema vielleicht ein bisschen übertrieben an. Doch in der Tat hatte ich in all den Jahren trotz Depression und am Ende monatelanger Panikattacken meine Arbeit als Redakteur nicht in Frage gestellt. Ich wusste zwar schon länger, dass ich ihn definitiv nicht bis zum Rentenalter ausüben werde. Doch eine Alternative gab es in meiner Welt nicht. Mein Therapeut sagt in der ersten Sitzung mit Bezug auf den Fragebogen, den jeder am Ankunftstag ausfüllen darf: „Sie müssen Ihren Job ja ganz schön hassen.“ Bumm! Wirkungstreffer. Nach weiteren Gesprächen ist klar: Wenn ich ein glückliches Leben führen will, sollte ich mir bald einen anderen Job suchen. Eine Aussicht, die mich zugleich beflügelt und erschreckt.
Fünftes Wunder: Ich habe tatsächlich ein ganzes Spektrum an Gefühlen. Und es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich diese auslebe. „Gefühle sind keine Krankheit“ heißt das Buch von Dr. Dogs. Genau das spüre ich in Scheidegg zum ersten Mal in meinem Leben. Ich darf als Mann Angst haben, traurig sein, weinen, mich ohnmächtig fühlen, wütend, hilflos – alles ist erlaubt, alles darf da sein. Es tut sogar richtig gut, wenn sich alles zeigen darf. Ohne mein Motto „Das ist deine letzte Chance!“ hätte ich bestimmt vor dem Tanz der Gefühle gekniffen. (Nur zur Erinnerung mein Status 2013: Ich bin ein Mann, ich zeige keine Gefühle in der Öffentlichkeit, ich weine nur beim Abstieg meines Lieblingsfußballvereins und tanze frühestens ab drei Bier.) Tanz der Gefühle, eine spezielle Therapieform, bei der die Patienten mehr als zwei Stunden in einem immer dunkler und stickiger werdenden Raum ununterbrochen tanzen – Freestyle, einfach so, wie es der Körper gerade verlangt. Als Krönung folgen einige therapeutische Übungen, die gezielt darauf hinsteuern, dass sich all die jahre- oder teils jahrzehntelang aufgestauten Gefühle Platz machen dürfen. Und wie sie das tun! Ich tobe wie ein Berserker, balle die Fäuste, schüttle mich, wüte, schreie. Es schleudert die hässlichsten Schimpfwörter aus mir heraus. Gerichtet gegen Menschen, denen ich das schon ganz lange hätte sagen sollen. Und gegen mich selbst. All die Scham, der Ekel, der Selbsthass. Alles muss raus. Gefühle-Schlussverkauf sozusagen.
Nach der Explosion, nach dieser Eruption von Hass und Wut, breche ich zusammen. Sinke auf den Boden. Mindestens zehn Minuten lang schütteln mich Weinkrämpfe durch, alle Schleusen offen. Die Tränen schießen heraus, wie wenn jemand den Hahn ein bisschen zu weit aufgedreht hätte. Das Abgefahrene dabei: Ich schäme mich nicht dafür. Ich genieße. Äußerlich völlig zerstört und am Boden, macht sich innen eine große Ruhe und Erleichterung breit. Endlich! Endlich! Endlich! „Tränen sind das Wischwasser der Seele“, habe ich mal gehört. Genau das empfinde ich in dem Moment. All der Dreck, der sich so lange angesammelt hat, darf jetzt abfließen. Und da fließt in den nächsten Wochen noch einiges hinterher. Ich kann wieder weinen. Was für eine Befreiung, was für ein Geschenk! Die zentnerschweren Ketten, die mich so lange gefesselt haben, einfach weggesprengt. Es geht nur darum, Gefühle zu fühlen. Auf so eine verrückte Idee wäre ich tatsächlich nie gekommen.
Meine Erlebnisse während der Klinikzeit würden locker ein eigenes Buch füllen. Ein Stück weit tun sie das auch. Denn das Schatzkästchen an Erkenntnissen, das ich dort bekommen habe, trage ich heute noch stolz mit mir herum. Dr. Dogs, dieser faszinierende Mann, dieser fantastische Provokateur mit den ungewöhnlichen Methoden, war der erste echte Mentor meines Lebens. Die Art, wie er das Leben versteht, seine Sicht auf unsere Gesellschaft und die Psychotherapie sind mein unverrückbares Fundament und fließen in meine Texte sowie in meine Arbeit mit Menschen ein.
Sollte ich den fünf Wochen im Mai und Juni 2013 einen Soundtracktitel verpassen, dann kommt nur einer in Frage: „Time of my Life“! Eine gefühlte Wunderheilung, die doch keine war. Denn ein Wunder wäre es gewesen, solche immensen Fortschritte zu machen, ohne aktiv etwas beizutragen. Doch ich hatte ja verdammt viel beigetragen: mein ganzes Herz, meinen ganzen Mut, meine ganze Lebensfreude, meinen ganzen Willen. Ich wollte meine letzte Chance nutzen und habe sie genutzt. Dafür danke ich mir und den wundervollen Menschen, die mich als Mitpatienten, Ärzte, Therapeuten und Pfleger in der Zeit gefordert, begleitet, unterstützt und getragen haben.
Alles auf Neustart
Wie war das noch mit „Sie müssen Ihren Job ganz schön hassen“? Es ist Anfang Juli 2013, gerade einmal zweieinhalb Monate seit meinem Zusammenbruch, und ich sitze wieder auf meinem Bürostuhl in der Redaktion. Vollzeit, ohne Wiedereingliederung. Mein Therapeut meint, wer so eine Entwicklung hingelegt habe und in solch blendender Verfassung sei, brauche das nicht. Ein Teil von mir glaubt ihm das, strotzt vor Kraft und will es so richtig wissen. Der andere Teil würde lieber ein Leben lang in der Klinik bleiben. Wieso soll ich nach nur fünf Wochen meine Ruheoase, meine Spielwiese, meine Kuschelzone, meinen geschützten Raum voller Geborgenheit, Anerkennung und aufkeimender Lebensfreude wieder verlassen? Ach so, weil Kliniken zwar ein guter Lebenshelfer sein können, doch eben kein Lebensersatz. Draußen spielt die Musik. Also zurück zu den Normalos, die mir aus meinem Klinik-Blickwinkel eher wie die tatsächlich Verrückten vorkommen. Meinen die das echt alle ernst mit dem, was sie da tagtäglich treiben? Wie sie sich alle hetzen, kontrollieren, endlose Verpflichtungslisten abhaken und sich zur Leistung zwingen, nur um am Ende des Tages ein bisschen Anerkennung und Liebe zu bekommen, ein paar Kröten zu verdienen und nur nicht aus dem Rahmen zu fallen. Krass. Will ich in dieses Leben wirklich zurück?
Die Antwort lautet: Ja! Nicht, weil ich das oben genannte Szenario besonders hilfreich finde. Sondern, weil ich wissen will: Wie finde ich mich in dieser Welt zurecht, wenn es mir psychisch richtig gut geht? Wie entwickelt sich mein Leben, wenn ich ab jetzt alle Steine umdrehe und alles schonungslos ehrlich anschaue? Was passiert mit mir im Job, wenn ich nach neuen Möglichkeiten suche und meine Bedürfnisse klar äußere? Finde ich auf Dauer zu mehr innerer Ruhe, wenn ich meinen Hintern runter vom Sofa und hinaus in die Natur bewege und gleichzeitig viel öfter aktiv entspanne, Yoga praktiziere, meditiere? Zusammengefasst: Funktioniert ein Leben in der Tretmühle, wenn ich meine Hausaufgaben mache, und senke ich damit mein Stresslevel dauerhaft so stark, dass die Angst keine Angriffsfläche mehr hat?
Der erste Schritt klappt. Ich erzähle in unserer Lokalredaktion offen von meinen Themen und ernte statt befürchtetem Spott und Zurückweisung extrem viel Verständnis und Wertschätzung. Kein „Psychostempel“, vor dem ich so Schiss hatte, sondern intensive Gespräche, ernsthaftes Mitfühlen, Mitleiden, Mitlachen. Ich wachse weiter, das zarte Pflänzchen Mut streckt sich noch ein Stück Richtung Himmel. Statt mir den Hintern auf dem Bürostuhl platt zu sitzen, darf ich nun endlich hinausgehen und Geschichten schreiben. Mischa, der rasende Reporter. Jetzt merke ich zum ersten Mal, wie sich ein Traumjob wirklich anfühlt. Frei, lebendig, locker. Ich bin fast den ganzen Tag unterwegs und treffe so viele unterschiedliche Menschen. Das ist mein Metier, meine Berufung. Ich will mit Menschen zu tun haben, nicht mit Sporttabellen.
Zwei Monate später platzt der Traum von einer erfüllten Reporterkarriere. Der neue Chef der Lokalredaktion beordert mich zurück auf meine Sportsachbearbeiterstelle. Meine zarten Hinweise auf meine Vorgeschichte beeindrucken ihn nicht. Genauso wenig wie die beiden neuen Chefredakteure, denen ich verschiedene Modelle vorstelle, wie die Zeitung und ich glücklich werden könnten, zum Beispiel ein Sabbatical oder Teilzeit. Ihre Alternativen klingen so: Sportredaktion oder Sportredaktion (in Vollzeit versteht sich). Ich wähle Alternative drei und kündige. Schließlich habe ich vor einem halben Jahr eine klare Entscheidung getroffen. Die ehrliche Antwort auf die Frage, ob ich den Job weitermachen würde, wenn ich mir selbst der wichtigste Mensch bin und meine Gesundheit an erster Stelle steht, lautet „Nein“. Mit drei Ausrufezeichen. Plus diversen Flüchen. Weil ich auf eine für alle passende Lösung gehofft hatte, nun aber indirekt gezwungen wurde zu kündigen. Gerne hätte ich weiter das schöne Gehalt eingestrichen, zudem hatte ich so gar keinen Plan, womit ich später mal Geld verdienen sollte. Egal, Hauptsache raus. Besser spät als nie. Das Leben wird sich schon um mich kümmern.
Allein mit Dr. D durch Europa
Das Spiel bei der Zeitung war also vorbei. Der Fairness halber sei erwähnt, wie ich in besagtem Gespräch mit den Chefredakteuren ordentlich gezockt hatte. Den Satz „Hey Leute, ich habe mir einen alten VW Bus gekauft und werde damit ab nächsten Mai sechs Monate durch Europa fahren“, hielt ich für einen top Joker. Schließlich wurde mir die Wochen zuvor mehrfach erklärt, wie wichtig, ja fast schon unverzichtbar ich mit meiner Sportexpertise für den Verlag sei. Doch so wichtig war ich nicht. Meine neuen Werte Mut, Freiheitsliebe und Entscheidungsfreude standen in zu großem Kontrast zu den Werten meines Arbeitgebers. Ich grinse mir heute noch einen, wenn ich an die abschließenden Worte des Chefredakteurs denke: „Sie glauben ernsthaft, dass ein Sabbatical ein geeignetes Instrument der Personalentwicklung für Tageszeitungsredakteure ist?“ Natürlich nicht. Ich glaube ja auch nicht, dass Elfmetertraining ein geeignetes Instrument für englische Nationalmannschaften bei Fußballgroßereignissen ist. Und ich glaube auch nicht, dass „mit Zwiebel und scharf“ ein geeignetes Instrument für Dönerbuden ist.
Heute verneige ich mich vor Dankbarkeit gegenüber meinen damaligen Vorgesetzten. Sie hatten mir mit ihrer begrenzten Flexibilität die längst überfällige Entscheidung abgenommen. Alles in mir schrie: reisen, raus in die Welt, Abenteuer erleben, neue Menschen treffen, Freiheit, das eigene Ding machen, endlich unbeschwert sein und jede Menge Spaß haben. Also nicht so wahnsinnig viele Schnittmengen mit meiner vorherigen Tätigkeit. Der 15 Jahre alte T4 Multivan, den mir mein Arbeitskollege Mathias im Herbst 2013 zum Kauf anbot, kam somit als Fluchtwagen genau zum richtigen Zeitpunkt.
Am Tag meiner Kaufzusage spürte ich die Magie des Lebens in ungeahnter Dimension. Als winkte mir das Universum zu und sagte: „Danke, dass du dir treu bleibst und deinen neuen Weg so konsequent gehst. Zur Belohnung sage ich dir jetzt, was du mit dem VW Bus anfangen wirst.“ Ich bekam tatsächlich eine Eingebung. Mein Verstand war völlig außen vor. Im tiefsten Inneren wusste ich auf einen Schlag: Ich werde nächsten Mai starten und sechs Monate mit dem Bulli, den ich als Dank an den Chefarzt Dr. Dogs, der mich behandelt hatte, auf den Namen Dr. D taufte, durch Europa fahren. Ich wusste die Tour, die Anzahl der Länder, durch die ich fahren wollte, und die kommenden Highlights. Da gab es nichts zu überlegen, zu tüfteln, zu grübeln oder Pläne hin- und herzuwälzen. Ich wusste es einfach. Ich hatte keine Ahnung, wie das klappen sollte, schließlich war ich ja noch angestellt. Ich wusste nur, dass es so kommen würde. Der Kontrolletti gab sich geschlagen, die Intuition hatte einen historischen Sieg errungen. Dieser Moment veränderte meine Sicht auf das Leben und wie ich richtig gute Entscheidungen treffen kann, komplett.
Der letzte Arbeitstag Ende April 2014 fand nach einer emotionalen Berg- und Talfahrt seinen krönenden Abschluss mit dem Wunsch einer lieben Kollegin: „Genieße es, das wird das längste Wochenende deines Lebens“, sagte sie und umarmte mich lange. Wenige Tage später startete meine Europatour. Allein. Meine Frau hatte sich fast zeitgleich selbstständig gemacht, konnte sich allerdings nicht vorstellen, so lange fern der Heimat zu sein. Mein Entschluss dagegen stand felsenfest: „Ich ziehe das durch, weil ich gar nicht mehr anders kann – und bin bereit, den Preis dafür zu zahlen, was auch immer passiert.“ Ich hatte mich entschieden, ich wollte heilen, mich und die Welt entdecken und mutige Dinge tun. Keine faulen Kompromisse mehr, keine Verleugnung der eigenen Wünsche. Viel zu lange hatte ich meinen Freiheitsdrang, meine Campingleidenschaft und mein Bedürfnis nach längeren Roadtrips unterdrückt.
Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, ob die Nummer gut geht. Der einstmals professionelle Hasenfuß, der noch nie eine längere Strecke als 300 Kilometer allein mit dem Auto zurückgelegt hat, will jetzt 20000 Kilometer (großteils) allein durch Europa cruisen. Derselbe Typ, der noch ein Jahr zuvor nicht mehr aus dem Haus gegangen ist. Der damals aus Angst vor der nächsten Panikattacke jahrelang keine Autobahn, keine Schnellstraße und durch keine Tunnels mehr gefahren ist geschweige denn eine Fähre betreten hat, der selbst als Beifahrer in jedem Stau und an jeder Baustelle Herzrasen bekommen hat – der Typ will jetzt ernsthaft allein Europa mit dem VW Bus erkunden? Ja, völliger Ernst!
Schließlich begleitete mich schon wieder ein neues, zugegebenermaßen leicht martialisches Motto: „Lieber gehe ich mit fliegenden Fahnen unter, als niemals in die Schlacht gezogen zu sein!“ Lange genug in meinem Leben hatte ich gekniffen, wenn es darauf ankam. Das Einzige, was jetzt noch gekniffen wurde, waren die Pobacken. Und zwar zusammen. Ich halte „Augen zu und durch“ sonst nicht unbedingt für die bestmögliche Antriebsfeder. In dem Moment half es.
Noch mal als kurze Anmerkung für alle Freunde der Verhaltensund Konfrontationstherapie: Die Tour bin ich aus einem selbstbewussten, stabilen Gefühl heraus angetreten. Mein Leben hatte sich grundlegend geändert, ich war wesentlich entspannter. Ich hatte mir die nötige Zeit gelassen, um geduldig nach und nach mutige Schritte zu gehen. Mein neuer Umgang mit der Angst und die zunehmende Gelassenheit durften reifen. Diesen Prozess erachte ich als essenziell. Wir können einfach nichts erzwingen, sondern dürfen die Dinge dann tun, wenn der richtige Moment gekommen ist. Sonst kann der Schuss schnell nach hinten losgehen. Nur auf diesem Weg konnte ich die neue Herausforderung meistern. Hätte mich mein Therapeut ein Jahr zuvor gezwungen, mich in den Wagen zu setzen und auf die Autobahn zu fahren, wäre ich kläglich gescheitert. Es war einfach noch nicht dran. Somit blieb mir das Versagen erspart, das mich noch weiter unter Stress gesetzt und mit einer nicht enden wollenden Litanei an Selbstvorwürfen geendet hätte.
Wenn Konfrontationstherapie, so wie sie von vielen Verhaltenstherapeuten praktiziert wird, ein Erfolgsmodell wäre, dürfte es lang nicht mehr so viele Menschen mit Angststörungen geben. Doch das blinde Anrennen gegen die Angst ohne ein entsprechend gutes Basisgefühl funktioniert zu selten und erzeugt meist noch zusätzlich Stress und Leid bei den Betroffenen.

Endlich Leben, endlich Freiheit, endlich Abenteuer! Die Europatour 2014 durch 20 Länder (hier von oben: Dünen von Pilat/Frankreich; Allgäu/Deutschland; Isle of Islay/Schottland; Costa Verde/Sardinien; Ramberg/Lofoten/Norwegen) war eine Befreiung und ein klares Bekenntnis zu den eigenen Bedürfnissen.
Doch zurück in den Bulli, zur Freude und zum Freiheitsgefühl in der Natur. Rückblickend betrachtet gab es unfassbar viele Tage auf meiner Europatour, an denen ich mich so lebendig gefühlt habe wie nie zuvor. An denen ich laut singend im VW Bus saß, gelacht und mir selbst schlechte Witze erzählt habe. An Tagen, wenn alte Muster wieder zum Vorschein kommen wollten, habe ich den Spieß im Vergleich zu früher umgedreht. Ich habe die Angst wahrgenommen, mich mit ihr unterhalten und ihr gesagt, dass ich weiß, warum sie jetzt gerade auftaucht. Und dass ich mich von ihr nicht mehr abhalten lasse.
Teilweise habe ich mich selbst kaum wiedererkannt. Nur mit dem Nötigsten unterwegs, planlos und flexibel – ich wusste zwar, welche Länder ich besuchen wollte, doch nicht, wo es mich genau hinverschlagen und wie lange ich wo bleiben würde –, ohne Angst vor neuen Herausforderungen und die meiste Zeit allein: Das alles hatte bis auf den Namen im Pass nicht mehr viel mit dem früheren Schisser und Kontrolletti zu tun. Offen und ehrlich habe ich den Menschen von Schottland bis Schweden, von Estland bis Portugal meine Geschichte erzählt und mich super dabei gefühlt. Angst war nichts mehr, wofür ich mich schämen musste. Meine Erfahrungen und mein Umgang mit der Angst waren plötzlich großartiger Stoff für Gespräche mit Tiefgang.
Ich wollte allerdings meine befreiende Reise nicht nur mit mir selbst feiern, sondern am liebsten die ganze Welt daran teilhaben lassen. Meine neue Mission hieß Mut machen (und ich bitte alle Freunde und Familienmitglieder um Verzeihung, die ich im ersten Überschwang missionieren und ungefragt coachen wollte – ich hatte es nur gut gemeint, Ehrenwort!). Wenn ich mit meiner Vorgeschichte einen Ausweg aus dem ganzen Mist gefunden hatte, dann musste das für andere doch auch möglich sein. Deshalb gingen parallel zum Tourbeginn mein Blog und meine Facebook-Seite „Adios Angst – Bonjour Leben“ an den Start. „Auf Angst und Depression steht nicht lebenslänglich!“ lautete die zentrale Botschaft.
Die Ratschläge der großen Blogger-Gurus, wie so eine Webseite auszusehen hat („Es geht nicht um dich, sondern ausschließlich um die Bedürfnisse deiner Leser!“), wurden von mir zur Kenntnis genommen und für untauglich erklärt. Ich wollte weder Ratschläge von oben herab erteilen noch mit „27 unschlagbaren Tipps, mit denen du …“ langweilen. Ich wollte einfach nur meine Geschichte erzählen, was ich daraus gelernt habe und täglich lerne. Ungeschminkte eigene Erfahrungen weitergeben, gespickt mit ein paar Ideen, wie aus meiner Sicht ein psychisch stabiles Leben aussehen könnte. Humorvoll, radikal ehrlich, aneckend – wie es sich eben für einen echten Revoluzzer gehört. Nicht das nächste Abziehbild eines Ratgeberblogs schaffen, sondern ein Original. Augenscheinlich habe ich damit einen Nerv getroffen. In den ersten Jahren war der Blog im Verhältnis zur Anzahl der Leser einer der meist kommentierten seines Genres im deutschsprachigen Raum.
Wenn man so will, waren der VW Bus, die Kündigung und der Blog die Grundlage von allem, was in den darauffolgenden Jahren noch passieren sollte. Ich hatte endlich einmal etwas riskiert ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Ich hatte mich geöffnet und in die Welt hinausposaunt: „Schaut her, ich bin ein Mann mit Gefühlen. Einer, der sich verletzlich zeigt, sich seiner Tränen nicht schämt und zu seinen Ängsten steht. Ihr könnt mich jetzt doof finden, als Weichei titulieren und auslachen. Oder ihr folgt mir einfach und schaut, was für euch Hilfreiches dabei ist. Eure Wahl!“
Ab in die Selbstständigkeit!
Ein Jahr nach Bloggründung wollten schon 4000 Menschen pro Monat meine Artikel lesen. Für mich eine unfassbar hohe Zahl angesichts der Tatsache, dass ich nach Expertenmeinung so ziemlich alles falsch gemacht habe. Leider habe ich mir die E-Mail nicht aufgehoben, die ich von der Assistentin des Blogger-Onlinekurses bekam, den ich gekauft hatte. Darin standen ungefähr 25 Kritikpunkte, die mich mit meinem Stil von einem erfolgreichen Blog abhalten. Auf Schulnoten umgerechnet war das eine 5+. Versetzung akut gefährdet, sagten meine Bloglehrer. Geiler Blog, der mir richtig weiterhilft, schrieben meine Leser. Wer hat jetzt recht? Einmal mehr wurde mir in dem Moment bewusst, was wir uns mit dem ständigen Bewerten und Kritisieren antun. Es geht leider in der Regel meist nicht darum, wie wertvoll ein Individuum für sich und andere sein kann. Der einzige Maßstab ist, ob der Einzelne sich gut genug in ein starres Schema pressen lässt, das irgendjemand anderes einmal als zielführend festgelegt hat. Einnorden statt entfalten – was für ein Irrsinn!
Ein weiterer Ratschlag, den ich bekommen hatte: „Monetarisiere deinen Blog, so schnell es geht.“ Also irgendwelche Produkte zusammenschustern, damit ein bisschen Geld reinkommt. Ein E-Book, ein Online-Kurs, aber zackig! Wenn dann das passive Einkommen nur so fließt, kann ich endlich ortsunabhängig arbeiten, von überall auf der Welt Geld verdienen. Digitales Nomadentum – eine durch und durch faszinierende Idee, wenn auch extrem klischeebeladen (mit dem Laptop in der Hängematte am Strand) und gerade bei jungen Menschen als die Komplettlösung für alle Probleme und Lebensfragen angesehen.
Ich war zwar bereit und vollen Willens, mir irgendwie ein Leben mit der Möglichkeit des ortsunabhängigen Arbeitens zu erschaffen. Doch mit meinem Blog konnte und wollte ich mir das (noch) nicht vorstellen. Einerseits stand nach meiner Rückkehr nach Deutschland im Spätherbst 2014 die Frage im Raum, mit was ich denn künftig mein Geld verdienen wollte. Andererseits war klar: Irgendein x-beliebiger Ratgeber oder Kurs ist es nicht. Das fühlte sich nicht richtig an, also konnte es nicht richtig sein. Zudem war ich von meiner ganzen Entwicklung noch gar nicht so weit, mich frech hinzustellen und für das Erzählen meiner Geschichte Geld zu verlangen. Heute kann ich das. Was es dazu gebraucht hat, steht im nächsten Kapitel.
Ich war also offiziell arbeitslos und hatte eine vage Idee, wie es weitergehen könnte. Glücklicherweise kam mein Berater bei der Arbeitsagentur ohne mein Zutun auf dieselbe Idee. Für ihn stand fest, dass ich mich angesichts meiner Vorgeschichte bei keiner Redaktion mehr zu bewerben bräuchte. Ich sei unvermittelbar. Hurra! Mein Bemühen um ein betroffenes Gesicht konkurrierte stark mit meinem inneren Jubel. Der Weg war frei, mich mit Hilfe des Gründungszuschusses selbstständig zu machen. Ganz pragmatisch mit dem, was ich ohnehin schon konnte: als freiberuflicher Journalist, Texter, Lektor und Autor.
Besonders mutig fand ich mich dabei nicht. Ich sah das eher als logische Konsequenz, wenn ich Freiheit, meinen höchsten Wert, ausleben wollte. Ich hatte keine Lust mehr auf Hierarchien, Autoritäten und Urlaubsplanungsgerangel. Wenn ich selbst entscheiden wollte, wie viel Zeit und Ruhe ich noch für meinen Heilungsprozess brauchte, dann gab es keine andere Wahl als die Selbstständigkeit. Nicht, weil sie die eierlegende Wollmilchsau ist und alle Herausforderungen auf einen Schlag verschwinden (hat hier gerade jemand Buchhaltung, Steuern und Disziplin gerufen?), sondern weil sie am ehesten dem entsprach, wofür ich mich eineinhalb Jahre zuvor entschieden hatte: mich, meine Bedürfnisse und meine Gesundheit an die erste Stelle zu rücken.
Der Schritt in die Selbstständigkeit bedeutete: Kopf voraus in die Unsicherheit. Wo war die Angst, die ich jahrelang vor so einem bedeutenden Schritt hatte? Sie hatte sich dank meiner jüngsten Erfahrungen, meiner Klarheit und meines neuen Vertrauens in ein aufgeregtes Kribbeln verwandelt. Was sollte schon passieren? Ich hatte in meinem Leben schon rund 30 verschiedene (Hilfs-) Jobs gehabt, mit denen ich Geld verdient hatte. Wieso sollte jetzt der Geldstrom für immer versiegen, nur weil ich kein monatliches Gehalt mehr bekam? Mein Motto in dieser Phase: „Falls alle Stricke reißen, gehe ich notfalls zur Müllabfuhr. Nur in ein Büro lass ich mich nicht mehr einsperren.“ Das war mein voller Ernst – und ich habe es durchgezogen. Was mir dabei geholfen hat, erfährst du im nächsten Kapitel. Vielleicht ist die ein oder andere Inspiration für dich dabei, dein Leben mal aus einem neuen Blickwinkel zu sehen und dann selbst mutige Veränderungen einzuläuten.
MEINE REZEPTE FÜR EIN MUTIGES LEBEN
Du bist fest entschlossen, dein Leben ab sofort selbst in die Hand zu nehmen? Dann helfen dir die folgenden 15 Punkte dabei, es aus eigener Kraft umzugestalten und Verantwortung dafür zu übernehmen. Mut ist erlernbar. Mach kleine Schritte, denn von heute auf morgen hat noch niemand die Welt verändert. Freue dich an jedem noch so kleinen Erfolg und lass dich von vermeintlichen Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen!
1. Übernimm Eigenverantwortung und triff eine klare Entscheidung  S. 46
S. 46
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783869106854
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (November)
- Schlagworte
- Angst-Störung Leben Lebensfreude Selbstcoaching Depression Burnout