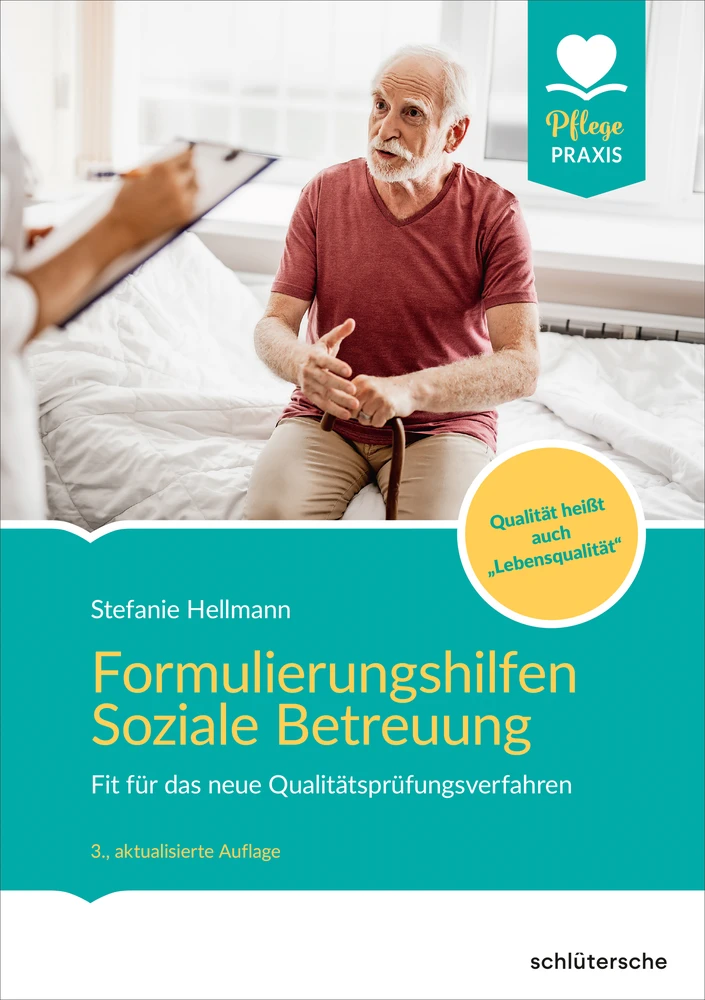Zusammenfassung
Die 3., aktualisierte Auflage enthält neben den aktuellen Transparenzkriterien wieder eine Fülle von Formulierungshilfen, die die tägliche Arbeit ganz entscheidend erleichtern.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung gehört zu den zentralen Leistungen stationärer/teilstationärer Pflegeeinrichtungen. Schließlich heißt es im § 43b SGB XI: »Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen haben nach Maßgabe von § 84 Absatz 8 und § 85 Absatz 8 Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht.«
Es geht darum, Pflegebedürftige so zu unterstützen, dass sie Gemeinschaft erfahren, sich angenommen fühlen und als wertvoll erfahren.
Verantwortlich für die Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung sind die Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung. Aus dieser Verantwortung leitet sich eine Forderung ab: Die Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung müssen auf die Aufgaben vorbereitet werden, die mit der Sozialen Betreuung und Alltagsgestaltung verbunden sind. Sie brauchen Beratung, Schulung, Begleitung und Unterstützung.
Hinzu kommt, dass die Führung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens durch Erkrankungen erheblich eingeschränkt werden kann. Immer mehr alte Menschen, die in Einrichtungen der Altenhilfe leben oder diese besuchen (Tagespflege), sind an Demenz erkrankt.

Info
»Demenz ist eine erworbene globale (umfassende) Beeinträchtigung der höheren Hirnfunktion, einschließlich Gedächtnis, der Fähigkeit Alltagsprobleme zu lösen, sensomotorischer und sozialer Fertigkeiten der Sprache und Kommunikation, sowie der Kontrolle emotionaler Reaktionen, ohne Bewusstseinsstörungen. Meist ist der Verlauf progredient (fortschreitend) und nicht notwendigerweise irreversibel.«*
* https://www.neurologicum-bremen.de/schwerpunkte/demenzen-und-hirnleistungsstoerungen/, Zugriff am 08.03.2019
Gerade Menschen mit Demenz brauchen eine Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung, die im höchsten Maße individuell und biografisch ausgerichtet ist. Nur so können diese Menschen möglichst angstfrei leben, sich als wertvoll erfahren und an einer Gemeinschaft teilhaben.
Ein Letztes noch: Pflege und Betreuung sind heute einem hohen Zeitdruck und rigiden Rahmenbedingungen ausgesetzt, sollen aber qualitativ hochwertig, von fachlicher Güte und Menschlichkeit geprägt sein. Zugleich müssen sie qualitativen Ansprüchen genügen, die im Rahmen einer Qualitätsprüfung nachgewiesen werden müssen.
Wie sind all diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen? Einen ersten Zugang ermöglicht dieses Buch. Es bietet kompaktes Wissen, das sich schnell und kompetent umsetzen lässt:
•Übersicht über das Verfahren der neuen Qualitätsprüfung
•Impulse für die Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung
•Vorschläge für Formulierungen in der Pflege-/Maßnahmenplanung und -dokumentation
Aufgrund meiner langjährigen beruflichen Erfahrung stammt mein Wissen nicht nur aus der Literatur, sondern auch aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz. Mein Ziel ist es, Ihnen einen kompakten Ratgeber rund um die Fragen der Formulierung bei der Sozialen Betreuung und Alltagsgestaltung vorzulegen.
| Forchheim, im Juni 2019 | Stefanie Hellmann |
Ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen werden durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) bzw. den Prüfdienst der privaten Krankenkassen geprüft. Die Grundlage, die Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR) legen GKV-Spitzenverband, Sozialhilfeträger und Vertreter der Leistungserbringer gemeinsam fest. Das bisherige System der Prüfungen, an dessen Ende die sog. Pflegenoten standen, wurde scharf kritisiert, »weil Qualitätsmängel der Einrichtungen für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht klar erkennbar sind.«1 Ein Qualitätsausschuss Pflege wurde eingerichtet. Seine Aufgabe: ein neues Prüfverfahren und eine Alternative zu den bisherigen Pflegenoten zu schaffen. Im September 2018 lag der Abschlussbericht vor und »mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) [wurde] beschlossen, dass die neue Qualitätsprüfung und -darstellung bis Ende 2019 umzusetzen ist.«2 Das neue System enthält drei Bausteine ( Abb. 1)
Abb. 1)
Diese QPR gilt ab dem 1. November 2019 für stationäre Einrichtungen. Das System der internen/externen Qualitätssicherung und der Qualitätsdarstellung wird dabei grundlegend neugestaltet. Die ambulanten Pflegedienste und die Tagespflege-Einrichtungen erleben zwar auch neue Qualitätsprüfungen, aber unter anderen Voraussetzungen. So werden intern zunächst in absehbarer Zeit keine Qualitätsindikatoren erhoben werden müssen
1.1 Neu stationär: Qualitätsindikatoren
Die Qualitätsindikatoren und ihre Erfassung sind neu: Jede stationäre Einrichtung eines Trägers muss ab Oktober 2019 sog. Indikatoren zur Ergebnisqualität erheben:
•10 Indikatoren aus drei Qualitätsbereichen,
•alle sechs Monate bei allen Bewohnern in allen Einrichtungen,
•gemeldet an die Datenauswertungsstelle (DAS).
•Achtung: Werden Bewohner ausgeschlossen, muss dafür eine Begründung vorliegen
Beispiel: Jede von drei Einrichtungen eines Trägers erhebt den Indikator »Erhaltung der Mobilität«. Eine Einrichtung meldet: »Bei 80,7 Prozent der Bewohner konnte die Mobilität erhalten werden.« Nun melden auch die beiden anderen Einrichtungen ihre Prozentzahlen – und als Durchschnitt aller drei Einrichtungen ergibt sich, dass bei 88,4 Prozent aller Heimbewohner die Mobilität erhalten werden konnte.3
»Ein Indikator stellt also dabei immer eine Verhältniszahl dar. Erhoben werden zehn Indikatoren aus drei Qualitätsbereichen.«4
Mit einer kleinen Tabelle ( Tab. 1) gebe ich Ihnen einen schnellen Überblick über die Qualitätsbereiche und dazugehörigen Indikatoren die zweimal im Jahr erhoben werden.
Tab. 1) gebe ich Ihnen einen schnellen Überblick über die Qualitätsbereiche und dazugehörigen Indikatoren die zweimal im Jahr erhoben werden.
Tab. 1: Die zehn Qualitätsindikatoren aus drei Qualitätsbereichen

»Die Bewertung der Kennzahlen, d. h. die Zuordnung einer Qualitätsbewertung zu einer Kennzahl erfolgt mit Hilfe von Referenzwerten und einer fünfstufigen Systematik:
1. Ergebnisqualität liegt weit über dem Durchschnitt
2. Ergebnisqualität liegt leicht über dem Durchschnitt
3. Ergebnisqualität liegt nahe beim Durchschnitt
4. Ergebnisqualität liegt leicht unter dem Durchschnitt
5. Ergebnisqualität liegt weit unter dem Durchschnitt«5
Info
Die Datenauswertungsstelle (DAS) soll zum 1. September 2019 ihre Arbeit aufnehmen. Alle stationären Pflegeeinrichtungen müssen ab dem 1. Oktober 2019 bis zum 30. Juni 2020 einmal und ab dem 1. Juli 2020 jedes halbe Jahr zu einem bestimmten Stichtag indikatorenbezogene Daten erheben und weiterleiten.
Das Erhebungsinstrument6 ist das Formular, mit dem die stationären Einrichtungen ab Oktober 2019 arbeiten werden. Die Grundlage liefert das Begutachtungsinstrument (BI). Ich stelle Ihnen hier ( Tab. 2) (
Tab. 2) ( Tab. 3) nur jene Punkte vor, die für die Soziale Betreuung benötig werden.
Tab. 3) nur jene Punkte vor, die für die Soziale Betreuung benötig werden.
Tab. 2: Erhebungsbogen und BI-Modul 2 (Kognitive und kommunikative Fähigkeiten)

Tab. 3: Erhebungsbogen und BI-Modul 6 (Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte)

Tab. 4 : Einzug (= Beginn der vollstationären Versorgung)

Fazit Mehr Verantwortung für die Einrichtungen
Die Einrichtungen erhalten durch den Indikatorenansatz mehr Verantwortung bei der Qualitätstransparenz. Um die Daten der erhobenen Datei methodisch und exakt zusammenzustellen erfolgen zwei Plausibilitätskontrollen:
1. Bei der statistischen Auswertung durch die DAS findet eine erste Kontrolle statt. Hier wird die Stimmigkeit der Angaben der Pflegeeinrichtung überprüft.
2. Bei der externen Prüfung durch den MDK wird anhand von Stichproben überprüft, ob die Angaben der Einrichtung auch den tatsächlichen Feststellungen vor Ort entsprechen.*
* vgl. Wingenfeld K (2019): Qualitätsprüfungen: Die Neuerungen im Überblick. In: Die Schwester/Der Pfleger 58. Jhrg., 1/19, Bibliomed, Melsungen
1.2 Prüfrelevante Qualitätsaspekte
Bei der externen Qualitätsprüfung findet wie bisher eine Qualitätsprüfung in den Einrichtungen statt – nur mit anderen Inhalten und einer geänderten Methode.
Wie bislang auch kommen die Qualitätsprüfer des MDK oder der privaten Krankenkassen in jede Einrichtung und sprechen u. a. mit ausgewählten Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu erfolgt eine Stichprobenauswahl bei neun Bewohnerinnen und Bewohner (stationär), von denen sechs aufgrund der von der Einrichtung gemeldeten Indikatoren ausgewählt werden. Ebenfalls im Rahmen dieser externen Qualitätsprüfung erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse. Das Endergebnis dieser Prüfung wird auch der Pflegkasse übermittelt. Die ermittelten Daten werden zusammengefasst und aufbereitet. Die aufbereiteten Ergebnisse werden dann im Internet veröffentlicht.
Die Prüfer erheben 24 prüfrelevante Qualitätsaspekte (in sechs Bereichen)7:
1. Unterstützung bei der Mobilität und Selbstversorgung
2. Unterstützung bei der Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
3. Unterstützung bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte
4. Unterstützung in besonderen Bedarfs- und Versorgungssituationen
5. Bedarfsübergreifende Aspekte fachliche Anforderungen
6. Organisationsaspekte und internes Qualitätsmanagement
Davon werden:
•Die Qualitätsbereiche 1–4 auf der individuellen Ebene der personenbezogenen Versorgung erfasst,
•die Qualitätsbereiche 5 und 6 auf Einrichtungsebene erfasst.
Bei der Qualitätsprüfung haben also nun die bewohnerbezogenen Aspekte eine viel höhere Bedeutung, während die Strukturkriterien in den Hintergrund treten. Außerdem zielen die Bewertungsfragen nun darauf ab, ob für die versorgte Person negative Folgen oder Risiken entstanden sind, die die Einrichtung zu vertreten hat.

Info
Was negative Folgen sind, ist klar definiert: z. B. hat die versorgte Person eine gesundheitliche Schädigung erlitten, die durch das unsachgemäße Handeln eines Mitarbeiters entstanden ist; oder die Versorgung entspricht regelmäßig nicht dem Bedarf bzw. den Wünschen der versorgten Person.
Von einem Qualitätsdefizit wird im neuen System nur gesprochen, wenn für die versorgte Person ein Risiko oder eine negative Folge entstanden ist.
1.3 Öffentliche Qualitätsdarstellung
Der Gesetzgeber fordert Einrichtungen dazu auf, die Qualitätsdarstellungen zu veröffentlichen. Hierbei enthält die Qualitätsdarstellung wesentlich mehr Informationen als die Transparenzkriterien. Die Qualitätsdarstellung wird in drei Bereiche gegliedert:
1. Information über die Einrichtung (wird nicht bewertet, dient nur zur Information)
2. Informationen zu den Qualitätsindikatoren
3. Ergebnisse der externen Qualitätsprüfung
Anhand von Symbolen (Punkte und Quadrate) wird dargestellt, wie sich eine konkrete Einrichtung vom Durchschnitt – positiv oder negativ – von anderen Einrichtungen abhebt. Mit anderen Worten: Die alten und so oft kritisierten Pflegenoten gibt es nicht mehr. Die Symbole sollen klarer und einfacher sein. So kann sich der Interessierte schnell einen Überblick über eine Einrichtung verschaffen. Falls er dann noch weiteres Interesse hat, kann er die ausführlichen Ergebnisse einsehen.

Abb. 2: Symbolhafte Darstellung in den neuen Qualitätsberichten.
________________
1 https://www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/qualitaetspruefungen.html, Zugriff am 08.03.2019
2 Ebd
3 Kiefer G, Kücking M (2018): Neues Qualitätssystem in der stationären Pflege.
4 https://www.aok-verlag.info/de/news/Neues-Verfahren-fuer-Qualitaetspruefungen-in-der-Pflegeab-Herbst-2019/226/, Zugriff am 08.03.2019
5 Vgl. ebd.
6 Anlage 3 der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität, die Qualitätssicherung und -darstellung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der vollstationären Pflege
7 Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (2018): Entwicklung der Instrumente und Verfahren für Qualitätsprüfungen nach §§ 114ff. SGB XI und die Qualitätsdarstellung nach § 115 Abs. 1a SGB XI in der stationären Pflege. Abschlussbericht: Darstellung der Konzeptionen für das neue Prüfverfahren und die Qualitätsdarstellung, Bielefeld/Göttingen.
Bevor die MDK-Prüfer oder jene von den privaten Krankenkassen in die Einrichtung kommen, ist einiges an Vorbereitung nötig:
•Erteilung des Prüfauftrags,
•Benachrichtigung der Datenauswertungsstelle (DAS),
•Vorbereitung der Stichprobenziehung,
•Zusammenstellung wichtiger Informationen.
Bei Regelprüfungen melden sich die Prüfer am Tag zuvor an. Der Einrichtungsbesuch beginnt mit der Vorstellung der Prüfer. Danach erfolgt das Einführungsgespräch, werden Heimbeirat bzw. die Interessenvertretung informiert. Im Anschluss daran erfolgt die Bestimmung der zu prüfenden versorgten Bewohner und die Einholung der entsprechenden Einverständniserklärungen.
2.1 Die Qualitätsaspekte der Qualitätsprüfung
Die externe Qualitätsprüfung basiert in der stationären Pflege auf den »Qualitätsprüfungs-Richtlinien für die vollstationäre Pflege« (QPR vollstationär). 8
Die Soziale Betreuung wird beim Qualitätsaspekt 3 (»Unterstützung bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte«) genannt. Konkret im Punkt 3.2: Unterstützung bei der Tagesstrukturierung, Beschäftigung und Kommunikation.
»Qualitätsaussage
Die versorgten Personen werden dabei unterstützt, eine ihren Bedürfnissen und Beeinträchtigungen entsprechende Tagesstruktur zu entwickeln und umzusetzen. Der versorgten Person stehen Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung, die mit ihren Bedürfnissen in Einklang stehen. Sie wird bei der Nutzung dieser Möglichkeiten unterstützt. Versorgte Personen mit beeinträchtigten kommunikativen Fähigkeiten werden in der Kommunikation, bei der Knüpfung und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte unterstützt.«9
Im Anschluss daran wird die Informationserfassung geschildert:
»Beeinträchtigung der Selbständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte:
•Tagesablauf gestalten und an Veränderungen anpassen
•Ruhen und Schlafen
•Sich beschäftigen
•In die Zukunft gerichtete Planungen vornehmen
•Interaktion mit Personen im direkten Kontakt
•Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds
•Bei der Frage nach den »Kognitiven Fähigkeiten und psychischen Beeinträchtigung« wird über Freitext geantwortet, d. h., es kann genauer geschildert werden, wie es um den Bewohner steht.
•Die Frage nach dem Tagesablauf und Aktivitäten im Alltag der versorgten Person wird nur erfasst, wenn es sich um Personen handelt, deren Selbständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte beeinträchtigt ist. Hier gibt es ebenfalls ein Feld für Freitext.
Bei der anschließenden Plausibilitätskontrolle wird überprüft, ob die Informationssammlung zutrifft.
| Plausibilitätsprüfung | ||
1.Stehen die Angaben zur Selbstständigkeit der versorgten Person bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte (Ergebniserfassung) in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? |
||
 Keine Auffälligkeiten festgestellt Keine Auffälligkeiten festgestellt |
 Auffälligkeiten festgestellt (bitte angeben) Auffälligkeiten festgestellt (bitte angeben) |
 Trifft nicht zu Trifft nicht zu |
2.Stehen die Angaben zu den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der versorgten Person in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? |
||
 Keine Auffälligkeiten festgestellt Keine Auffälligkeiten festgestellt |
 Auffälligkeiten festgestellt (bitte angeben) Auffälligkeiten festgestellt (bitte angeben) |
 Trifft nicht zu Trifft nicht zu |
Weiter geht es mit der Allgemeinen Beschreibung: Hier ist zu prüfen, ob eine individuelle Gestaltung des Tagesablaufs möglich ist bzw. gefördert wird, die an den Bedürfnissen der versorgten Person ausgerichtet ist. Weiter ist zu prüfen, ob die versorgte Person kognitive oder psychische Beeinträchtigungen hat und ob die Tagesstrukturierung zur Förderung von Orientierung und Wohlbefinden eingesetzt wird. Des Weiteren wird darauf geachtet, ob hier bedürfnisorientierte Aktivitäten sowie die Kommunikation mit Angehörigen, Bezugspersonen und Freunden/Bekannten unterstützt wird.
Ferner gibt es noch Leitfragen, die nur beantwortet werden, wenn Bedarf an Unterstützung bei Tagesstrukturierung, Beschäftigung oder Kommunikation vorliegt. Falls dies nicht zutrifft geht es mit dem nächsten Qualitätsaspekt weiter.
Leitfragen:
1. Sind die Interessen an Aktivitäten und Gewohnheiten der versorgten Person bekannt?
2. Wurde mit der versorgten Person (oder ihren Bezugspersonen) eine individuelle Tagesstrukturierung erarbeitet?
3. Orientieren sich pflegerische Versorgung und andere Hilfen an der individuell festgelegten Tagesstrukturierung und den Bedürfnissen der versorgten Person?
4. Erhält die versorgte Person Unterstützung dabei, bedürfnisgerechten Beschäftigungen im Lebensalltag nachzugehen?«10

In dieser Art und Weise überprüft das Prüfteam bei sechs der neun versorgten Personen, ob die von der Einrichtung selbst ermittelten Ergebnisindikatoren plausibel sind: Passt das Gesamtbild zu dem Bild, was sich das Prüfteam gemacht hat und auch zu dem, was die Einrichtung an die Datenauswertungsstelle gemeldet hat?
Auf die Auswertung und die Einzelergebnisse aus der Prüfung werde ich in diesem Buch nicht näher eingehen, da diese sehr komplex sind, aber im Rahmen dieses Buches nicht weiter verfolgt werden müssen. Stattdessen widmen wir uns nun einem Thema, das in der Qualitätsprüfung von hoher Bedeutung ist: das Fachgespräch.
2.2 Das Fachgespräch
Das Fachgespräch wurde im neuen Prüfverfahren stark aufgewertet und dient nun als gleichwertige Informationsquelle (neben der Dokumentation). Dadurch können beispielsweise Dokumentationsschwächen ausgeglichen werden.
Wichtig ist allerdings, dass die mündlichen Schilderungen für alle Beteiligten fachlich nachvollziehbar sind und ein stimmiges Bild ergeben. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Gespräche nur durch Mitarbeiter geführt werden sollen, die den Bewohner, Patient oder Gast gut kennen.
In der QPR wird das Fachgespräch auch als »Abschlussgespräch« bezeichnet. Es soll »den Charakter eines Fachgesprächs haben, in dem gemeinsame Überlegungen dazu angestellt werden, wie festgestellte Defizite behoben und der Entstehung von Defiziten vorgebeugt werden kann.«11
Im Abschlussbericht des Instituts für Pflegewissenschaften an der Universität Bielefeld wird ebenfalls von einer »fachlichen Aufwertung« gesprochen. »Indem das Fachgespräch zwischen den Prüfern und den Mitarbeitern der Einrichtung als gleichwertige Datenquelle gegenüber Dokumentationen eingestuft wird, entstehen neue Chancen für die Weiterentwicklung der Prüfkultur und des Beratungsauftrages der Prüfdienste. Jede Form von Beratung setzt, will sie wirksam sein, ein dialogisches Vorgehen voraus.«12
Fazit Fachgespräch und schriftliche Dokumentation
»Dem Fachgespräch kommt im neuen Prüfverfahren ein hoher Stellenwert zu. Soweit nicht anders vermerkt, hat die fachlich schlüssige, mündliche Darstellung der Versorgung, der Bedarfskonstellation und anderer Sachverhalte einen ebenso hohen Stellenwert wie die schriftliche Dokumentation.«
* Institut für Pflegewissenschaften 2018, S. 100
________________
8 Qualitätsprüfungs-Richtlinien für die vollstationäre Pflege (QPR vollstationär). Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes über die Durchführung der Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach § 114 SGB XI für die vollstationäre Pflege vom 17. Dezember 2018, im Internet: https://www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/qualitaetspruefungen.htm
9 Ebd., S. 29
10 Ebd., S. 30
11 Ebd., Anlage 8, S. 2
12 Institut für Pflegewissenschaften 2018, S. 73
3.1 Ein Konzept für die Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung
»Mit dem Übergang zu einer Qualitätsdarstellung, die auf dem Indikatorenansatz beruht, entsteht eine neue Transparenz von Qualität, die nicht mehr ein so einseitig positives Bild von der pflegerischen Versorgung zeichnet wie die Transparenzkriterien.«13 Umso wichtiger ist es, dass die Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung nach einem validen Konzept gestaltet werden, damit sie korrekt, überprüfbar und qualitativ hochwertig umgesetzt werden können. Im Folgenden finden Sie ein beispielhaftes Konzept, das sich in der Praxis bereits bewährt hat.
»Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung«
Ein Ziel Ihrer Arbeit in der Altenpflege ist es, den Menschen, der durch Krankheit und Pflegebedürftigkeit eingeschränkt ist, immer wieder neu zu befähigen, im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Alltag selbst zu bestimmen und zu gestalten.
Menschen, die – beispielsweise auf Grund von Gebrechlichkeit, Vereinsamung oder fortschreitender Demenz – Hilfe und Unterstützung benötigen, brauchen verlässliche Beziehungen, in denen sie sich in ihrer Individualität und persönlichen Freiheit geschützt fühlen. Das Konzept einer mir bekannten Einrichtung liest sich wie folgt:
»Die Soziale Betreuung in unserem Haus ist auf die Lebenssituation der uns anvertrauten Menschen abgestimmt. Sie umfasst alle Aktivitäten für und mit den Bewohnern, die über die direkte Pflege hinausgehen. Dazu gehören alle Formen von Alltags- und Freizeitaktivitäten sowie die individuelle Einzelbetreuung.
Ein solches Konzept setzt voraus, dass die Interessen der Bewohner bezüglich der Aktivitäten und ihre Gewohnheiten bekannt sind. Des Weiteren ist nicht nur der Sozialdienst, sondern alle in der Pflege tätigen Mitarbeiter an der Gestaltung der sozialen Betreuung verantwortlich.
Vorwort
Soziale Betreuung ist eine der Kernaufgaben in unserer Einrichtung. Für die Lebensqualität unserer Bewohner haben die Angebote der Sozialen Betreuung einen hohen Stellenwert. Wir betrachten Soziale Betreuung nicht als isolierte Aufgabe, sondern als Bestandteil der Arbeit aller Mitarbeiter unserer Einrichtung.
Das Ziel ist die Vernetzung der Anstrengungen aller Leistungsbereiche, insbesondere dem Bereich der Pflege und Betreuung, unter Einbeziehung der Ehrenamtlichen. Soziale Betreuung ist ein fester Bestandteil unserer Einrichtung und findet sich so auch in unseren Konzepten wieder.
Zielgruppe
Unsere Einrichtung bietet ein Zuhause für
•alte und hochbetagte Menschen mit körperlichen, seelischen und/oder geistigen Beeinträchtigungen,
•pflegebedürftige und chronisch kranke Menschen,
•Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind und daher räumlich, zeitlich und/oder zur Person desorientiert sind.
Soziale Betreuung ist ein wesentlicher Baustein des Pflegeprozesses. Unser Ziel ist es, dass alle Bewohner unabhängig von ihren individuellen Beeinträchtigungen im Rahmen ihrer Wünsche und Ressourcen an einer für sie geeigneten Form der sozialen Betreuung/ Tagessstruktur teilhaben können, wenn sie dies möchten.
Um das zu erreichen, bieten wir ein weit gefächertes Angebot an verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten, Aktivitäten sowie unterschiedliche Formen der Begleitung an.
Dabei legen wir Wert darauf, dass jeder Bewohner ein für sich passendes Angebot findet und begeben uns zu seinem Wohl gern auf neue und innovative Wege. Diesem Anspruch und damit auch den uns anvertrauten alten Menschen gerecht zu werden ist eine Herausforderung, der wir uns immer wieder aufs Neue stellen.
Zielsetzung
Wir achten darauf, die Menschen, die durch Krankheit und Pflegebedürftigkeit eingeschränkt sind, immer wieder neu zu befähigen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Alltag selbst zu bestimmen und zu gestalten. So wird beispielsweise ein Bewohner unterstützt, sich selbstständig fortzubewegen; eine Bewohnerin wird angeleitet, sich ihr Frühstücksbrot wieder selbst zu streichen; ein Bewohner wird bei der Aufnahme sozialer Kontakte im Haus unterstützt. Die persönlichen Bedürfnisse der einzelnen Bewohner sind Ausgangspunkt der tagesstrukturierenden Angebote. Deshalb entscheiden die Menschen selbst, an welchen Angeboten sie teilnehmen. Dabei variieren diese sowohl nach Bewohnerstruktur als auch nach der jeweiligen Tagesform der Bewohner.
Ein alter Mensch verfügt über eine biografische »Goldgrube« voller persönlicher Erfahrungen. In der sozialen Betreuung schöpfen wir aus dieser Goldgrube, z. B. indem alte Lieder und Gedichte gemeinsam gesungen/gehört werden oder indem ein Apfelkuchen nach altem Rezept gebacken wird. Soziale Betreuung findet integriert in den Pflegeprozess und in die Tagesstruktur der Wohnbereiche sowie wohnbereichsübergreifend statt.
Personal
Ein multiprofessionelles Team, aus allen beteiligten Berufs- und Funktionsgruppen, wirkt in unserer Einrichtung in der Sozialen Betreuung eng zusammen. Zu den Aufgaben der Mitarbeiter in der Sozialen Betreuung gehört die inhaltliche Koordination der sozialen Betreuungsangebote – in Absprache mit den für die Pflege Verantwortlichen. Weiterhin leisten in der Einrichtung alle übrigen, an der Versorgung beteiligten Mitarbeiter in den Wohnbereichen Soziale Betreuung – im eigenen Wirkungskreis im Rahmen ihrer täglichen Arbeit.
In unserer Einrichtung finden sich folgende Berufsgruppen, die für die fachliche Qualität und Ausrichtung der Angebote Sorge tragen:
Gerontopsychiatrische Fachkräfte
Über die Pflege hinaus planen und vollziehen unsere gerontopsychiatrischen Fachkräfte die Soziale Betreuung, angelehnt an die besonderen Bedürfnisse psychisch veränderter, älterer Menschen. Sie organisieren die Angebote und Aktivitäten für die betroffenen Bewohner in der jeweiligen Wohngruppe. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, auch wohnbereichsübergreifend, je nach Bedarf und Erfordernis, Gruppen zu bilden.
Die gerontopsychiatrischen Fachkräfte übernehmen die Dienst- und Fachaufsicht der Betreuungsassistenten und damit deren Einarbeitung und Begleitung. In Absprache mit den Wohnbereichsleitungen und in enger Abstimmung mit der jeweiligen Bezugspflegefachkraft steuern sie den Einsatz der Betreuungsassistenten und der Mitarbeiter in der Sozialen Betreuung. Ebenso stellen sie sicher, dass die Beschäftigungsangebote und Aktivitäten aller an der Betreuung Beteiligten in der Pflegedokumentation erfasst sind.
Betreuungsassistenten
Seit dem 1.1.2015 haben alle Pflegebedürftigen Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleistungen, also niedrigschwellige Angebote. Bislang galt dies nur für Menschen mit erheblich eingeschränkten Alltagskompetenzen – also für solche, die z. B. psychisch oder demenziell erkrankt sind.
Im ambulanten Bereich wird der Anspruch um Entlastungsleistungen ergänzt. In der stationären Pflege wirkt sich der § 43b SGB XI so aus, dass die von der Pflegeversicherung finanzierten zusätzlichen Betreuungskräfte allen Versicherten zur Verfügung stehen sollen, also auch vorwiegend körperlich Betroffenen, insbesondere auch jenen, die keinem Pflegegrad zugeordnet sind.
Des Weiteren wurde der Betreuungsschlüssel auf 1 : 20 verändert. Das bedeutet, dass zukünftig in der Regel eine zusätzliche Betreuungskraft für 20 Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung zur Verfügung steht.
In unserer Einrichtung unterstützen die Betreuungsassistenten unsere gerontopsychiatrischen Fachkräfte.
Ehrenamtliche Mitarbeiter
In unserer Einrichtung befinden sich mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich beispielsweise im Besuchsdienst, in Musik- und Handarbeitstreffen, beim Dämmerschoppen oder der Gartenarbeit engagieren. Sie unterstützen unsere Bewohner und pflegen Beziehungen zu ihnen. Unsere Mitarbeiter sehen sie als wertvolle Unterstützer.
Fort- und Weiterbildung
Unsere Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. Eine kontinuierliche Wissenserweiterung im Bereich Demenz ist uns wichtig, damit unsere Mitarbeiter in der Lage sind, sich den stetig wachsenden Anforderungen im Umgang mit unseren demenziell veränderten Bewohnern menschlich und fachlich gerecht zu werden. Interne Fortbildungen gewährleisten die Wissensvermittlung auf allen Ebenen. Ehrenamtlichen Mitarbeitern stehen diese offen.
Leistungsangebote
Die Anregungen und Wünsche der Bewohner werden soweit wie möglich berücksichtigt. Grundsätzlich finden Angebote der Sozialen Betreuung als Gruppen- oder Einzelangebote statt. Dabei achten wir darauf, dass die Angebote zu unterschiedlichen Tageszeiten und Werktagen sowie, wenn sinnvoll, an den Wochenenden stattfinden.
Einzelangebote
Angebote für einzelne Bewohner berücksichtigen in stärkstem Maß deren individuelle Situation und begleiten den Einzelnen vom Einzug bis zum Tod. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Einzelbetreuung:
Psychosoziale Einzelbetreuung: Sie zielt auf die Förderung des Selbsthilfepotenzials des Einzelnen ab und geht dabei von seinen Stärken aus, um weitere vorhandene Ressourcen zu wecken und bestehende Fähigkeiten zu erhalten. Hierdurch kommt es auch zu Erfolgserlebnissen, die das Selbstwertgefühl stärken und fördern.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842690134
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (November)
- Schlagworte
- Altenpflege Pflege Pflegemanagement & -planung Soziale Betreuung