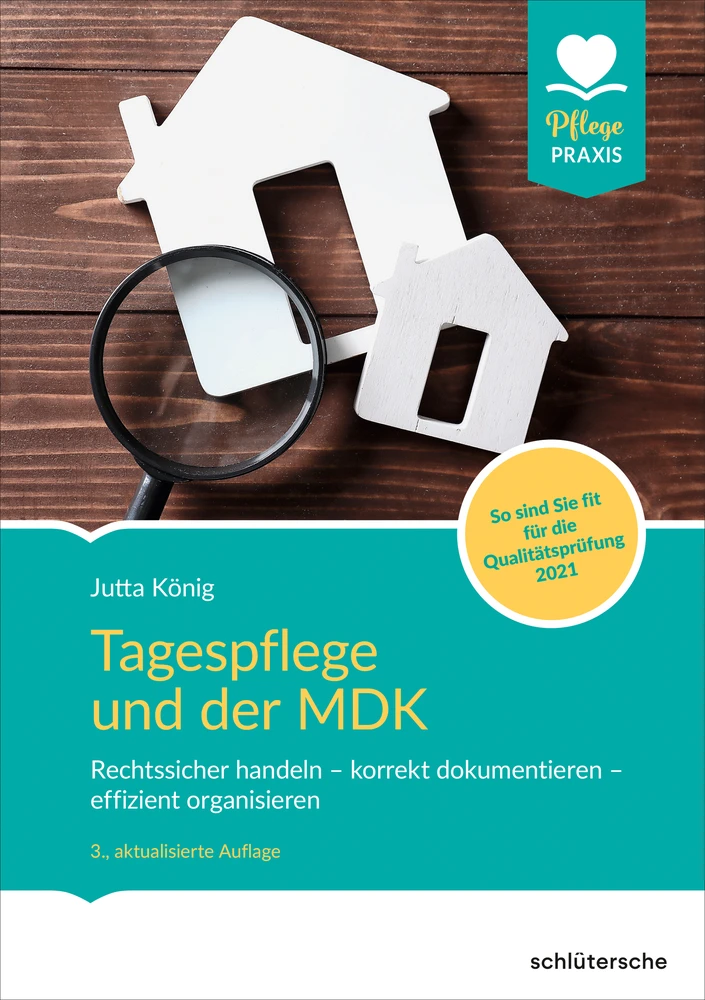Zusammenfassung
Qualitätsprüfung. Aber wie muss man auf die neuen Anforderungen reagieren?Denn wenn der MDK kommt, muss es schnell gehen. Eine gute Vorbereitung ist wichtig!
Konzeption, Dokumentation und nachweisbare Ergebnisqualität
sind die Schlüsselthemen, die über den Erfolg einer Prüfung entscheiden. Ebenso wichtig ist aber auch die kompetente Begleitung der MDK-Prüfer. Dieses Buch, mittlerweile in der 3., aktualisierten Auflage, hilft bereits, bevor es ernst wird. Jutta König erklärt kompakt, verständlich und alltagstauglich, was Mitarbeiter in der Tagespflege zum Thema „Qualität“ wissen müssen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Tagespflege ist eine gute und ergänzende Hilfe für die ambulante Versorgung Pflegebedürftiger. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen, nicht zuletzt dem Pflegestärkungsgesetz I vom 1. Januar 2015, ist die Tagespflege nun sehr viel attraktiver für alle Beteiligten: Die Leistung ist eine sogenannte »Solitärleistung«, d. h. sie wird nicht mehr auf die ambulante Versorgung angerechnet. Pflegebedürftige, die ambulante Dienste beschäftigen oder Pflegegeld beziehen, können seither auch eine Tagespflege voll in Anspruch nehmen.
Durch das Pflegestärkungsgesetz II wurden auch die Leistungen für die Tages- und Nachtpflege deutlich erhöht. Auch das führte zu einem weiteren Impuls, neue Tagespflegen wurden eröffnet. In Deutschland gibt es aktuell rund 5330 Tagespflegen mit etwa 80.450 Plätzen1. Und die Gründungswelle geht weiter, weil auch der Bedarf an Plätzen steigt. Für immer mehr pflegende Angehörige wird damit eine konkrete Entlastung spürbar und auch finanzierbar. Auch alleinstehende Pflegebedürftige können in immer stärkerem Maße Tagespflege-Einrichtungen besuchen und haben damit die Chance auf mehr Selbstständigkeit und Abwechslung in ihrem Alltag.
Doch selbstverständlich kann das Angebot nur so gut sein wie jene, die es konzipieren, regeln und Tag für Tag in die Tat umsetzen. »Nur« ein buntes Betreuungsprogramm anzubieten reicht nicht aus.
So gibt es seit 2020 die neuen »Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der teilstationären Pflege (Tagespflege)«. Wer eine zugelassene Tagespflege betreiben will, muss sich an diese Maßstäbe und Grundsätze halten und diese enthalten doch einige Neuerungen.
Außerdem sind da noch die Qualitätsprüfungs-Richtlinien von GKV und MDS, die sehr sorgfältig beachtet werden wollen.
• Welche Anforderungen müssen Sie also beherzigen, wenn Sie eine Tagespflege-Einrichtung betreiben wollen?
• Welche Gesetze, Standards, Verordnungen, Richtlinien etc. müssen Sie kennen?
• Kurzum: Worauf sollten Sie vorbereitet sein, bevor der MDK zur Prüfung kommt?
Fazit Das Buch für Ihren Alltag
Mit diesem kompakten Buch haben Sie alles, was Sie brauchen.
Ob Prüfanleitung, Expertenstandard, allgemeine rechtliche Anforderungen und die korrekte Dokumentation – Ich stelle Ihnen alles vor: leicht verständlich, kompakt und strikt praxisorientiert.
Das Plus: Die neue Qualitätsprüfungsrichtlinie 2021.
Einen kleinen Ausflug in Sachen »Arbeits- und Ablauforganisation« (natürlich mit praktischen Beispielen) unternehmen wir auch noch. Dann sind Sie wirklich rundum fit für den täglichen Betrieb Ihrer Tagespflege.
| Uelversheim, im November 2020 | Jutta König |
1 Vgl. https://www.pflegemarkt.com/2019/09/17/marktanalyse-tagespflege-zahlen-daten-fakten/#:~:text=In%20Deutschland%20werden%20gegenw%C3%A4rtig%20rund%205.050%20Tages-pflegen%20mit,Deutschland%20sonst%20zeigt%2C%20erfahren%20Sie%20in%20unserer%20Analyse
Die Überschrift ist natürlich ein wenig blauäugig – Wer kann schon sagen, was eine »gute« Pflegedokumentation wirklich ausmacht? Eines gleich vorweg: Eine gute Dokumentation ist nicht unbedingt jene, die eine Fülle von Formularen aufhäuft (in denen dann keiner mehr liest …). Kurz gesagt: Eine gute Pflegedokumentation ist jene, die für Ihre Einrichtung passt, Ihre Arbeit sinnvoll dokumentiert, überschaubar und leicht zu handhaben ist. Das ist Ihnen noch zu schwammig? Gut. Gehen wir ins Detail.
1.1 Das richtige Pflegedokumentationssystem (gibt es nicht)
Herkömmliche Dokumentationssysteme sind oft nicht speziell auf Tagespflegeeinrichtungen eingestellt. Es gibt mittlerweile viele Dokumentationssysteme auf Papier und immer mehr als EDV-Lösung. Diese sind spezialisiert auf ambulante und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, aber nicht spezialisiert für die Tagespflege. Die Hersteller geben zwar an, sie hätten eine Pflegedokumentation speziell für die Tagespflege, in Wahrheit sind es allesamt abgespeckte Versionen der schon bestehenden Pflegedokumentationen aus dem vollstationären oder manchmal auch ambulanten Sektor.
Sie können sich also für das ein oder andere Pflegedokumentationssystem entscheiden, 100 Prozent passen wird kaum eines. Gegen ein Dokumentationssystem aus dem stationären Bereich spricht, dass dort zu viele Anforderungen gestellt werden, die für Ihre Tagespflegeeinrichtung keinen Sinn ergeben. (Obwohl der Verkäufer des Programms das vielleicht nachdrücklich beteuert und sogar davon spricht, dass man die einzelnen Vordrucke »speziell angepasst« habe.) Ambulante Dokumentationssysteme sind weniger aufgebläht. Dafür fehlen ihnen aber die für die Tagespflege so wichtigen Elemente der sozialen Betreuung oder der Verpflegung.
Die beste Pflegedokumentation ist die »Selbstgestrickte«. Sie können dazu natürlich auf Vordrucke und Formulare zurückgreifen, die es bereits auf dem Markt gibt. Sie müssen schließlich kein Pflegeberichtsblatt entwerfen oder einen Medikamentenvordruck! Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie eine selbst zusammengestellte Papierdokumentation. Tagespflegen sind nicht so groß, dass Sie hierfür dringend eine EDV-Lösung benötigen würde. Denken Sie bitte nicht, ich sei hinterwäldlerisch und empfehle im 3. Jahrtausend Papier als Dokumentationsmethode. Nein, es ist schlicht weg so, dass mich momentan keines der auf dem Markt befindlichen EDV-Programme für die Tagespflege begeistert.
Tatsächlich brauchen Sie zunächst nicht mehr als sechs Dokumente ( Kap. 1.3.1).
Kap. 1.3.1).

Tipp
Nutzen Sie das Strukturmodell, die ausfüllbare PDF-Version und die dazugehörigen Maßnahmenpläne schreiben Sie in Word. Lassen Sie sich Musterdokumentationen verschiedener Hersteller zusenden.
Wählen Sie aus den Mustervordrucken jene aus, die am ehesten für Ihre Tagespflege passen. Den Rest erstellen Sie selbst. Und: Kein Vordruck muss ewig so bleiben, Sie können immer wieder aufs Neue an Ihren Vordrucken arbeiten und diese besser machen. Sie werden sehen, dass es mit Zeit sogar Spaß macht, das Gute zu verbessern.
Haben Sie bereits EDV-Programme im Einsatz, prüfen Sie sorgsam, ob Sie wirklich alle freigeschalteten Dateien und Buttons für Ihre Tagespflege nutzen möchten. Vieles wird nicht benötigt. Und nice to have ist nicht must have.
1.2 Dokumentationswahrheit und -klarheit
Jede Dokumentation ist eine Sammlung von Daten und Fakten. Wer dokumentiert, schafft Ordnung, speichert Wissen, Erfahrungen und Aktivitäten. Er hält fest und wertet aus. Doch eine Pflegedokumentation ist noch mehr. Sie folgt auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten.

Die beiden Grundsätze der Dokumentation
Dokumentationswahrheit
• Verbot der schriftlichen Lüge
• Gebot der historisch richtigen und vollständigen Darstellung
• Verbot der Urkundenfälschung
Dokumentationsklarheit
• Strukturdisziplin (logisch, nachvollziehbar, lückenlos, eindeutig usw.)
• Sprachdisziplin (verständlich, aussagefähig, eindeutig usw.)
• Schreibdisziplin (lesbar, echt, keine Streichungen oder Gekritzel)
Selbstverständlich sind alle Pflege- und Betreuungskräfte der Meinung, dass sie wahrheitsgemäß dokumentieren. Aber was bedeutet das eigentlich, »wahrheitsgemäße Dokumentation«? Der Begriff »Wahrheit« meint hier so viel wie »wirklicher, wahrer Sachverhalt, Tatbestand«2. Das wiederum bedeutet, dass es sich bei der Dokumentation um Tatsachen handeln muss, die für alle nachvollziehbar und gleich sind. Bei messbaren Kriterien wie z. B. Vitalwerten ist das einfach: Ein gemessener Wert entspricht den Tatsachen und ist für alle gleich und nachvollziehbar. Wie sieht es aber mit Aussagen aus wie »Allgemeinzustand gut« oder »Hat gut gegessen« oder »Kann schlecht laufen«? Sind das noch Wahrheiten? Nein. Das sind Meinungen. So schnell ist die Ebene der Wahrheit also verlassen …
Schauen Sie doch mal in Ihre Dokumentationen – Welche der folgenden Begriffe finden Sie?
• ausreichend
• regelmäßig
• oft
• häufig
• manchmal/selten
• viel/wenig
• zeitweise
• bei Bedarf
• nach Tagesform
• bewegungseingeschränkt
• unauffällig
• sturzgefährdet
• altersentsprechend
• sieht gut/schlecht aus
• besser/schlechter
• AZ gut/schlecht
• EZ gut/schlecht
• verwirrt
• desorientiert
• unruhig
• aggressiv
• versorgt nach Plan
All diese Begriffe sind keineswegs verboten. Aber sie sind nutzlos, weil schon nach wenigen Wochen niemand mehr weiß, was eigentlich gemeint war. Eine Dokumentation muss aber wenigstens zehn Jahre aufbewahrt werden und sollte auch dann noch aussagekräftig sein.

Tipp
Schreiben Sie auf, was Sie sehen, hören und wahrnehmen, nicht aber das, was Sie denken. So einfach ist eine gute, aussagekräftige Dokumentation!
Tab. 1: Dokumenteren leicht gemacht
| Vorher | Nachher |
| Hat ausreichend gegessen | Hat 2 Brötchen gegessen |
| Ist oft nass | Nässt ca. 2–3-mal ein |
| Hat wenig getrunken | Hat heute 300 ml getrunken |
| Novalmin bei Bedarf | Novalmin bei Schmerzen am Bewegungsapparat |
| Kann nach Tagesform alleine essen | Wenn sie die Kraft hat, isst sie allein, das kommt ca. 2-mal/Woche vor |
| Bewegungseingeschränkt | Zieht das rechte Bein nach, geht schleppend |
| Unauffällig | Ist freundlich zurückhaltend |
| Sturzgefährdet | Steht zu schnell auf und kippt vornüber |
| Es geht ihr besser | Sie hat keine Erkältungsanzeichen mehr |
| AZ schlecht | Wirkt müde, kann sich nicht konzentrieren, steht nicht sicher, RR bei 110/70 |
| Ist verwirrt | Fragt, wann die Soldaten zum Frühstück kommen |
| Ist unruhig | Hat Angst, nicht mehr nach Hause zu kommen oder abgeholt zu werden, fragt immer wieder nach |
Eine Dokumentation soll nicht nur wahrheitsgemäß sein, sie muss auch echt sein. Die Echtheit einer Dokumentation bezieht sich zum einen auf das Schreibgerät, das Sie benutzen. Bleistift oder Füller sind verboten. Genauso wie die Benutzung von Tipp-Ex. Es darf nämlich nichts ausradiert oder gelöscht werden. Echtheit bedeutet aber auch, dass jeder selbst einträgt. Da darf Helga nicht für Paula dokumentieren und Karl nicht für Rainer. Jeder dokumentiert selbst.
Eine weitere Anforderung heißt »Keine Streichung«. Für erbrachte Leistungen dürfen Sie nicht einfach Strichlisten führen, auch wenn das bei Getränken so schön einfach wäre. Doch die Striche könnten verändert werden – und genau das darf nicht passieren. Striche sind eben nicht »dokumentenecht«.
»Keine Streichungen« bedeutet natürlich auch, dass Sie keine Eintragungen durchstreichen. Wenn Sie einen Eintrag als ungültig kennzeichnen wollen, sollten Sie ihn mit den »Buchhalternasen« einklammern: <ungültig>. Sie dürfen ein Wort auch einfach durchstreichen, wenn das ursprüngliche Wort noch lesbar ist. Also statt ungültig so durchzustreichen, sollte es so geschehen: ungültig, so dass das zuerst Geschriebene durchaus noch lesbar bleibt.
Lesbarkeit ist eine weitere Anforderung. Ihre Handschrift – und die Ihrer Mitarbeiter – muss lesbar sein. Spätestens jetzt wünschen Sie sich die EDV-Lösung? Tatsächlich setzt sich Kollege Computer immer mehr durch. Das hat nicht nur mit der Lesbarkeit zu tun, aber es erleichtert die Sache enorm.
1.2.1 Verletzung von Dokumentationsgrundsätzen
Ich kenne keine Pflegekraft, die wegen mangelnder Wahrheit oder Klarheit ihrer Dokumentation strafrechtlich verfolgt wurde. Trotzdem gehören die Gesetze dazu, denn das Strafgesetzbuch kennt eine Reihe von Problemen, die im Zusammenhang mit Dokumenten auftauchen. Es sind die Paragrafen 267, 268, 269, 270 und 271 StGB (Strafgesetzbuch).
Tab. 2: Dokumentaton und das Strafgesetzbuch
Sie mögen vielleicht lächeln, wenn Sie diese Paragrafen lesen und dabei an die Pflegedokumentation denken. Doch das Lächeln könnte Ihnen vergehen, wenn Sie – aus lauter Nächstenliebe – für Ihren netten Kollegen eine Medikamentengabe dokumentierten, diese aber nicht oder in falscher Dosierung erfolgte und der Tagesgast dadurch Schaden nimmt. Denken Sie darüber einfach mal nach.
1.3 Anforderungen an die Dokumentation in der Tagespflege
Wenn es um die Dokumentation geht, gibt es viele Meinungen. Die Frage ist nur, wer hat nun recht? Es gibt nur wenige, schriftlich verankerte Anforderungen an die Pflegedokumentation. Das meiste, was Sie bisher gehört haben, sind also persönliche Meinungen Einzelner. Meinungsfreiheit ist in Deutschland glücklicherweise ein Grundrecht. Ein Problem gibt es nur, wenn ein Einzelner seine persönliche Meinung als die allein gültige Wahrheit verkaufen will. Bedenken Sie bitte, jeder MDK-Prüfer fängt mit dem Wissen beim MDK an, das er bis dato erlangt hat. Das sagt sogar der MDK selbst: »Die gutachterliche Tätigkeit der etwa 3 000 Pflegefachkräfte des MDK basiert auf dem Wissen und auf den Erfahrungen, die die Pflegefachkräfte in ihrer Ausbildung und ihrer bisherigen Berufstätigkeit im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder Altenpflege erworben haben.«3 War ein Prüfer bisher der Meinung, man müsse eine Pflegeplanung alle acht Wochen evaluieren, so wird er dies auch bei seinen Prüfungen in Ihrer Tagespflege fordern. Da dürfte es ihm einerlei sein, dass es dafür keine rechtliche Grundlage gibt und die Prüfanleitung auch nichts Entsprechendes vorsieht.
Wer vor seiner Tätigkeit beim MDK lange als Hygienefachkraft arbeitete, wird auch in seinen Prüfungen sehr auf Hygiene achten. Das ist menschlich. Wir sind alle von unseren Erfahrungen geprägt und unsere Routinen stellen wir nicht mehr wirklich in Frage. Natürlich werden die Prüfer vom MDK eingearbeitet und auch laufend weitergebildet. Doch das Grundwissen wird bereits beim Berufseinstieg vorausgesetzt. Die Prüfer werden nicht mehr auf alle einzelnen Fragen der Prüfanleitung geschult. Deshalb kann es Ihnen passieren, dass Sie drei MDK-Prüfer mit drei völlig unterschiedlichen Ansichten zu ein und derselben Akte erleben. Das ist an sich nicht schlimm, ein Meinungsaustausch lohnt sich immer.

Tipp
Hören Sie dem Prüfer vom MDK zu. Aber seien Sie nicht gleich seiner Meinung, sondern lesen Sie die Prüfanleitung oder stellen Sie die wichtigste Frage überhaupt: »Wo steht das?«
Aber nicht nur unter den MDK-Prüfern herrscht Uneinigkeit. Auch viele Leitungskräfte haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie zu dokumentieren ist. Schließlich gibt es auch viele PDL-Weiterbildungen, mal sind es 460 Basisstunden, mal 1800 Stunden oder gar ein Managementstudium. Das führt natürlich zu unterschiedlichen Kompetenzen. Um Grundwissen geht es bei keiner Weiterbildung. Man geht jeweils stillschweigend davon aus, dass Leistungskräfte keine Pflegedokumentationsschulungen brauchen. Deshalb bauen einige auf ihr Grundwissen, andere leben vom Hörensagen, kennen aber weder die Entwicklung noch die rechtliche Grundlagen.
Hinzu kommt, dass eine Leitungskraft, die aus dem stationären Altenhilfebereich kommt, stationär geprägt ist. Kommt sie aus dem ambulanten Bereich, liegen ihre Stärken eher dort. Das wirkt sich natürlich auf die Dokumentation aus, mal positiv, mal negativ. Manchmal kommt es auch zum »Dokumentationswahnsinn« mit einer überbordenden Fülle von Dokumenten. Auch Dokumentationshersteller wollen vor allem eines: verkaufen. Das sieht man, wenn man im Internet nach Pflegedokumentationen für die Tagespflege sucht. Dort unterscheidet ein Hersteller bereits auf seiner Startseite zwischen »Pflichtvordrucken« wie die Pflegeanamnese nach AEDL, und freiwilligen Vordrucken wie »Informationen an den Arzt«. Dieses angebliche Pflichtformular hat natürlich die DIN A3-Form und ist doppelseitig bedruckt.
1.3.1 Die wichtigsten schriftlichen Anforderungen an eine Pflegedokumentation
Nicht nur jeder Vorgesetzte, Kollege und MDK Prüfer. Nein, auch die Schulen unterrichten different. Fachbuchautoren und Referenten bringen ihr Wissen, ihre Haltung und ihre Meinung ins Spiel. Das alles ist legitim und gut. Denn nur der Austausch und die Meinungsunterschiede können zu einer Entwicklung führen. Wenn niemand das Bestehende hinterfragt, geht es nie weiter. Und wer heute still steht ist morgen von gestern.
Da es sehr wenige rechtliche Anforderungen gibt, habe ich Ihnen die wichtigsten gültigen schriftlichen Anforderungen zu Pflegedokumentation aufgelistet. Wir beginnen mit der Basis, dem Pflegeprozess. Denn der soll ja in der Dokumentation abgebildet werden. Der Pflegeprozess ist seit vielen Jahren (in der Altenpflege spätestens seit 1996 in der ersten Prüfanleitung) in der Pflegedokumentation abzubilden. Die Frage ist nur, wie. Der Pflegeprozess kann mit sechs Vordrucken oder mit 30 abgebildet werden. Wobei in der Dokumentation Masse noch nie mit Klasse gleichzusetzen war. Der Pflegeprozess wird – vorwiegend in Deutschland – bereits seit den 1980er-Jahren nach dem Regelkreis von Verena Fiechter und Martha Meier abgebildet.

Abb. 1: Pflegeprozess nach Fiechter & Meier.
Nach dem Pflegeprozess von Fiechter & Meier ( Abb. 1) geht es um sechs Schritte:
Abb. 1) geht es um sechs Schritte:
1. Infosammlung
– Stammblatt
– Pflegebericht
– Infosammlung ist auch gleichzeitig
2. Probleme/Ressourcen
– inkl. Anamnese und
– inkl. Biografie
– inkl. Risikoerkennung statt Assessments und
– Ziele sowie Evaluation
– Ärztliche Verordnung
– Infosammlung auf der die neuesten Informationen stehen, somit evaluiert und Ergebnis selbsterklärend überprüft
4. Maßnahmenplan
– Tagesstruktur oder
– Pflegeplan sowie
– ärztliche Verordnung
5. Durchführung
– Leistungsnachweis
6. Evaluation/Kontrolle
– Infosammlung auf der die neuesten Informationen stehen, somit evaluiert und Ergebnis selbsterklärend überprüft
Wenn Sie den Pflegeprozess in der Dokumentation abbilden wollen, kommen Sie mit sechs Vordrucken aus.
1. Informationssammlung: Diese beinhaltet Anamnese, Probleme, Ressourcen, biografische Hinweise und Risiken
2. Pflegebericht
3. Ärztliche Verordnung
4. Tagesstruktur oder Pflegemaßnahmenplan
5. Leistungsnachweis
6. Stammblatt
Gern genutzt werden in der Praxis auch folgende Vordrucke:
• Anamnesebogen
• Vordruck für ärztliche Kommunikation
• Vitalwertebogen
• Biografiebogen
• Assessment Dekubitusrisiko
• Assessment Mangelernährung
• Assessment Sturzrisikoerhebung
• Assessment Kontrakturrisikoerfassung
• Assessment Kontinenzstatus
• Pflegeplanungsvordruck mit drei/vier Spalten
• Pflegeplanung nach AEDLs oder ATLs
• Etc.
Sie brauchen diese Vordrucke nicht. Ein eigener Anamnese-Vordruck erübrigt sich, wenn Sie die ersten Angaben des neuen Gastes bereits anderweitig dokumentiert haben, z. B. in der Planung oder in der Strukturierten Informationssammlung (SIS®). Auch auf einen separaten Vordruck für die ärztliche Kommunikation können Sie verzichten, denn wenn es dem Kunden nicht gut geht und ärztlicher Beistand benötigt wird, steht das schon im Pflegebericht. Auch das Biografieblatt können Sie zur Seite legen. Die pflegerelevanten biografischen Angaben können in der Pflegeplanung, der Tagesstruktur oder in der SIS® stehen.
Auch Assessments werden nicht benötigt, wenn es eine pflegefachliche Einschätzung durch eine Pflegefachkraft gibt. Das ergibt sich einerseits aus den Expertenstandards, in denen jeweils unter der Prozessqualität 1 zu lesen ist, dass die Risikoeinschätzung Sache der Fachkraft ist. Das einzige Assessment, das Sie evtl. brauchen, ist eines, wenn Schmerzen oder schmerzbedingte Probleme auftreten.
Selbst die klassische Pflegeplanung hat schon länger ausgedient. Aber spätestens bei Einführung von SIS® oder 2021, wenn die neue QPR ihre volle Wirkung entfaltet, geht es um eine sinnvolle, strukturierte Maßnahmenplanung.
Sollte Ihnen also ein Prüfer des MDK die Frage nach einem bestimmtem Vordruck stellen, bleiben Sie ganz ruhig und fragen Sie zurück: »Was suchen Sie denn eigentlich?« Lautet die Antwort: »Das Biografieblatt«, können Sie weiter fragen: »Welche biografische Angaben meinen Sie genau?« Sucht er die Wünsche und Bedürfnisse in der Pflege, so stehen diese in der Infosammlung, der SIS® oder der Pflegeplanung. Fragt der Prüfer, wo das Beratungsprotokoll ist, zeigen Sie die Beratung im Bericht, in der Infosammlung, in der SIS® oder der Pflegeplanung.
Noch einmal: Sie benötigen keine separaten Protokolle. Wenn jemand nach den Assessments fragt, fragen Sie zurück, was genau gesucht wird. Denn wenn die fachliche Einschätzung an einer anderen Stelle dokumentiert ist, z. B. in der Informationssammlung, der SIS® oder der Pflegeplanung, brauchen Sie keinen weiteren Vordruck oder Assessment. Verlassen Sie sich auf die Prüfanleitung des MDK. Dort wird nicht nach einem Assessment oder Beratungsprotokoll gefragt, nicht einmal nach der Pflegeplanung. Die Informationen zum Risiko können in der Informationssammlung (SIS® oder Pflegeplanung) stehen.

Tipp
Weniger ist manchmal mehr. Nutzen Sie besser weniger Vordrucke als zu viele. Verzichten Sie auf Assessments und Nebenprotokolle. Dokumentieren Sie stattdessen in der Informationssammlung, der SIS® oder der Pflegeplanung.
1.4 Befindlichkeiten notieren: der Pflegebericht
Auch zum Pflegebericht gibt es keine Vorschriften. Es ist weder festgelegt, wie ein Bericht auszusehen hat, noch, wie er zu führen ist, und vor allem nicht, wie oft das geschehen soll. Diese fehlenden Vorschriften führen dazu, dass Pflegeberichte zu einem Sammelsurium für alles Mögliche werden. Dort werden Informationen und Probleme gesammelt (Rötungen, Schmerzen, Verhalten, Missempfindung und Wohlbefinden der Kunden). Da finden sich Leistungen, die bereits abgezeichnet sind (»Frau M. hat am Singen teilgenommen«). Da werden pflegefremde Tätigkeiten notiert (»Herr. Sch. hatte heute Physiotherapie«). Oder es werden nicht pflegerelevante Themen notiert (»Frau T. trägt eine schmutzige Hose« – »Die Tochter von Frau S. roch nach Alkohol«) etc. Solche Einträge sind unprofessionell. Notiert wird all dies und noch viel mehr aus reiner Verlegenheit. Man weiß einfach nicht, was man in einen Pflegebericht schreiben soll.
Auch die neuen Qualitätsprüfungs-Richtlinien und die MDK-Anleitung zur Prüfung der Qualität geben nichts her, wenn es um die Anforderungen an einen professionellen Pflegebericht geht. Das Wort »Pflegebericht« taucht im gesamten Prüfkatalog nicht auf. Es lässt sich nur herauslesen, dass die Dokumentation aktuell sein muss, dass z. B. Veränderungen der Haut dokumentiert sein müssen (Prüffrage 1.4).
Natürlich sollte ein Pflegebericht auch außerhalb der MDK-Prüfung einen Sinn haben. Den hat er auch, wenn Sie folgende Aspekte dabei beachten:
• Hinweise auf das Befinden des Tagesgastes
• Hinweise auf wichtige Veränderungen und Beobachtungen
• Reaktion der Mitarbeiter bei Feststellung von Veränderungen (körperlich, geistig, seelisch)
• Reaktion des Tagesgastes auf bestimmte Maßnahme
• Wirkungsbeurteilungen von ergriffenen Maßnahmen nach Vorkommnissen
• Verlauf bei Ereignissen etc.
Es steht auch nirgends, wie oft etwas in den Pflegebericht eingetragen werden muss. Einmal am Tag, einmal pro Besuch, einmal pro Woche? Meine Antwort: Es kommt darauf an. Die Verpflichtung, regelmäßig Einträge zu machen, führt dazu, dass Unsinniges eingetragen wird (»Keine Besonderheiten« – »Insulin nach Plan gespritzt« – »Medikamente nach Plan verabreicht«).
Auch und gerade in der Anwendung des Strukturmodells gibt es keine regelhaften Berichtseinträge mehr. So steht es auch in den Schulungsunterlagen4:
• »Abweichungen von den geplanten wiederkehrenden Maßnahmen der pflegerischen Versorgung und der Betreuung
• gezielten/geplanten und zeitlich befristeten Beobachtungen auf Grundlage der Erkenntnisse der SIS® und der Risikomatrix
• tagesaktuellen Ereignissen und ggf. Reaktionen«
Sie müssen nicht befürchten, dass nun wochenlang gar nichts eingetragen wird. Das kann nicht passieren. Wenn ein Tagesgast dreimal pro Woche kommt, dann gibt es auch etwas über ihn zu berichten. Manchmal ist es nur ein kurzer Eintrag zu seinem Befinden. Es ist ja Ihr Anliegen, dass es Ihren Gästen gut geht. Sie werden Ihre Gäste also fragen, wie es Ihnen geht – und dann dokumentieren, was Sie erfahren haben: Etwas über sein Befinden, Beobachtungen zu geistigen, seelischen oder körperlichen Veränderungen, Verläufe nach besonderen Vorkommnissen, Wirkungen von pflegerischen Maßnahmen, Reaktionen auf besondere Pflegemaßnahmen, Änderungen von geplanten Maßnahmen, ungeplante Maßnahmen etc.

Hinweis
Machen Sie keinen Eintrag, wenn es nichts zu berichten gibt. Aber: Sobald Sie fragen, wie es Ihrem Gast geht, werden Sie eine Fülle von Informationen erhalten – die Sie eintragen können. Stellen Sie das Geschehen präzise dar.

Abb. 2: Schema für die Behandlung eines Vorkommnisses.
Hat Ihr Tagesgast z. B. Durchfall, Rötungen, Schmerzen oder verändert er sich psychisch, dann müssen Sie darauf reagieren und den weiteren Verlauf beschreiben. Jedes Vorkommnis sollte nach einem festen Schema abgehandelt werden ( Abb. 2).
Abb. 2).
Bei jedem Tagesgast sollte jeden Tag der Bericht gelesen werden. Dann merken Sie und Ihre Mitarbeiter, dass ggf. eine Handlung fehlt, eine Reaktion und können die Geschehnisse abschließen. Der Abschluss eines Berichtes kann auch später erfolgen, wenn der Kunde nicht jeden Tag in die Tagespflege kommt ( Tab. 3,
Tab. 3,  Tab. 4).
Tab. 4).
Tab. 3: Beispiel 1
| Dat. | Uhrzeit | HZ | |
| 2.4. | 13:30 | Frau Sch. hat einmalig nach dem Frühstück erbrochen, Tee und Zwieback angeboten. Bis zum Nachhausegehen kein weiteres Erbrechen oder Übelkeit. | JK |
| 4.4. | 8:45 | Frau Sch. ist heute wieder zur Tagespflege; sagt, ihr sei nach Montag (2.4.) nicht mehr übel gewesen. | HU |
Tab. 4: Beispiel 2
| Dat. | Uhrzeit | HZ | |
| 8 .9. | 15:30 | Herr R. hat eine Rötung (wegdrückbar) am Gesäß, rechte Gesäßhälfte auf der Sitzfläche, mehr zur Analfalte hin, ca. 5 cm Durchmesser. Habe ihn gebeten, sich zwischendurch mal auf der Comfortliege auszustrecken, um das Gesäß zu entlasten. Beraten, auch zu Hause nicht mehr als zwei Stunden zu sitzen. | JK |
| 10.9. | 16:45 | Bei den Toilettengängen Haut inspiziert, kein Hinweis auf Rötung. | HU |
Natürlich kommt es auch mal vor, dass man vergisst, etwas einzutragen. Das sollte nicht zur Regel werden, aber es ist menschlich. Hier müssen Sie aber beachten, dass der Eintrag wahrheitsgemäß geführt wird. Datum und Uhrzeit müssen immer den Tatsachen entsprechen ( Tab. 5). Wenn Sie am 10. Juli um 16:30 Uhr etwas eintragen, das bereits um 15:15 Uhr geschah, ist das Datum der 10. Juli, die Eintragungszeit 16:30 Uhr und im Text steht dann, was sich um 15:00 Uhr ereignete:
Tab. 5). Wenn Sie am 10. Juli um 16:30 Uhr etwas eintragen, das bereits um 15:15 Uhr geschah, ist das Datum der 10. Juli, die Eintragungszeit 16:30 Uhr und im Text steht dann, was sich um 15:00 Uhr ereignete:
| Dat. | Uhrzeit | HZ | |
| 10.7. | 16:30 | Frau K. ist um 15:15 auf dem Weg zur Toilette gestolpert … | JK |
Liegt noch mehr Zeit dazwischen, notieren Sie deutlich, dass es sich um einen Nachtrag handelt ( Tab. 6).
Tab. 6).
Tab. 6: Beispiel 4
| Dat. | Uhrzeit | HZ | |
| 10.7. | 8:30 | Nachtrag zum 9.7. ca. 16:50 Uhr: Frau L. hat auf dem Nachhauseweg erzählt, dass sie … | JK |

Hinweis
Datum und Uhrzeit im Bericht beziehen sich immer auf die Dokumentationszeit, nicht auf den Zeitpunkt des Vorkommnisses.
1.5 Vitalwerte erheben
Viele Einrichtungen erheben routinemäßig einmal monatlich die Vitalzeichen: Blutdruck, Gewicht, Blutzucker etc. Natürlich gibt es kein Verbot einer routinemäßigen Kontrolle, aber es gibt auch keine Pflicht, all diese Daten routinemäßig zu erheben. Leider kommt es auch häufig vor, dass die Vitalwerte zu unterschiedlichen Zeiten erhoben werden. Da wird der Blutdruck mal morgens um 9:00 Uhr und dann wieder mittags um 13:00 Uhr ermittelt. Solche Werte sind aber nicht vergleichbar und somit nicht verwertbar.
Außer für die Gewichtsermittlung gibt es keine Vorschriften, es sei denn, es liegt eine ärztliche Verordnung vor. Wer also den Blutdruck misst, muss wissen, wozu dieser Wert dienen soll. Und er sollte stets zur gleichen Tageszeit erheben.
Das Gewicht ist im Rahmen der Risikoermittlung wichtig. Der Expertenstandard »Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege« ist eine Risikoerfassung. Selbstverständlich muss dazu das Gewicht, sofern möglich und erwünscht, kontrolliert werden – zu Beginn des pflegerischen Auftrags und in regelmäßigen Abständen, alle drei Monate. Verlangt ein Prüfer etwas anderes, fragen Sie bitte, wo das in den QPR steht.
1.6 Ärztliche Verordnungen
In der Tagespflege haben Sie mit ärztlichen Verordnungen eher weniger zu tun. Aber manche Gäste bringen ihre Tabletten mit, mal sortiert in einer Dosette oder lose in der Tasche. Wenn Sie nun tätig werden, müssen Sie das so tun, dass Sie auf der sicheren Seite sind. Das bedeutet: Sie dürfen die Medikamente nur nach ärztlicher Anordnung stellen. Eigentlich sollten Sie sich gar nicht in die Einnahme der Medikamente einmischen. Doch leider wird oft erwartet, dass Sie in der Tagespflege die Tabletteneinnahme überwachen. Doch wer durchführt, haftet auch für die Durchführung.
Was also, wenn Ihr Gast nach einer Tabletteneinnahme Probleme bekommt? Welche Tabletten wurden verabreicht? Von wem? Auf wessen Anordnung hin?
Sicherlich würden Sie 10 i.E. Insulin nie ohne ärztliche Verordnung verabreichen. Das ist auch bei einem oralen Antidiabetikum oder einem Herzmittel nicht anders!
In der Prüffrage 2.1 wird das deutlich: »Die folgenden Fragen sind nur zu bearbeiten, wenn Unterstützungsbedarf beim Umgang mit Medikamenten vorliegt oder die Einrichtung einen Auftrag zur Mitwirkung bei der Durchführung hat.« In dem Moment, in dem Sie dem Tagesgast bei der Medikamenteneinnahme helfen, gilt auch die Prüffrage, egal ob Sie gerichtet haben oder die Tochter zuhause. Weiter heißt es in der QPR: »Sofern die Medikamentengabe bereits in der Häuslichkeit vorbereitet wurde (vorbereitete Tagesdosis), ist mit den An- und Zugehörigen zu besprechen, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Dosierung und das Medikament der ärztlichen Anordnung entsprechen. Dies ist zu dokumentieren. Sobald zu dieser Problematik neue Expertise vorliegt, ist eine Anpassung der Maßstäbe und Grundsätze für die Tagespflege zu prüfen.«
Das bedeutet, immer wenn Sie einem Tagesgast bei der Einnahme helfen und keine ärztliche Verordnung vorliegt, sollten Sie sich von den Personen, die gerichtet haben, erklären lassen, dass das Richten der Medikamente nach ärztlicher Verordnung erfolgt ist. Ich würde zudem empfehlen, eine Kopie der verordneten Medikamente zu verlangen. Schließlich sollten Sie wissen, was Sie da an Medikation verabreichen.

Tipp
Die ärztliche Anordnung muss eingehalten werden, hierzu bedarf es auch der Vorlage einer solchen. Lassen Sie sich die Medikamentenpläne geben.
Gleiches gilt auch für die Bedarfsmedikation, diese wird ebenfalls unter Prüffrage 2.1 hinterfragt. Eine genaue Anordnung ist auch für die Bedarfsmedikation nötig. Der Bedarf muss eindeutig benannt sein und keinen Raum für Spekulationen lassen. Neben dem verordnenden Arzt muss das Anordnungsdatum, das Medikament, die Darreichungsform, der Bedarf (= Indikation), die Einzeldosis und die Maximaldosis für 24 Stunden genau benannt werden ( Tab. 7).
Tab. 7).
Tab. 7: Dokumentaton der Bedarfsmedikaton
| Dat. | Uhrzeit | HZ | |
| 2.3. | 10:30 | Dr. Fritz; Novalgin Tropfen bei Knieschmerz 20 Tr., maximal 3 × 14;× 20 Tr. | JK |
Wenn Sie die Medikamente stellen, verwalten Sie diese auch. Das bedeutet, die Aufbewahrung muss den Reglements entsprechen. Dazu gehört:
»Die Lagerung und Vorbereitung der Medikamente ist fachgerecht, wenn
• die gerichteten Medikamente mit den Angaben in der Pflegedokumentation übereinstimmen,
• diese personenbezogen beschriftet aufbewahrt werden,
• ggf. eine notwendige Kühlschranklagerung (2–8 °C) erfolgt,
• diese als Betäubungsmittel verschlossen und gesondert aufbewahrt werden,
• bei einer begrenzten Gebrauchsdauer nach dem Öffnen der Verpackung das Anbruchs- oder Verbrauchsdatum ausgewiesen wird (es muss zweifelsfrei erkennbar sein, um welches Datum es sich handelt).«5
1.7 Leistungsnachweis
1.7.1 Leistungsnachweise bei Anwendung von Pflegeplanungen
Jede Pflegekraft muss Leistungen dokumentieren. Aber es ist nicht vorgeschrieben, auf welche Art und Weise! So hat jeder Hersteller Vordrucke entwickelt, die auf einer DIN A 4-Seite jeden Tag die Handzeichen für jede einzelne Leistung einfordert. Und das auch noch getrennt nach Grundpflege, Betreuung und Behandlungspflege. Und schon hat man drei Nachweise in der Akte, z. B.:
Tab. 8: Grundpflegeleistungen
| Grundpflegeleistungen | Handzeichen |
| Frühstücksbegleitung | JK |
| Getränkerunde | |
| Toilettengang | GT |
| Getränkerunde | JK |
| Gemeinsame Zwischenmahlzeit | JK |
| Getränkerunde | JK |
| Toilettengang | GT |
| Gemeinsames Mittagessen | JK |
| Mittagsruhe | JK |
| Toilettengang | JK |
| Gemeinsamer Nachmittagskaffee | GT |
| Toilettengang | GT |
| Getränkerunde | GT |
Tab. 9: Behandlungspflegeleistungen
| Behandlungspflegeleistungen | Handzeichen |
| Insulin spitzen nach äVO 7:45 Uhr | BA |
| Medikamente verabreichen früh | BA |
| Augentropfen verabreichen | BA |
| Medikamente verabreichen mittags | BA |
Tab. 10: Betreuungsleistungen
| Betreuungsleistungen | Handzeichen |
| Gemeinsames Tischdecken | TU |
| Zeitungsrunde | TU |
| Spielerunde | ER |
| Backen/Kochen | TU |
| Singen/Instrumente | PP |
Für die Durchführungs- oder Leistungsnachweise gibt es keine Vorschriften – es sei denn, Sie haben in Ihrem Versorgungsvertrag etwas dazu stehen. Schließlich hat jede Einrichtung einen anderen Vertrag. Wenn Sie aber jetzt schon oder künftig mit der Strukturierten Informationssammlung arbeiten, werden Sie gar keine Grundpflegeleistungen mehr abzeichnen.
Wenn Sie Leistungen auf einem Leistungsnachweis und/oder Durchführungskontrollblatt abzeichnen, gelten die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Dokumentation ( Kap. 1.2). Das bedeutet: Jede Leistung muss einer Person zuzuordnen sein, die auch die Verantwortung trägt. Das bedeutet wiederum, dass man ein Handzeichen benötigt, mit Strichen kann man nichts nachweisen.
Kap. 1.2). Das bedeutet: Jede Leistung muss einer Person zuzuordnen sein, die auch die Verantwortung trägt. Das bedeutet wiederum, dass man ein Handzeichen benötigt, mit Strichen kann man nichts nachweisen.

Tipp
Wer Leistungsnachweise führt, sollte diese auf das notwendige Maß reduzieren. Weniger ist manchmal mehr.
Das Abzeichnen muss aber keinesfalls mit 17 Handzeichen pro Tagesgast geschehen. Die Leistungen können selbstverständlich auch gebündelt werden ( Tab. 11).
Tab. 11).
Tab. 11: Von Einzelleistungen zu Leistungskomplexen

1.7.2 Leistungsnachweise bei Anwendung der SIS®
Wer aufs Strukturmodell umgestellt hat, darf sich freuen. Es werden keine Einzelnachweise für die Grundpflege und auch nicht für jede Betreuung erforderlich. Nachgewiesen werden müssen aber, mit eindeutiger Zuordnung zur Person, die Behandlungspflege und die Dekubitusprophylaxe.
Gemäß den offiziellen Schulungsunterlagen (Seite 19) ist Folgendes immer nachweislich zu dokumentieren:
• »Anwesenheit des Tagesgastes,
• Leistungen nach § 45b SGB XI,
• Behandlungspflegerische Maßnahmen,
• Bewegungsprotokolle bei Dekubitusrisiko,
• Individuell festgelegte Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements (zeitlich befristet).«
Im Detail bedeutet das:
• Jede Anwesenheit des Tagesgastes wird dokumentiert.
• Leistungen nach § 45b sind Leistungen, für die 125 Euro pro Monat und pro Pflegebedürftigen abgerechnet werden können. Also Leistungen, die von zusätzlichen Betreuungskräften erbracht werden. Nur diese Leistungen sind zu dokumentieren, weitere Betreuungsleistungen nicht.
• Alles, was der Arzt anordnet, und was die Tagespflege dem Gast mit Unterstützung gibt, ist einzeln nachzuweisen. Es reicht sicher nicht, am Ende eines Tages zu quittieren, dass man dreimal Tabletten gegeben hat.
• Sollten Sie Bewegungsprotokolle haben müssen, weil ein Tagesgast zu wenig Eigenmobilität besitzt, ist jeder Positionswechsel nachzuweisen.
• Individuell festgelegte Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements bedeuten z. B. Ess- oder Trinkprotokolle. Diese sollten aber keineswegs für jeden Gast und bei jeder Anwesenheit geführt werden. Protokolle sind stets individuell anzuwenden, also, wer benötigt eines und warum? Die Protokolle sind zeitlich befristet. Das heißt, wenn Sie ein Trinkprotokoll erheben, führen Sie es so lange, bis Sie die tägliche Trinkmenge im Schnitt erfasst haben.
1.8 Pflegeplanung ohne Schnörkel
Pflegeplanungen sind für viele Pflegekräfte ein lästiges Übel. Es werden oft viel mehr Informationen gesammelt, als verarbeitet werden können. Die richtige Gewichtung der Probleme erfolgt nun im zweiten Schritt des Pflegeprozesses.
1.8.1 Probleme erkennen, Ressourcen finden
Viele Pflegekräfte fragen sich: »Was ist nun das Problem?« – »Welche Ressourcen hat der Gast?« Manchmal ist gar kein Problem da, doch die Pflegekräfte trauen sich nicht, eine Spalte einfach leer zu lassen. Wer seit Jahren nach den AEDL oder ATL schreibt, glaubt häufig, er müsse zu jedem Punkt etwas schreiben. Andere Pflegekräfte wissen nicht so recht, wer eigentlich ein Problem hat – der Pflegebedürftige oder der Angehörige? – und schon stockt das Schreiben.
Viele Probleme sind gar keine! Oft genug ist ein angebliches Problem eher eine Feststellung oder ein Defizit. Schauen Sie sich einmal diese Liste an:
• Ist schwerhörig.
• Ist auf Brille angewiesen.
• Ist gehbehindert.
• Ist übergewichtig.
• Ist untergewichtig.
• Ist sturzgefährdet.
• Ist inkontinent.
• Ist insulinpflichtiger Diabetiker.
• Hat niedrigen Blutdruck.
• Chronischer Schmerzpatient.
• Nimmt nicht an Gruppenangeboten teil.
Das alles sind reine Feststellungen, pure Informationen. Wer diese Probleme lösen will, wird sehr viel Mühe damit haben. Eine Schwerhörigkeit, Überoder Untergewicht, ein Diabetes oder eine Inkontinenz sind nur sehr schwer zu lösen.
Diese Informationen gehören zum ersten Schritt des Pflegeprozesses, der Informationssammlung. Sie sind weder ein Problem noch eine Ressource. Sie werden, wenn überhaupt, nur als Information in der Spalte »Probleme und Ressourcen« mitgeführt, weil sie Ursachen für Probleme sein können. Abbildung 3 zeigt Ihnen einige Beispiele.

Eine Information kann eine Ursache für ein Problem sein oder ein Hinweis bei einer bestehenden Ressource.
Die Beispiele in Abbildung 3 zeigen, dass nicht jede Information auch ein Pflegeproblem darstellt. Eine Information kann auch eine Ressource begründen oder bestätigen. Aber muss man dann noch eine Pflege planen? Ja! Sie können nicht einfach feststellen, dass jemand humpelt, ohne dass Sie diese Information bewerten und bearbeiten. Als Fachkraft müssen Sie eine fachliche Einschätzung zu bestimmten vorliegenden Tatsachen machen. Sie müssen einschätzen, ob aus einer Gangunsicherheit ein Problem wird, oder ob dem Rollstuhlpflichtigen eine Gefahr droht, die er selbst nicht einschätzen kann.

Tipp
Gehen Sie ressourcenorientiert vor und planen Sie auch so. Sie müssen keine Pflegeprobleme »erfinden«.
Das Gute an der ressourcenorientierten Betrachtung ist auch, dass Sie als Pflegekraft weniger Verantwortung haben. Wenn ein Gast selbstständig zur Toilette geht, kann er dort stürzen oder einen Ileus erleiden. Aber dafür kann Sie niemand haftbar machen. Alles, was ein Mensch selbstständig regelt, kann im Allgemeinen keinem Dritten zur Last gelegt werden. Es sei denn, Ihre fachliche Einschätzung fehlte und es erfolgte auch keine Beratung.
Wenn Sie ressourcenorientiert planen, haben Sie nicht nur weniger Arbeit. Sie zeigen damit auch Ihre Wertschätzung dem Gast gegenüber. Nur weil jemand alt ist, muss er noch lange nicht bevormundet werden.
• Ist der Gast eher zierlich, lassen Sie ihn so sein, wie er ist. Das ist in Ordnung, solange er nicht ungewollt an Gewicht verliert.
• Hat der Gast Schwierigkeiten beim Gehen, kann aber allein gehen, lassen sie ihn das auch tun. Jede Einschränkung der Mobilität bedeutet zwangsläufig eine Verschlechterung von Mobilität und Beweglichkeit. Und damit auch einen Verlust an Selbstständigkeit und Selbstvertrauen.

Hinweis
Pflegeprobleme ergeben sich aus einer strukturierten Informationssammlung bzw. aus den Maßnahmen. Denn jede Maßnahme hat ein Probeproblem als Auslöser. Umgekehrt gilt: Gibt es kein Problem, gibt es auch keine Maßnahme.
Bei neuen Gästen können Sie die Pflegeprobleme und Ressourcen nicht immer sofort einschätzen. Hier hilft Ihnen immer der Blick auf die Maßnahmen. Daran erkennen Sie, wo der Tagesgast ein Pflegeproblem hat.
Maßnahme und Pflegeproblem stehen immer in Bezug zueinander und sind wie eine Waage. Die Menge an Maßnahmen ergibt die Menge an Problemen. Sind mehr Maßnahmen notiert als Probleme, führt das zu einem Ungleichgewicht ( Abb. 4). Ausbalanciert ist die Waage erst dann, wenn auf beiden Seiten das Gewicht gleichmäßig verteilt wäre (
Abb. 4). Ausbalanciert ist die Waage erst dann, wenn auf beiden Seiten das Gewicht gleichmäßig verteilt wäre ( Abb. 5). Anhand dieses einfachen Beispiels wird schnell klar, was ich mit meinen Ausführungen meinte: Wenn Sie die Maßnahme überdenken, haben Sie bereits das dazugehörige Problem.
Abb. 5). Anhand dieses einfachen Beispiels wird schnell klar, was ich mit meinen Ausführungen meinte: Wenn Sie die Maßnahme überdenken, haben Sie bereits das dazugehörige Problem.

Abb. 5: Eine ausgeglichene Problem-/Maßnahmen-Balance.
1.8.2 Die Behandlungspflege brauchen Sie nicht planen
Noch immer gibt es Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte, die die Behandlungspflege in die Pflegeplanung aufnehmen: Da wird von Medikamentengaben berichtet, von Augentropfen, von Insulininjektionen. Natürlich ist es nicht verboten, die Behandlungspflege in eine Pflegeplanung zu schreiben. Aber Pflegeplanung bedeutet doch, dass es um die Pflege geht, eine individuelle, für einen bestimmten Tagesgast.

Bei der Pflegeplanung wird die Pflege geplant, nicht die Tätigkeit des Arztes. Eine Behandlungspflege ist auch nicht individuell und muss somit nicht geplant werden.
Für die Behandlungspflege gibt es eine ärztliche Anordnung ( Kap. 1.6). Somit hat der Arzt bereits alle Fragen zur Planung beantwortet: die da wären:
Kap. 1.6). Somit hat der Arzt bereits alle Fragen zur Planung beantwortet: die da wären:
• Was
• Wann
• Wie
• Wie oft
• Womit
Die Behandlungspflege ist in aller Regel standardisiert und muss nicht ständig in jeder Akte geplant werden. Wenn Sie die Behandlungspflege planen möchten, sollten Sie dies nur ein einziges Mal tun – und nicht bei jedem Gast wieder. Tabelle 12 ist eine Kopiervorlage für all Ihre Tagesgäste. Sie müssen nie wieder etwas schreiben! Kopieren Sie die Texte einfach und fügen Sie sie in die Akte des Kunden ein. Schon haben Sie die Behandlungspflege geplant ( Tab. 12).
Tab. 12).
Tab. 12: Textbausteine für die Behandlungspflege
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842690561
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Mai)
- Schlagworte
- Pflegedokumentation Expertenstandards Dokumentation MDK Prüfung Selbstständigkeit Pflege Altenpflege Beschäftigen Soziale Betreuung