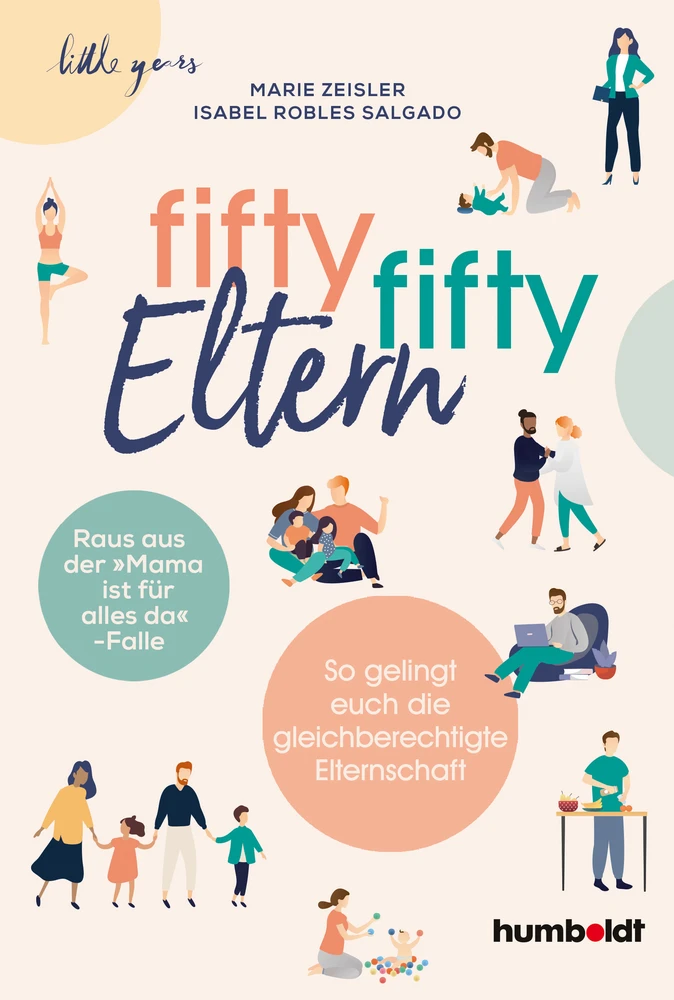Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG: SO KANN GLEICHBERECHTIGTE ELTERNSCHAFT GELINGEN
Ziemlich bald nach dem positiven Schwangerschaftstest, nach den Vorsorgeuntersuchungen und der ersten großen Freude über das Baby, das die kleine Familie erweitern wird, stellen sich Paare die Frage:
Wie machen wir das mit unseren Jobs? Wer bleibt wie lange zu Hause? Wer nimmt Elternzeit? Wer kümmert sich in Zukunft um was? Ihr werdet nicht sofort die passenden Antworten finden, denn es gibt keine Musterlösungen, die auf alle Situationen passen. Erwartet also nicht zu viel – Familie werden und in die Gleichberechtigung finden, ist ein Prozess. Wir möchten euch ein wenig auf dem Weg dorthin begleiten.

Echt fifty-fifty?
Während noch bis vor Kurzem für die meisten Paare in Deutschland feststand: Mama macht die Elternzeit und kehrt danach maximal in Teilzeit in ihren Erwerbsjob zurück, wünschen sich heutzutage immer mehr Paare eine wirklich gleichberechtigte Aufteilung von Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit. Die Realität sieht allerdings (noch) anders aus. Der Löwenanteil der Kindererziehung und all der Familienarbeit, die gemacht werden muss, fällt meistens in die Hände einer Person – und zwar in die der Frau. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Gender-Pay-Gap, also die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, spielt eine Rolle – denn es ist eine Tatsache, dass Frauen weniger verdienen, und zwar satte 21 Prozent (Stand 2018, Quelle: Statistisches Bundesamt). Das ist außerdem seit 2002 nahezu unverändert so, was zeigt: Dieses Ungleichgewicht gerät auch nicht so schnell ins Wanken. Hinzu kommt der etwas weniger bekannte Gender-Care- Gap, also der Unterschied an Zeit, die auf das Kümmern entfällt. Frauen wenden im Durchschnitt rund 52 Prozent mehr Zeit pro Tag für unbezahlte Sorgearbeit auf – sei es Kindererziehung, die Pflege kranker Angehöriger oder Arbeiten im Haushalt wie Putzen, Abspülen, Kochen.
Prägungen sind ebenfalls wichtig, denn wer selbst mit einer Vollzeit- Mutter aufgewachsen ist, bekommt dieses Bild schwer aus seinem Kopf heraus. Bei Vätern herrscht dafür oft „Versorgerdruck“. Dazu kommen Steuergesetze wie das Ehegattensplitting und andere strukturelle Faktoren, die althergebrachte Rollenbilder stützen und ihre Abschaffung erschweren. Auf diese Faktoren wollen wir in diesem Buch nicht vertiefend eingehen, auch wenn wir finden, dass viele Gesetze dringend reformiert werden müssen.
Bis im deutschen Arbeits-, Steuer- und Familienrecht die Gleichberechtigung stärker berücksichtigt wird, liegt es an den Familien, selbst für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Natürlich gibt es keine absolut richtigen oder objektiv besseren Lebensmodelle. Familie ist bunt. Es gibt Patchwork- und Regenbogen-Familien, Alleinerziehende, getrennt Erziehende und viele weitere Konstellationen. Familie ist da, wo Liebe ist – heutzutage muss niemand mehr eine Kleinfamilie gründen, wenn er oder sie das nicht möchte, oder dieses Konstrukt nicht funktioniert.
Dieser Ratgeber richtet sich dennoch primär an heteronormative Paare, die das Modell „Vater-Mutter-Kind(er)“ anvisieren. Dieses Buch versteht sich als eine Handreichung für alle Paare, die möglichst gleichberechtigte Eltern sein wollen. Für sie haben wir es geschrieben. Vielleicht hältst du es in den Händen, weil ein Baby unterwegs ist, vielleicht bist du auch schon seit Jahren Mutter bzw. Vater und willst das Thema nun endlich einmal angehen. Wir hoffen aber, dass wir allen Eltern etwas mit auf den Weg geben können. Und dabei geht es, obwohl im Titel der Begriff fifty-fifty-Eltern vorkommt, gar nicht darum, jede Tätigkeit mit der Stechuhr genau hälftig zu teilen. Sondern es geht darum, alle Bedürfnisse gelten zu lassen, und eine Familienstruktur zu schaffen, die alle glücklich macht.
Denn so richtig fifty-fifty – das ist wirklich schwierig. Alleine schon, weil man nicht alle Aufgabenbereiche genau bewerten kann: Wie viele gewechselte Windeln sind gleichzusetzen mit einer Stunde Fenster putzen? Zudem sind Menschen unterschiedlich belastbar, die Gehälter sind in der Regel nicht gleich hoch, die Interessen, Talente und Vorlieben sind ebenfalls unterschiedlich. Wir hoffen aber, euch dabei helfen zu können, zumindest ansatzweise fifty-fifty zu leben. Das Ziel ist, dass ihr das Gefühl habt, eine gleichberechtigte, gerechte und gut aufgeteilte Partnerschaft zu führen.
Denn Gleichberechtigung ist gut für eine Beziehung! Eine solche Aufteilung ist in der Regel erfüllender und fühlt sich fairer an. Zudem sind die glücklichsten Gesellschaften der Welt allesamt in Ländern (Norwegen, Dänemark, Finnland), in denen Gleichberechtigung einen hohen Stellenwert hat. Man kann also vielleicht sogar behaupten, dass sie glücklich macht!
Gleichberechtigung statt herkömmlicher Rollenverteilung
Die Sorge, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen, die berühmte „Vereinbarkeitsfrage“ also, plagt traditionell eher die Mütter als die Väter. Männer machen sich auch viel weniger Gedanken darüber, mit wie vielen Stunden sie wieder in den Job zurückkehren möchten. Im Umkehrschluss bleiben die unbezahlte Arbeit, das „Kümmern“ und nicht zuletzt der Haushalt eher an der Frau hängen. Warum ist das so, dass es bei vielen Paaren in Deutschland nach der Geburt des Kindes zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen, also zu einem Zurückfallen in die althergebrachte Rollenverteilung, kommt?
Dass dem so ist, ist erwiesen. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2018 arbeiten rund 94 Prozent der erwerbstätigen Väter in Vollzeit, bei den Müttern sind es nur 34 Prozent – ein eklatanter Unterschied, besonders, wenn man bedenkt, dass die Vollzeitquote ohne den Faktor Elternschaft bei Männern bei 91 Prozent, bei Frauen bei 52 Prozent liegt und sich so vor allem für Arbeitnehmerinnen mit der Geburt des ersten Kindes alles ändert. Oft ist es ein Mix aus Strukturen und Gewohnheiten, aus Traditionen und äußeren Umständen. Sie macht schon vorher mehr im Haushalt und das bleibt dann auch so. Da die Hausarbeit sich exorbitant vermehrt, sobald ein Kind da ist, steigt auch die Zahl der Stunden, die auf diese unbezahlte Arbeit entfallen, stetig an.
Viele Frauen fühlen sich auch von vornherein stärker verantwortlich für das Kind, denn sie hatten es ja im Bauch. Sie stillen – und nehmen ein Jahr Elternzeit, er, wenn überhaupt, nur zwei Monate. Und die werden dann gerne für einen langen Urlaub genutzt. Sie geht nach der Elternzeit in Teilzeit, er wird befördert. Ihr Gehalt schrumpft zusammen, seines steigt. Diese Prozesse sind alle wissenschaftlich untersucht, es gibt Begriffe wie „Motherhood Lifetime Penalty“ (zu Deutsch etwa: lebenslange Strafe für Mutterschaft) und „Fatherhood Premium“ (in etwa: Vaterschafts-Bonus) – denn je nach Alter verdienen Männer sogar häufig mehr, wenn sie Kinder bekommen. Frauen natürlich nicht, laut einer neuen Bertelsmann Studie erhalten sie nach dem ersten Kind nach dem Wiedereinstieg in den Job sogar 43 Prozent weniger Gehalt als gleichaltrige Männer, nach dem zweiten Kind vergrößert sich die Lücke auf 54 Prozent und nach dem dritten sogar auf 68 Prozent.
Die Geburt eines Kindes führt für Frauen also zu großen sozialen Ungleichheiten. Jahrelange Auszeiten aus dem Job, sowie Teilzeitanstellungen haben massive Auswirkungen auf das Lebenseinkommen – Mutterschaft ist finanziell gesehen eine Strafe. Dadurch wird es mit den Jahren auch immer schwerer, eine Beziehung „auf Augenhöhe“ zu führen. Bei Paaren, die sich in einem traditionellen Modell wiederfinden, obwohl sie insgeheim vielleicht immer noch den idealistischen Anspruch der ersten Tage haben, driften die Leben der Partner immer mehr auseinander, die Enttäuschung über die neue Lebensrealität wächst.
Das klassische Familienmodell – der Mann ist der Ernährer der Familie und die Frau Hausfrau – ist eigentlich ein Auslaufmodell, allein schon, weil ein Gehalt meistens gar nicht mehr reicht, um eine Familie zu versorgen. Sehr viele Paare wollen so auch nicht mehr leben. Das in Deutschland in heteronormativen Familien am häufigsten gelebte Modell ist die Zuverdiener-Ehe (oder eheähnliche Partnerschaft): Er arbeitet in Vollzeit, sie in Teilzeit. In vielen Fällen übernimmt die Frau zusätzlich zu ihrem Teilzeitjob aber auch noch den Großteil aller familiären Aufgaben, des Haushalts und der Mental Load, und sie investiert in der Regel auch mehr Zeit in die Betreuung der Kinder.
Diese Zuverdiener-Aufteilung ist in vielen Fällen fast noch ungerechter als das „ganz klassische“ Modell, denn Frauen übernehmen extrem viel Verantwortung, sind entsprechend häufig völlig überlastet, verdienen aber proportional deutlich weniger Geld und bekommen in der Regel auch wenig Anerkennung in ihrem Teilzeitjob. Dafür gibt es den Begriff „Doppelbelastung“. Und, wie der Name schon sagt: Das kann unheimlich anstrengend sein.
Fifty-fifty ist auch Einstellungssache. Wer den anderen Partner und seinen Job wirklich als gleichberechtigt wahrnimmt, wird automatisch anders handeln. Wenn das der Fall ist, wird ein Paar ohnehin immer abwägen und dem anderen den Raum für seine Entfaltung geben. „Wenn man jemanden liebt, dann will man, dass diese Person ihr volles Potenzial ausschöpfen kann“, schreibt die Autorin Malin Elmlid in ihrem Buch „Dein Mutterpass“ (S. 55). Und sollte das nicht für alle Familienmitglieder gelten? Im klassischen Modell ist es leider in den meisten Fällen so, dass die Frau ihr Potenzial eben nicht ausschöpfen kann. Es kann sehr erfüllend sein, sich einige Jahre komplett um die Kinder zu kümmern. In der Regel ist es das aber auf Dauer nicht.
Dennoch ist klar, dass eine gleichberechtigte Aufteilung der Erwerbsund Sorgearbeit nicht in allen Beziehungen funktioniert, selbst wenn sie gewollt ist. Es gibt Strukturen, die man nicht überwinden kann, zum Beispiel, wenn ein Partner krank ist, wenn ein Kind krank ist, einen besonderen Betreuungsbedarf oder eine Behinderung hat. Auch wenn ein Partner einen extrem verantwortungsvollen und zeitintensiven Job hat, ist reduzieren manchmal nicht möglich. Kurz: Es gibt Konstellationen, in denen eine gleichberechtigte Aufteilung von Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, Mental Load und Freizeit sehr kompliziert ist. Eine Beziehung kann dennoch auf Augenhöhe sein, aber auch eine gerechte Aufteilung ist in den allermeisten Familien eher eine Frage des Wollens als des Könnens! Wir werden euch verschiedene Szenarien aufzeigen und hoffen, dass auch für euren individuellen Fall etwas dabei ist, damit ihr optimale Bedingungen schaffen könnt, um auf lange Sicht wirklich alles zu teilen.
Es gibt viele, sehr gute Gründe, sich für eine gerechte Aufteilung zu entscheiden
• Frauen machen sich in gleichberechtigten Beziehungen viel weniger abhängig, was gerade im Falle einer Trennung von großem Vorteil ist, und ihr Risiko für Altersarmut sinkt.
• Die Beziehungen sind oft glücklicher und finden häufiger auf Augenhöhe statt, wenn beide die unterschiedlichen Anforderungen des jeweils anderen Elternteils nachvollziehen können, weil sie beide Perspektiven kennen.
• Beide Elternteile haben eine gleichwertige Bindung zum Nachwuchs, es gibt nicht das immer wieder überspitzte „Nicht die Mama“–Phänomen aus der Kinderserie „Die Dinos“: wenn die Kinder bei allen Belangen automatisch nur nach Mama verlangen und Papa eben nur „nicht die Mama“ ist. Sondern ihr habt abwechselnde Phasen, in denen mal Papa, mal Mama der Favorit ist.
• Im Idealfall wird auch die freie Zeit gerecht geteilt und jeder Partner kann diese jederzeit einfordern, weil der andere nahtlos übernehmen kann – es bleibt in der Folge also für die Erwachsenen mehr Zeit für sich, „Me-Time“, wie man heute so schön sagt.
• Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun – nicht zuletzt ist es auch für die Kinder ein großer Vorteil, wenn sie eben nicht die klassischen Rollenbilder vorgelebt bekommen. Sie haben so in ihrem eigenen Erwachsenenleben mehr Wahlfreiheit und sind frei von der unbewussten Reproduktion traditioneller Geschlechterrollen.
• Ein gleichberechtigtes Familienleben fühlt sich meist erfüllter an als eine starre Rollenverteilung. Für beide Elternteile gibt es nicht nur eines: entweder Job oder die Kinder. Und in vielen Fällen haben Eltern so auch mehr Zeit für die Beziehung und für die Familie.
Wie kann man es schaffen, als Eltern weitgehend gleichberechtigt zu leben? Welche Hürden muss man dafür überwinden, welche Rollenbilder im Kopf bearbeiten? Welche Themen ansprechen und wann? Wo sind die Fallen? In diesem Buch wollen wir euch Ideen und Inspirationen bieten, die euch hoffentlich dabei helfen, die Beziehung, in der ihr lebt, gerechter zu gestalten.
Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass beide Elternteile ganz genau die Hälfte der anfallenden Aufgaben übernehmen müssen. Gleichberechtigung sollte vielmehr bedeuten, dass PartnerInnen die Möglichkeit haben, zu entscheiden. Welcher Weg sich am Ende für euch gerecht anfühlt, das bestimmt ihr. Im Idealfall schafft ihr es, dass die Bedürfnisse aller eine Rolle spielen und ein ähnliches Gewicht haben. Und dass die Frau eben am Ende der langen Reise, die Elternschaft ja ist, nicht die Leidtragende ist, sei es, weil sie viele Jahre völlig erschöpft war oder in Sachen Altersvorsorge zu kurz kam.
Wir versuchen auf die verschiedensten Konstellationen einzugehen und möglichst viele Paare abzuholen. Am besten, ihr pickt euch heraus, was für euch passt. Am Ende gilt das, was immer gilt, wenn es um Elternschaft, Erziehung, Familie und Partnerschaft geht: Es gibt nicht den einen Weg, viele Wege führen zu einem harmonischen Familienleben. Ihr sucht euch einfach den Weg aus, der zu eurer Familie am besten passt. Wir hoffen, euch bei diesem Prozess unterstützen zu können!
Aber natürlich ist fifty-fifty auch eine Lernerfahrung – auch wir haben beide nicht von Anfang an alles so gemacht, dass es perfekt passte, sondern vielmehr immer wieder Fehler gemacht, diese korrigiert, unser Lebensmodell und die Aufteilung der Aufgaben in der Partnerschaft angepasst.
Isabels persönliche Geschichte
Wenn mein Partner das seltsame Kompliment bekommt, er sei so ein engagierter Vater, dann kommen mir immer zwei Gedanken. Erstens: Was ist daran toll, sich um seine eigenen Kinder und alles, was sie so mit sich bringen, zu kümmern? Frauen bekommen diese Anerkennung für das Kümmern und alles andere, was mit Kindern, Haushalt und Familie zu tun hat, nie. Von ihnen wird es selbstverständlich erwartet. Zweitens: Ich hätte auch nie mit einem Mann, der Vaterschaft anders handhabt, Kinder bekommen.
Das klingt krass, denn wenn man sich verliebt, hat man selten im Hinterkopf, ob der Mann des Herzens wohl Waschmaschinen bedienen, Windeln wechseln und Strumpfhosen richtig anziehen kann, oder ob er gewillt ist, sich an der Kindererziehung und im Haushalt gleichwertig zu beteiligen. Aber unbewusst war es bei mir vermutlich wirklich so, dass ich mich auch deshalb so in diesen Mann verliebt habe, weil mir klar war: Mit dem kann ich Familie so leben, wie ich mir das vorstelle.
Ich muss dazu sagen, dass ich mit einer alleinerziehenden Feministin als Mutter aufgewachsen bin. Und so nervig ich das als Kind fand, so froh bin ich heute darüber. Denn ich habe nie besonders große Erwartungen an mich als Mutter gehabt. Wenn die Kinder einigermaßen sauber, satt und glücklich sind, dann reicht mir das eigentlich, platt ausgedrückt. Ich bin eine lausige Köchin, spiele nicht gerne, kann nicht stricken, nicht nähen und das Basteln habe ich erst nach vielen Jahren für mich entdeckt. Dafür lese ich gerne vor. Dennoch bin ich für ganz viele Frauen sicher nicht das, was man unter einer tollen Vorzeigemutter gemeinhin versteht. Und das war auch immer okay für mich.
Wenn man so will, war ich immer sehr egoistisch. Und ich denke, dass hier meine Mutter und ihr Verständnis von Muttersein eine Rolle spielt. Sie war selbst alles andere als eine Vorbildmama. Das fand ich als Kind oft nicht so super. Heute merke ich, wie erleichternd es ist, wenn man mit einer „good enough“-Mutter, also einer, die ganz gut, aber eben nicht perfekt war, aufgewachsen ist. Auch jetzt, als Großmutter, stellt meine Mutter keinerlei Erwartungen an mich oder bewertet mein Verhalten als Elternteil. Nie.
Unser Sohn wurde 2013 geboren. Die Schwangerschaft haben mein Partner und ich schon so gut wie möglich zusammen gerockt. Das bedeutet: Er war bei den Vorsorgeterminen bei der Frauenärztin dabei und hat sich regelmäßig mit der Hebamme ausgetauscht. Wir haben die Geburt gemeinsam geplant (so weit man das kann), haben alle Besorgungen zusammen erledigt, und wir haben auch genau besprochen, wie wir uns das alles in den kommenden Jahren vorstellen. Wir wollten auch weiterhin alle Rechnungen gemeinsam bezahlen, die Berufstätigkeit von beiden sollte gleich wichtig sein, die Hausarbeit wollten wir auch weiterhin teilen und alles, was sonst so mit dem Kind dazukommen würde, auch.
Die Elternzeit hatten wir genau hälftig aufgeteilt (jeder sieben Monate), wir haben unserem Baby früh das Fläschchen gegeben (anfangs mit abgepumpter Milch), um mir als Mutter zu garantieren, dass ich auch mal wegkann. Mit 14 Monaten wurde das Kind in der Kita eingewöhnt, die Betreuung an den Nachmittagen teilten wir ausgewogen auf.
Mit einem Kind haben wir unsere gleichberechtigte Elternschaft also wirklich vorbildlich gestemmt. Wir hatten keine strengen Pläne, alles hat sich immer je nach Jobsituation, Verteilung der individuellen Kräfte und persönlicher Veranlagung und Eignung ergeben. Mein Partner ist zum Beispiel eher der Frühaufsteher. Das erste Jahr mit unserem Sohn, in dem dieser meist schon um sechs Uhr wach war, habe ich also sehr selten die ersten Stunden mit dem Kind machen müssen. Dafür übernahm ich nach diesen sehr frühen Stunden die Betreuung wieder. Mir machte Wäsche aufzuhängen mehr Spaß, er kochte gerne, mal durfte er abends allein was unternehmen, mal konnte ich mit Freundinnen ausgehen. Richtig fair!
Unser zweites Kind wurde drei Jahre später geboren, und tatsächlich sind wir im Anschluss an die Geburt in eine Falle getappt: bei der Aufteilung der Elternzeit. Ich wollte mir bei diesem Kind mehr Zeit nehmen, mein Partner hatte mich schon in der Schwangerschaft beruflich und gehaltsmäßig „überholt“ und war nicht an einer großen Pause interessiert. Ich hingegen schon. Ich nahm dieses Mal elf Monate Elternzeit, er nur drei. Und diese drei Monate haben wir im Ausland verbracht. Das war toll, aber mein Partner hatte den Alltag mit zwei Kindern tatsächlich noch nicht einen einzigen Tag so richtig alleine gewuppt, als meine Tochter ein Jahr alt wurde. Als sie 16 Monate alt war, wollte ich wieder richtig arbeiten, mein Partner war mir in Sachen Gehalt und beruflichem Erfolg noch weiter davongelaufen und ich hatte ernsthaft Bedenken, ob wir das noch hinbekommen würden mit der Gleichberechtigung. Es kann also wirklich jedem Paar passieren!
Viele Gespräche und Pläne, Finanzen überdenken und ein Netzwerk spinnen später, würde ich heute sagen: Wir haben es geschafft. Wir arbeiten wieder etwa gleich viel, verdienen zwar unterschiedlich, versuchen aber, das anders auszugleichen. Wir kümmern uns gleichwertig um die Kinder, haben wieder unsere Aufgabenbereiche, aber jeder kann zu 100 Prozent übernehmen, wenn der andere ausfällt. Mein Partner denkt daran, wenn die Zahnpasta aus ist, neue zu kaufen, er schneidet die Nägel der Kinder, er kocht weiterhin fast immer und kümmert sich auch um den Lebensmitteleinkauf. Ich bin für Kleidung zuständig, mache mehr Planung, koordiniere die Nachmittage der Kinder, und bin für die Wäsche verantwortlich. Die Kinderbetreuung teilen wir hälftig auf, beide Elternteile haben ungefähr gleich viel Freizeit und wir achten darauf, dass wir beide unsere Hobbys pflegen können.
Ich kann also bestätigen, dass man das mit fifty-fifty auch hinbekommt, wenn es zwischendurch schon einmal anders war. Dazu gehört viel zu reden, viel zuzuhören. Der Prozess ist verbunden mit Selbstreflexion und Arbeit. Und so geht das auch weiter, wenn man es geschafft hat: Noch heute stecken wir regelmäßig ab, wie wir alle Aufgaben aufteilen, wer sich wie behandelt und gesehen fühlt, wer ausgelaugt ist, wer welche Bedürfnisse hat. Wir diskutieren, teilen neu auf, verhandeln. Es ist weiterhin viel Arbeit, aber es lohnt sich!
Maries persönliche Geschichte
Meine zwei Kinder haben unterschiedliche Väter. Auch die jeweiligen Erfahrungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Fangen wir beim ersten Kind an: Ich war mit 26 Jahren noch verhältnismäßig jung, die Beziehung verlief eher als eine On-off-Affäre und zudem kannten wir uns nur kurze Zeit, als ich schwanger wurde. Erst als ich im achten Monat war, zogen wir zusammen. Ich zog bei meinem damaligen Freund ein. Schnell zeigte sich: Wir hatten komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es laufen sollte. Nur einmal sprachen wir über die Zeit nach der Geburt und ich, unbedarft und ohne Vorstellungen davon, wie es werden würde, sagte gleich den zwölf Monaten Elternzeit alleine zu.
Das Baby kam und es war klar, dass ich für alles, was das Kind anging, verantwortlich sein würde. So zog es sich durch die gesamte Elternzeit. Ich merkte immer mehr, dass ich es anders wollte, fühlte mich alleingelassen und ungerecht behandelt. Seine Einstellungen entsprachen denen der ganz alten Schule, und da war alles, was das Kind anging, mein Territorium. Aber auch in mir wirkten noch Rollenvorbilder nach, die ich als Kind mit auf den Weg bekommen hatte. Ich stamme aus der ehemaligen DDR. Dort war es zwar normal, dass Frauen arbeiteten, aber sich auch gleichzeitig um den Haushalt und die Kids kümmerten. Irgendwie spürte ich auch noch den Druck, dass ich die Mama sei und damit die Hauptverantwortliche für alles, was das Kind anging. Auch heute ist dieser Druck noch nicht hundertprozentig verschwunden.
Immer noch denke ich manchmal: Ich bin die Mama und damit bin ich immer noch ein winziges Stückchen mehr verantwortlich für die Kinder. Vielleicht kann man die Art, wie man sozialisiert wurde, nie ganz ablegen. Vielleicht ist das aber auch nicht so schlimm, wenn wir uns dessen bewusst sind, und jede unserer Entscheidungen hinterfragen.
Der Vater meines ersten Kindes und ich trennten uns, als das Kind ein Jahr alt wurde. Es sollte sechs Jahre dauern, bis das zweite Kind kam. Dieses Mal war ich älter, hatte viel Erfahrung im Gepäck und wusste, was ich mir vorstellte. Ich wollte einen Partner auf Augenhöhe und wünschte mir eine Familie, in der wir fair, respektvoll und gleichberechtigt miteinander umgehen. Schon in der Schwangerschaft redeten wir regelmäßig und lange über unsere Vorstellungen. Wir hörten gemeinsam Podcasts zu Elternthemen. Es war klar, dass wir nicht in alte Rollenbilder kippen wollten – in der Theorie. Als das Kind da war, merkten wir, dass all die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, in der Umsetzung schwerer waren als gedacht.
Es fing damit an, dass mein Partner zwar seinen Jahresurlaub von vier Wochen auf die Zeit nach der Geburt gelegt hatte, aber dass sich unser Baby natürlich nicht an unseren Terminplan hielt, sondern früher kam. Also war ich die erste Woche des Wochenbetts tagsüber doch alleine (was nicht so schlimm war, denn ich organisierte mir anderweitig Hilfe). Anschließend war mein Partner aber endlich vier Wochen zu Hause, und es war so gut! Wir hatten wirklich die Möglichkeit, als Familie gemeinsam anzukommen. Er kümmerte sich um alles, ich konnte im Bett liegen und mich regenerieren und auch für meinen großen Sohn da sein, für den das Baby ja auch eine Umstellung bedeutete.
Die nächste Hürde war dann die Aufteilung der Elternzeit, denn ich wusste: So wie beim ersten Kind wollte ich es nicht noch einmal handhaben. Auch hier stimmte er zu: Klar, wir teilen die Elternzeit auf! Beruflich war das dann nicht so einfach, wir mussten einen finanziellen Puffer zurücklegen und ganz hälftig klappte es am Ende doch nicht. Aber fast! Und der Unterschied ist riesig.
Diesmal habe ich wirklich das Gefühl, wir machen das gemeinsam. Ich finde es so angenehm, nicht erklären zu müssen, warum das Baby gerade quengelt, sondern dass der Vater intuitiv durch die Babyzeit weiß, warum unser Sohn in diesem Moment so oder so drauf ist. Es ist so schön, nicht die Hauptverantwortliche zu sein. Ich merke förmlich, welche Leichtigkeit es bedeuten kann, ein Kind zu haben, wenn nicht alles an einem hängt, sondern wenn man sich die Fürsorge teilt. Auch für unsere Paarbeziehung ist das toll, denn wir wissen beide, was es heißt, einen Tag mit dem Baby alleine zu verbringen und haben Respekt für den jeweils anderen, weil wir unsere Lebenswelten kennen und teilen.
Wir sind in einer gleichberechtigten Situation und finden gemeinsam immer wieder Lösungen für den Alltag. Natürlich heißt das, manchmal auch abzuwägen, zu schauen, wo Abstriche gemacht werden können. Ich war vorher die meiste Zeit allein- oder auch teilerziehend mit dem ersten Kind. Die Erfahrung, sich gemeinsam um ein Kind und den Haushalt zu kümmern, ist neu für mich. Manchmal merke ich auch, dass es mir viel abverlangt, nicht einfach mein Ding durchzuziehen. Die ständigen Absprachen, das Abwägen – auch das ist neu für mich. Aber das ist es wert. Und ich könnte mir glatt vorstellen, noch Kind Nummer drei zu bekommen, wenn es so läuft wie jetzt!
WO FANGEN WIR AN?
Falls du gerade schwanger bist: Schon klar, es macht viel mehr Spaß, kleine Bodys zu shoppen und das Babyzimmer einzurichten, als über die Verteilung der Hausarbeit zu sprechen. So viel mehr! Die Wahrheit ist jedoch, dass Babys fast nichts brauchen (vor allem kein Babyzimmer, aber das ist eine andere Geschichte). Und dass die Gespräche über „Wie wollen wir das eigentlich alles machen, wenn das Baby da ist?“ wirklich wichtig und zukunftsbestimmend sind. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber wir würden sogar behaupten, dass es diese Absprachen sind, die darüber entscheiden, wie gut man als Eltern und als Paar klarkommt – oder ob man scheitert.

Vor der Geburt des Kindes
Auch wenn es Überwindung kostet, auch wenn man gerade in der Schwangerschaft harmoniebedürftig ist: Die Fragen, wer wie viele Stunden pro Woche arbeitet, wer das Projektmanagement für die Familie übernimmt, wie die Finanzen geklärt sind und wer wen wann auf welche Weise unterstützt, müssen beantwortet werden. Auch wenn es erst einmal unromantisch erscheint und ganz weit weg: Je mehr klar abgesprochen wurde, desto stärker profitieren am Ende alle. Denn schon die ersten Monate als Eltern sind wichtig, damit sich traditionelle Aufgabenteilungen und Zuschreibungen gar nicht erst einschleichen.
Die werdenden Eltern gehen in der Regel mit ungleichen Ausgangssituationen in die Diskussion um die Aufteilung der Verantwortung und der Elternaufgaben hinein. Autor und Blogger Jochen König bringt es auf den Punkt: „Väter haben in den meisten Fällen viele Möglichkeiten, mit der eigenen Rolle umzugehen. Sie können die klassische Rolle des Familien-Ernährers wählen oder die des,modernen‘ Vaters, der sich für sein Kind engagiert. Die Wahlmöglichkeiten der Mütter sehen ganz anders aus. Wenn der Vater keine Lust hat, ein,moderner‘ Vater zu sein, liegen sie irgendwo zwischen: beim Kind bleiben und beim Kind bleiben. Und selbst wenn ein Vater für eine 50/50-Aufteilung plädiert, liegen die Möglichkeiten der Mutter immer noch nur zwischen beim Kind bleiben und die Hälfte der Zeit beim Kind bleiben. Von Müttern wird häufig wie selbstverständlich erwartet, dass sie ihre Mutterrolle erfüllen, indem sie (notfalls auch alleine) beim Kind bleiben.“
Dieser Ungleichheit solltet ihr euch vor den Gesprächen bewusst sein. Gerade für den (werdenden) Vater ist das wichtig. Und auch schön! Denn er hat so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, sich aktiv am Familienleben zu beteiligen. Und er ist es auch, der viel bewegen kann, für sich, seine Familie, aber auch für andere Väter in seinem Umfeld und Arbeitsumfeld.
Es ist völlig klar, dass die Frau das Baby im Bauch hat und von Anfang an viel enger, körperlicher, unmittelbarer in der ganzen Geschichte drinsteckt. Man könnte daraus folgern, dass sie sich eben dann auch um alles kümmert. Man könnte aber auch sagen: Sie trägt das Kind ja schon aus. Also könnte er ja alles drum herum organisieren!
ALLTAGSTIPP: RECHTZEITIG KÜMMERN
Im Idealfall teilt man frühzeitig ein paar Aufgaben auf – das kann man sogar in der Schwangerschaft machen, zum Beispiel:
• Wer kümmert sich um die Recherche, welcher Kinderwagen gekauft wird?
• Wer kümmert sich um einen Betreuungsplatz? (Je nachdem, wann das Kind betreut werden soll, ist es tatsächlich sinnvoll, das schon in der Schwangerschaft anzugehen)
• Wer liest die Erziehungsratgeber?
• Wer kauft die Dinge ein, die für das Wochenbett notwendig sind?
• Wer kümmert sich um den Geburtsort (an vielen Orten muss man sich in Kliniken/Geburtshäusern anmelden)?
• Wer besorgt das Beistellbettchen?
• Wer beschafft die Babytrage?
• Wer sucht einen Kinderarzt?
KOMMENTAR
Eine Freundin sagte mal zu mir: „Kinder erziehen ist nicht schwer. Aber parallel noch eine Beziehung aufrechtzuerhalten, das ist eine Herausforderung“. So habe ich das auch empfunden. Die Liebesbeziehung wird mit Kindern auf eine harte Probe gestellt! Mir hat es sehr geholfen, dass ich immer die Paarbeziehung als Kern unserer Familie betrachtet habe. Wir sind in der Familie ein Team, wir sind alle gleich viel wert, und das Ziel ist, dass alle glücklich sind. Dafür ist es wichtig, dass beide Eltern genug Zeit für sich bekommen – zu zweit und auch alleine – um Energie zu tanken. Ich persönlich hatte richtig Angst vor einer traditionellen Rollenverteilung und habe das Thema schon früh angesprochen, genau wie Finanzen, Sex und andere Themen, die viele als unangenehm empfinden. Wenn man langfristig will, dass Aufgaben, Verantwortung und die Freude an den Kindern fair verteilt werden, macht es Sinn, das gleich am Anfang zu klären. Das heißt nicht, dass eine bestimmte Rollenverteilung richtig oder falsch wäre. Aber wer keine traditionelle Verteilung möchte, sollte von Anfang an klar und deutlich darüber sprechen. Sonst rutscht man da automatisch rein. Es ist auch nicht so, dass man die Aufgaben dann nie wieder umverteilen könnte. Aber es ist schlicht und ergreifend einfacher, wenn man noch in der Schwangerschaft die kritischen Punkte klärt.
Malin Elmlid (schwedisch-deutsche Autorin)
Wenn ihr schon mittendrin steckt
Es gibt viele Gründe, das Leben in einer Partnerschaft gerechter gestalten zu wollen. Auch wenn ihr bisher eher traditionell gelebt habt, haben wir viele Tipps für euch, wie ihr euch von jetzt an eher gleichberechtigt aufstellen könnt.
Es ist nie zu spät, das Thema Gleichberechtigung anzugehen
Selbst Paare, bei denen die Rollenverteilung über Jahre „klar“ war, können irgendwann anfangen, diese infrage zu stellen und vielleicht auch zu ändern, oder sogar umzukehren, siehe auch den „Papa- Test“ im Kapitel „Die Eltern-Checklisten“ am Schluss des Buchs. Das Leben verläuft in den seltensten Fällen geradlinig. Vielleicht hast du dir als Mutter nach der Geburt des Kindes oder der Kinder sogar gewünscht, zu Hause zu bleiben und die Care-Arbeit alleine zu übernehmen. Aber nun fühlt es sich ganz anders an. Es kam einfach alles nicht so, wie du es dir vorgestellt hattest. Vielleicht hat sich im Job eine neue Möglichkeit eröffnet, die du unter den momentanen Gegebenheiten nicht annehmen kannst? Vielleicht hast du dich als Vater zunächst als Ernährer gesehen, aber nach einiger Zeit stellst du fest, dass du mehr Zeit mit der Familie verbringen willst? Vielleicht haben sich auch bei dir beruflich die Parameter verändert und du sehnst dich nach einer Veränderung?
Ihr seht, die Gründe, etwas verändern zu wollen, sind vielseitig.
Warum unterschiedliche Standards problematisch sind
Allerdings haben sich in Beziehungen, die lange Zeit eher klassisch aufgestellt waren, sehr oft unterschiedliche Standards eingeschlichen. Ein Paradebeispiel ist der „Schönwetter-Papa“, der nur selten Zeit mit den Kindern verbringt und dann immer ganz besondere Sachen mit ihnen macht. Kino, Kletterhalle, Zoo – bloß kein Alltag. Da wird dann auch gerne mal das zweite Eis erlaubt und mit dem Ins-Bett-Gehen und Zähneputzen muss man es auch nicht so ernst nehmen. Mütter, die andere Routinen eingeführt hatten, frustriert das verständlicherweise. Denn es ist einfach, ein Auge zuzudrücken, wenn man weniger Zeit mit den Kindern verbringt. Es ist immer spaßiger der „good cop“, also der freundliche Part im Ermittlerduo, zu sein.
Wer gleichberechtigt leben will, muss sich auch hier ein paar eventuell unangenehmen Gesprächen stellen. Warum sind einem Elternteil gewisse Standards wichtig, kann der andere diese respektieren und wenn nein, warum nicht? Die Kinder werden im seltensten Fall Schaden nehmen, wenn ein Elternteil es anders macht, aber vielleicht kann man Kompromisse finden, mit denen alle sich wohlfühlen.
Es mag klischeehaft klingen, aber wenn wir uns so umhören, sind es immer die gleichen Dinge, die Frauen an ihren Männern im Umgang mit den Kindern bemängeln:
• sehr bunt zusammengewürfelte Kleidung
• nicht dem Wetter entsprechende Kleidung
• keine Wechselsachen, Getränke, Snacks dabei
• bei langen Haaren: nicht gekämmte, verfilzte Haare
• zu viele Ausnahmen (das zweite Eis, die weitere Serienfolge)
• abends toben, obwohl Bettgehzeit ist
• kaum Fokus auf gesunde Ernährung
• unangebrachte Strenge/unangebrachte Lockerheit
Viele Dinge sind vielleicht auch vernachlässigbar, und man kann wirklich mal ein Auge zudrücken. Jeder hat andere Standards und andere Strategien. Wenn die Kinder aber nach zwei Tagen mit Papa völlig übermüdet und überzuckert sind und danach die Mama dran ist und gefühlt „alles ausbaden“ muss, ist niemandem geholfen. Genauso wenig, wenn ein Kind im Oktober im T-Shirt in den Kindergarten geht und am nächsten Tag krank ist. Sprecht einzelne Situationen durch und erklärt, warum euch bestimmte Punkte, Dinge oder Vereinbarungen wichtig sind. Nehmt einander unbedingt ernst und versucht, Kompromisse zu finden.
Man kann auch nach Jahren nach mehr Gleichberechtigung streben, wenn die Fronten noch nicht zu sehr verhärtet sind. Es kann allerdings sein, dass dann mehr Nachjustieren, und noch mehr Gespräche und Absprachen nötig sind.
Für Mütter:
• Gebt dem Partner Zeit, sich in der neuen Rolle zurechtzufinden.
• Lernt, Aufgaben abzugeben.
• Lasst ihn machen. Oft sind seine Strategien anders, aber nicht schlechter.
• Nur wenn ihr akzeptiert, dass euer Weg nicht der einzig richtige ist, nähert ihr euch der Gleichberechtigung.
Für Väter:
• Nehmt die Belange der Partnerin ernst. Sie hat lange Zeit den Laden (fast) alleine geschmissen, kennt die Kinder vielleicht wirklich besser und hat Routinen und Standards erarbeitet, die ihr den Alltag erleichtern und die ihr wichtig sind.
• Kommuniziert auf Augenhöhe.
• Versucht, ihr entgegenzukommen und ihre Themen nicht als Nichtigkeiten abzutun.
Ihr seid nicht allein
Bei einer Sache könnt ihr euch sicher sein: Es gibt viele Paare, die genau diese Konflikte austragen und versuchen, Lösungen für ähnliche Probleme zu finden. Teilhabe, Gleichberechtigung und Beziehungen auf Augenhöhe sind ein Ideal, nach dem viele streben – den wenigsten gelingt das auf Anhieb. Bloß, weil man zu Beginn falsche Parameter gesteckt hat, bedeutet das also nicht, dass man so weitermachen muss. Macht euch frei von dem Gedanken, nur euch würde es so gehen.
Welche Art von Eltern wollen wir sein?
Hier geht es nicht um Erziehungsideale, sondern um Rollenbilder. Denn wir finden: Bevor wir damit anfangen, euch Tipps zu geben, wie ihr die anstehenden Aufgaben gerechter aufteilen könnt, ist es wichtig, dass ihr euch darüber Gedanken macht, wie ihr euch selbst als Mutter oder Vater seht oder sehen wollt.
Jeder von uns hat tief verankerte, teilweise auch idealisierte und von verschiedensten Ideologien beeinflusste Vorstellungen von Elternschaft, Bilder und Erwartungen an Mutterschaft und Vaterschaft im Kopf. Diese werden oft ganz unbewusst wirksam, wenn man selbst Mutter oder Vater wird. Jeder hat sie!
Ein guter erster Schritt ist also, sich zu fragen, mit welchen Rollenbildern man selbst aufgewachsen ist. Diese wirken natürlich nach, können aber auch dazu führen, dass man es bewusst anders machen möchte als die eigenen Eltern.
Mutterbild: Ideale, Glaubenssätze, Druck
Mutter! Was denkst du, wenn du dieses Wort hörst? Welche Gefühle und Ideale verbindest du damit? Was passiert in deinem Kopf und in deinem Bauch, wenn du an deine eigene Mutter denkst? Ist es ein warmes oder eher ein verhärtetes Gefühl? Selbst, wenn wir uns noch so viel Mühe geben: Niemand kommt an Prägungen, Vorbildern und gewissen Vorstellungen vorbei. Wir starten nicht „neutral“ in das Abenteuer Elternschaft. Und ja, Mütter haben es da nicht wirklich leicht. Denn es gibt ein gesellschaftlich tief verankertes, zum Teil sehr antiquiertes Mutterbild, das allen Frauen, ob sie nun Kinder haben (wollen) oder nicht, im Nacken sitzt. Dies kann enormen Druck verursachen und eigene Entscheidungen beeinflussen.
„Mutterschaft ist mit Geborgenheit, Liebe, Häuslichkeit und Fürsorge verbunden“, schreibt die Autorin und Kleinkindpädagogin Susanne Mierau in ihrem Buch „Mutter sein“ (S. 22). „In unseren Köpfen, aber auch in den Repräsentationen von Mutterschaft in unserem Alltag, die für die Aufrechterhaltung und Ergänzung dieses bestehenden inneren Bildes weiter sorgen.“ Und obwohl mittlerweile die allermeisten Mütter eher das Leitbild der vereinbarkeitsorientierten als der Vollblut-Mutter leben, ist in der Gesellschaft und in den Köpfen noch immer auch das andere Ideal vertreten. Das führt zu einem immerwährenden Konflikt: Frauen haben ein schlechtes Gewissen wegen eines traditionellen Mutterbildes, das sie in der Mehrheit eigentlich gar nicht mehr leben wollen. Das liegt häufig auch an der eigenen Mutter. War sie mit den Kindern zu Hause? Hat sie sich aufgeopfert? Hat sie vielleicht sogar heute noch eine ganz genaue Meinung zum Thema Mutterschaft und tut diese auch kund? Oder war sie berufstätig, wenig da, hat vielleicht selbst schon ganz stark mit diesem verflixten Mutti-Ding gehadert? Manche Frauen wollen es unbedingt anders machen als ihre eigene Mutter. Ob in die eine oder die andere Richtung, ist dabei eigentlich gar nicht so wichtig: Der Konflikt bleibt der gleiche.
Im Kapitel „Die Eltern-Checklisten“ findest du Checklisten mit vielen Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du möchtest. Nicht alle Antworten auf diese Fragen musst du bis zum Ende durchdenken, aber wenn du sie für dich beantwortet hast, kannst du sicher schon viel besser einordnen, welche Rollenbilder du im Kopf hast und welchen Weg du dir idealerweise vorstellst. Vielleicht kommt dann dabei heraus, dass du die „Ich schaffe alles“-Mutter sein willst. Also eine, die Karriere machen will, trotzdem viel Zeit mit ihren Kindern verbringt, und auch noch in einer Wohnung leben will, die aussieht wie aus einem Einrichtungsmagazin oder einem Pinterest-Board, das jeden Normalsterblichen neidisch macht. Du ahnst es schon: Das wird schwer bis unmöglich. Nimm dir nicht zu viel vor.
Am Ende können wir dir das ewige Hadern mit Idealbildern, Vorstellungen, den eigenen und den gesellschaftlichen Erwartungen nicht abnehmen. Aber die Fragen regen dich sicher zum Nachdenken an und entlarven einige verinnerlichte Denkmuster ganz automatisch als das, was sie sind. Warum sollte ein Kind „nur zur Mutter“ und nicht genauso häufig zum Vater oder einer anderen liebevollen und stabilen Bezugsperson gehören? Warum gibt es einen „Father of the Year“-Award (die Auszeichnung für den „Papa des Jahres“), während von Müttern ganz selbstverständlich immer erwartet wird, die „Mother of the Year“ sein zu wollen? „Man kann es als Frau nur falsch machen“, heißt es oft und da ist was dran. Deshalb ist die beste Lösung, sich von all diesen Erwartungen, auch den eigenen, frei zu machen und den Weg zu gehen, der sich richtig anfühlt. Das ist keine Sache, die an einem Tag passiert. Es ist ein Prozess. Aber je früher man damit anfängt, desto besser.
DENKANSTOSS: ERFAHRUNG EINER LESERIN
Eine Leserin berichtet uns folgendermaßen von ihrem Alltag mit einem Baby und einem Kleinkind zu Hause: Das Baby weint, das dreijährige Kind braucht Aufmerksamkeit, sie kocht mit Babytrage, wischt nebenbei umgekippten Saft auf. Wenn das Baby schläft, liest sie dem anderen Kind Geschichten vor. Sie beschreibt, wie kräftezehrend das ist, wie erschöpft sie ist. Wie sie manchmal morgens nach dem Aufstehen zuerst denkt: „Oh je, schon wieder ein neuer Tag, hoffentlich gibt es heute keine Katastrophen.“
Viele Mütter kennen solche Phasen. Und wir fragen uns: Wo sind die Väter? Warum ist es normal, dass Frauen alleine zu Hause mit mehreren Kindern sind? Auch mit einem Kind kann es ja schon furchtbar anstrengend sein. Ist es fair, dass dieser Job automatisch der Frau zugeschoben wird? Ist es gut für eine Beziehung, wenn der eine Partner das, was der andere zu Hause leistet, weder sehen noch nachvollziehen kann?
Vaterbild: Ernährermythos, Vorbilder, Prägungen
Väter haben es tatsächlich ein bisschen einfacher als Mütter. Der Begriff und die Rolle „Vater“ sind zumindest nicht ganz so aufgebläht und mit Erwartungen überfrachtet wie der Mama-Mythos. Aber auch diese Rolle ist mitnichten frei von Idealbildern. Denn auch jeder Vater ist Sohn eines Mannes, dessen Muster und Eigenschaften er vielleicht ebenfalls gerade nicht reproduzieren will. Sehr viele moderne Männer setzen sich irgendwann ganz bewusst mit ihren eigenen Vätern auseinander. Selbst wenn man das nicht möchte oder kann, ist es möglich, sich zu fragen: Sehe ich mich als Ernährer der Familie? Warum mache ich das? Warum klassifiziere ich viele Aufgaben als typisch weiblich oder eher der Frau zugeordnet und andere nicht? Und vor allem: Was für ein Vater will ich sein? Wie wichtig ist mir mein Job und wie viel Zeit möchte ich mit meiner Familie verbringen?
Im Kapitel „Die Eltern-Checklisten“ haben wir auch für (werdende) Väter einen großen Fragenkatalog zusammengestellt. Es ist übrigens äußerst sinnvoll, wenn beide Elternteile beide Fragebögen durcharbeiten und für sich beantworten. Denn häufig haben Frauen auch gewisse Ansprüche an einen Vater, die ihr Partner eventuell gar nicht erfüllen möchte oder kann. Das gilt umgekehrt natürlich genauso.
Ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert, wird entweder kritisch beäugt („Kann der das? Die armen Kinder!“) oder gefeiert. Und man muss Mut haben, sich dem zu stellen. Seid mutig! Hört auf eure eigenen Bedürfnisse! Es kann unangenehm sein, der Exot zu sein, aber meist ist es das nur für einen ganz kurzen Zeitraum.
Wer fühlt sich wofür verantwortlich?
Das ist die Grundfrage, wenn man gleichberechtigt erziehen und leben möchte. Im Idealfall lautet die Antwort auf diese Frage, dass ihr euch beide gleichwertig für alle Dinge verantwortlich fühlt. In der Realität wird das selten bis nie der Fall sein. Aber man kann ja zumindest mal anfangen. Es sollte euer Ziel sein, dass ihr euch beide für das Wohl der Familie verantwortlich fühlt.
In den meisten Familien ist das nicht selbstverständlich. Frauen werden schwanger, sie haben mit Hormonen zu kämpfen, sie tragen das Kind aus, sie bringen es zur Welt, die meisten wollen stillen. Die Frau ist also körperlich und emotional automatisch viel involvierter in die Elternschaft als der Mann. Oft ist das schon der erste Schritt in die Retraditionalisierung: Sie ist ja schon in der Schwangerschaft für das Kind und alles drum herum verantwortlich, also geht es nach der Geburt so weiter.
Versucht beide, diese Muster zu durchbrechen. Ihr wollt es anders, sonst hättet ihr dieses Buch nicht gekauft. Fragt euch immer wieder: Warum fühle ich mich dafür gerade (nicht) verantwortlich? Meistens gibt es darauf eine einfache Antwort.
Gemeinsam Pläne machen
Gemeinsam zu planen, wie der Familienalltag aussehen soll, kann genauso viel Spaß machen, wie eine große Reise in der Elternzeit zu planen. Dann nämlich, wenn beide Partner sich gesehen fühlen, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Träume eine gleichwertige Rolle spielen. Setzt euch zusammen und überlegt gemeinsam, wie ihr euch Familie vorstellt. Wie viel Zeit wollt ihr zusammen verbringen? Wie stellt ihr euch eine ideale Alltagswoche vor? Wann soll das Kind außerhalb betreut werden? Wer hat welche Träume und Bedürfnisse in Sachen Beruf, Hobbys, Privatleben? Es kann sehr bereichernd sein, gemeinsam Pläne zu machen, genauso, wie es unglaublich erleichternd und hilfreich ist, wenn ein Partner das Kind und den Haushalt nicht nur zu jeder Zeit nahtlos übernehmen kann, sondern auch nachvollziehen kann, welche Belastungen und Sorgen der jeweils andere zu tragen hat.
Wie ihr euch das am Ende auch aufteilt, ob beide 30 Stunden arbeiten, einer in Vollzeit, der andere 25 Stunden, beide flexible 40 Stunden – ihr müsst für euch durchrechnen, wie ihr es euch vorstellen könnt. Ob in Vollzeit oder Teilzeit: Wichtig ist, dass Eltern herausfinden, wie sie arbeiten wollen und dass dann PartnerInnen, das persönliche Netzwerk und ArbeitgeberInnen an einem Strang ziehen, um Vereinbarkeit auf erfüllende Art und Weise möglich zu machen. Das Gleiche gilt für die Aufteilung in allen anderen Bereichen.
ALLTAGSTIPP: BESPRECHT DIE VERANTWORTLICHKEITEN
Es kann sehr sinnvoll sein, die wichtigen Dinge in einem guten Rahmen zu besprechen. Nehmt euch Zeit dafür, sprecht es an, wenn ihr gerade richtig glücklich und konfliktfrei seid. Ideal ist zum Beispiel ein gemeinsames Abendessen oder auch ein Babymoon – so nennen Paare oft den letzten gemeinsamen Urlaub zu zweit, ehe das erste Kind kommt. Die Frage nach den Verantwortlichkeiten muss keine konfliktbeladene Frage sein. Sie kann auch sehr freundschaftlich, empathisch und vor allem gemeinsam geklärt werden.
Familie ist Arbeit
Hier gibt es sicher einige, die es schon bei der Überschrift schaudert. Denn niemand will seine Kinder als „Arbeit“ bezeichnen. Wir würden sogar so weit gehen, zu sagen: Das sollte man auch niemals tun! Kinder sind ja auch nicht per se „Arbeit“, vor allem nicht dann, wenn man mit diesem Begriff insbesondere negative Dinge verbindet. Sie sind kleine Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die wir in unser Leben einladen.
Fakt ist aber: Kinder bringen viel Arbeit mit sich. Sie zu betreuen, zu bekochen, zu wickeln, mit ihnen zu spielen und sie zu trösten – das ist Arbeit. Einen Haushalt planen und organisieren, Kindergeburtstage veranstalten, Geschenke besorgen, Lebensmittel einkaufen: Was ist das, wenn nicht Arbeit? Kochen, putzen, aufräumen, Spielsachen und Kleidung sortieren – alles Arbeit und nur ein Bruchteil dessen, was eben so anfällt im Familienalltag. Unbezahlt sind all diese Dinge natürlich auch, wenig Wertschätzung bekommt man dafür ebenfalls. Es wird einfach seit Jahrhunderten davon ausgegangen, dass das schon irgendjemand übernehmen wird – in den allermeisten Fällen weibliche Wesen. Sich darüber im Klaren zu sein, dass all das, was im Alltag mit Kindern so an Aufgaben anfällt, Arbeit ist, das ist ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Denn wer all diese Dinge allein erledigen muss, der kann nur unter hoher Belastung „nebenbei“ noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
Bezahlte und unbezahlte Arbeit
Das traditionelle Familienmodell sieht so aus: Ein Partner ist erwerbstätig, arbeitet also für Geld, der andere Partner macht die unbezahlte Arbeit und sagt vielleicht sogar von sich „Ich arbeite nicht“. Das stimmt natürlich nicht. Auch diese Person arbeitet – nur eben unbezahlt. Und wenn man genau hinsieht, kann der Partner, der einer Erwerbstätigkeit nachgeht, das auch nur in vollem Umfang machen, weil der andere Teil eben die unbezahlte Arbeit, die sogenannte „Care-Abeit“, zu Hause übernimmt.
Laut Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt Care-Arbeit oder Sorgearbeit die Tätigkeiten des Sorgens und Sichkümmerns. Darunter fällt Kinderbetreuung oder Altenpflege, aber auch familiäre Unterstützung, häusliche Pflege oder Hilfe unter Freunden. Bislang wurden diese Arbeiten überwiegend von Frauen geleistet, oft als unbezahlte Hausarbeit gesellschaftlich als notwendig und selbstverständlich angesehen.
Die Autorin und Feministin Teresa Bücker hat folgenden Vorschlag (im Magazin der Süddeutschen Zeitung, 15.01.2020): „Wenn ein Mann nur aus dem Grund erwerbsarbeiten kann, dass seine Frau sich zu Hause um die Kinder kümmert, sollte sie Anspruch auf die Hälfte seines Einkommens haben. Denn sie ermöglicht mit der Übernahme der unbezahlten Arbeit, dass die andere Person für ihre Arbeit bezahlt wird.“ Das klingt für viele sicher wie ein extremer Gedanke, aber wenn man ihn einmal zu Ende denkt, hat er durchaus seine Berechtigung.
WER ARBEITET WIE VIEL, UND KÖNNEN WIR UNS DAS ÜBERHAUPT LEISTEN?
Arbeit. Geld. Ach, so unromantische Themen … Aber warum eigentlich? Warum gelten Gespräche über Finanzen und Arbeit als unromantisch? Über Geld zu sprechen gehört doch genauso zu einer Paarbeziehung wie Gespräche über Sex oder den Haushalt. Vor allem, wenn man Kinder hat! Natürlich gibt es auch Paare, die mit wenig Kommunikation weit kommen, die zum Beispiel die Kosten einfach nach Gefühl teilen und damit gut fahren. Aber ganz oft ist es sogar harmonischer, wenn die Finanzen geklärt sind. Denn die Folge ist, dass sich ganz sicher keiner von beiden benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlt. Das Gleiche gilt für die Aufteilung der Erwerbsarbeit. Wir finden es viel romantischer, die Bedürfnisse des Partners zu sehen und auf sie einzugehen, als unangenehme Themen auszublenden und in der Folge dann in den meisten Fällen die ganze Familienlast auf den Schultern eines Partners zu parken.

Die große Frage: Wer will, kann und muss wie viel lohnarbeiten?
Im Beruf bekommt man viele Dinge, die man im Alltag mit Kindern nicht bekommt: Anerkennung, soziale Kontakte zu Erwachsenen, Geld und Perspektiven. Versteht uns nicht falsch: Der Alltag mit Kindern hat auch viele Höhen! Aber die eben genannten Dinge bietet er eher weniger. Viele Menschen, Frauen wie Männer, definieren sich und ihre Identität zusätzlich auch noch stark über ihren Beruf. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten wurde Arbeit immer mehr mit Sinn aufgeladen, nicht selten geht es dabei nicht mehr um reinen Brötchenerwerb, sondern um Selbstverwirklichung und die Fragen: Wer bin ich, wie werde ich gesehen, wie sehe ich mich selbst? Und das ist doch ein weiterer, sehr guter Grund, warum das Aussteigen aus dem Job von Partnern fair verhandelt werden muss.
Der andere gute Grund ist natürlich struktureller Natur. Wer erwerbstätig ist und nicht allzu lange in Elternzeit geht, ist finanziell einfach viel besser abgesichert. Für den Fall einer Trennung – er oder sie sollte dann auch gut alleine zurechtkommen können – und auch für die Rentenzeit. Ein zweites Einkommen sichert aber auch die Familie ab und entlastet somit den Partner oder die Partnerin. Wenn das eine Gehalt aus irgendwelchen Gründen ausfällt, landet die Familie nicht in der finanziellen Katastrophe. Der andere Partner oder die Partnerin kann das abfangen.
Auch ein in Deutschland sehr häufig gelebtes Modell – einer arbeitet Vollzeit, der andere Teilzeit – ist selten fair, wenn es keinen klaren finanziellen Ausgleich für den Teilzeitpart gibt. Denn in Kombination mit Care- und Hausarbeit ist eine Teilzeitstelle schnell ein Rund-umdie- Uhr-Job. Und wer sich mehrheitlich zu Hause um alles kümmert, kann im Job schlechter performen. Ganz abgesehen davon, dass jahrelange Teilzeitarbeit eben lebenslange Folgen hat. Es gibt Berufe, in denen man nach vielen Jahren wieder einfach auf Vollzeit wechseln kann. Aber mit einem Ausbildungsberuf wird man nie wieder in die Gehaltsregionen vordringen, die man ohne die Auszeit gehabt hätte. Damit ist die Rollenverteilung zementiert.
Das Ideal: Beide sind im gleichen Umfang erwerbstätig
Die gerechteste Aufteilung wäre natürlich, wenn beide Partner zeitlich gleich viel erwerbstätig sind, im besten Fall verdienen sie dabei auch noch in etwa gleich viel. Das ist logischerweise selten möglich oder der Fall. Dabei wünschen sich laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2015 fast die Hälfte der Eltern, dass Vater und Mutter annähernd gleich viele Stunden im Job sind.
Obwohl die Realität also anders aussieht und es für euch vielleicht auch im ersten Schritt nicht direkt möglich sein wird, die Erwerbsarbeit gerecht zu verteilen, finden wir es ganz gut, sich an einem Ideal zu orientieren. Natürlich sind hier aber – wie immer – ganz viele verschiedene Konstellationen möglich. Man kann auch mit einer anderen Arbeitsaufteilung eine gleichberechtigte Beziehung führen!
Alternative Modelle
Nach der Elternzeit ist es zum Beispiel möglich, Elterngeld Plus zu beziehen und so eine Weile in Teilzeit zu arbeiten, dabei aber den finanziellen Ausfall aufzufangen. Prüft, ob das für euch eine Option ist – insbesondere für den Vater. Arbeiten beide Partner gleichzeitig und am Stück vier Monate lang höchstens 30 Stunden und beziehen Elterngeld Plus, gibt es den Partnerschaftsbonus – das heißt: vier zusätzliche Monate Elterngeld Plus. Vielleicht ist es aber auch eine Möglichkeit, dass ein Partner ein Jahr in Teilzeit geht, und danach der andere. Klärt das mit euren ArbeitgeberInnen ab und informiert euch, was in eurer Jobsituation machbar ist.
Auch das in Deutschland am meisten verbreitete Konzept der „Zuverdiener- Ehe“ (ein Elternteil arbeitet in Vollzeit, der andere ist in Teilzeit angestellt und kümmert sich mehrheitlich um die Care-Arbeit und den Haushalt), muss nicht unbedingt ungerecht sein. Wichtig ist dann nur, dass der Partner, der Vollzeit arbeitet, für den anderen finanziell, vor allem in Sachen Altersvorsorge, einen Ausgleich schafft und der Elternteil, der weniger Stunden der Erwerbstätigkeit nachgeht, trotzdem nicht noch die komplette Care-Arbeit alleine erledigen muss. Das wird nämlich schnell zu viel.
Die 40-Stunden-Woche und die Teilzeitfalle
Nicht nur Eltern, aber sie insbesondere, hinterfragen bereits seit einer Weile die 40-Stunden-Woche. Zumal in Deutschland oft 40 Stunden im Vertrag stehen, tatsächlich aber viel mehr gearbeitet wird. Kinder brauchen Zeit. Sie brauchen Ruhe, sie brauchen Zuwendung, und – wie schon erwähnt – sie produzieren auch Arbeit. Wer jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr erwerbstätig ist, wird de facto sehr wenig Zeit mit dem Kind oder den Kindern verbringen können – und auch nur einen geringen Teil der anfallenden familiären Arbeit stemmen können. Kaum überraschend: 28 Prozent der Befragten der besagten Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach fänden ein Modell, in dem beide Partner Teilzeit arbeiten, ideal.
„Ich bin überzeugt, dass die 40-Stunden-Woche viel dazu beiträgt, dass die Menschen unzufrieden sind. Man kann nicht 40 Stunden arbeiten und daneben einen Haushalt führen und die Kinder unterhalten,“ sagt die Scheidungsanwältin Helene Klaar (Magazin der Süddeutschen Zeitung, 15.02.2016). Und wir finden, dass das für Frauen und Männer gleichermaßen gilt. Dennoch ist die Vollzeitstelle für sehr viele Menschen alternativlos. Das hat finanzielle Gründe, hat aber auch etwas mit dem Arbeitsethos in Deutschland zu tun. Teilzeitarbeit – also alles unter 40 Stunden – wird gerne belächelt und geht mit deutlich niedrigerem Gehalt, weniger Anerkennung und Aufstiegschancen einher.
Das liegt unter anderem daran, dass Teilzeit in Deutschland ein weibliches Phänomen ist. Laut dem Mikrozensus aus dem Jahr 2017 arbeiten hierzulande Frauen, die minderjährige Kinder haben und in einer Partnerschaft leben, zu 71 Prozent in Teilzeit. Bei den Vätern sind es nur sechs Prozent.
Die Gründe dafür sind einmal mehr vielfältig, aber das muss euch ja nicht davon abhalten, den anderen Fall einfach einmal zu durchdenken. Könntet ihr es finanziell stemmen, wenn der Vater oder beide Eltern (zumindest vorübergehend) in Teilzeit gingen? Wenn euch das gelänge, würdet ihr ganz nebenbei eine Arbeitsrevolution vorantreiben, die langfristig uns allen zugutekommt. „Männer, die in Teilzeit arbeiten, hätten die Macht, unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt zu verändern“, schreibt die Journalistin Ines Schipperges in einem Kommentar auf Zeit Online Arbeit (24. April 2019), und wir finden, sie hat recht.
Die Rushhour des Lebens entzerren
Die Lebensphase zwischen 25 und 45 Jahren wird von Soziologen gerne die „Rushhour des Lebens“ genannt. Denn in diesen Jahren kommt eine Menge zusammen: Im Beruf werden die Weichen gestellt, man ist mit der Partnerwahl beschäftigt und viele gründen eine Familie. Vermögensaufbau wäre auch schön. Alles scheint gleichzeitig zu passieren, und nebenbei will man vielleicht auch noch ein bisschen leben, reisen und genießen. Das Lebensmodell, in dem man in diesen Jahren ranklotzt, um dann mit Mitte 60 in Rente zu gehen, hat eigentlich ausgesorgt, alleine schon deshalb, weil wir alle sehr viel älter werden, als es noch unsere Großeltern wurden.
Aber bisher hat sich an diesem Modell wenig geändert. Die „Rushhour des Lebens“ ist für sehr viele Menschen eine große Belastung. Diese zu entzerren würde vielen das Leben leichter und ihren Lebenswandel gesünder machen. Vielleicht schafft ihr es, durch eine gleichberechtigte Aufteilung das für euch zu zumindest teilweise hinzubekommen.
ALLTAGSTIPP: SPRECHT ÜBER DAS STRESSLEVEL
Wenn ein Elternteil einen anstrengenden und zeitintensiven Job hat, heißt es oft: Der andere soll wenigstens nicht auch so viel Stress haben – und nicht erwerbstätig sein, sondern zu Hause bleiben. Es ist völlig klar, dass es anstrengende und weniger anstrengende Berufe gibt. Zudem sind die individuellen Belastungsgrenzen unterschiedlich.
Aber grundsätzlich gilt: Kinder zu betreuen und einen Haushalt zu organisieren ist definitiv auch anstrengend! Vielleicht sogar stressiger, sicher aber ermüdender als die meisten Erwerbsjobs. Ehrlich und offen über das individuelle Stresslevel zu sprechen ist wichtig. Und meistens ist die fairste Lösung, alle Auslöser von Stress einfach gerecht aufzuteilen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842616431
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (März)
- Schlagworte
- Mentalload Mama Ratgeber Paarbeziehung Eltern als Team little years Elternzeit Haushalt gerecht aufteilen Achtsamkeit Harmonie Beziehungsratgeber Selbstfürsorge