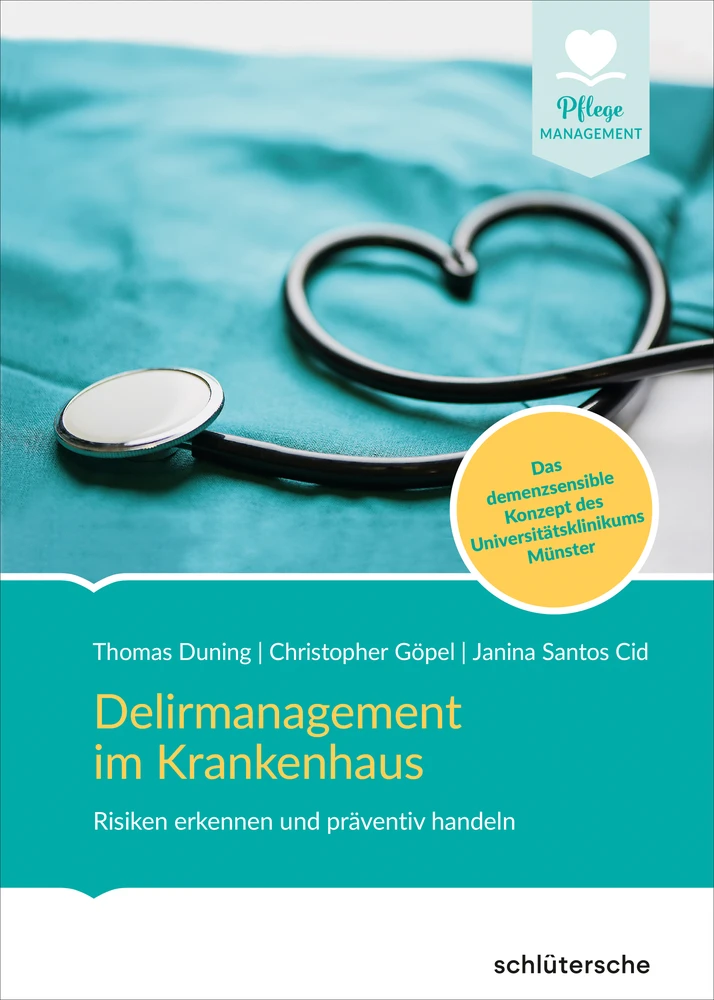Zusammenfassung
Doch es gibt eine Strategie gegen das Delir: das sog. Delirmanagement, also die Prävention sowie der Umgang mit einem Delir. Dabei liegen die Schwerpunkte sowohl auf der pharmazeutischen auch auf der pflegerischen Behandlung eines Delirs.
Im Universitätsklinikum Münster gehört das Delirmanagement zum demenzsensiblen Versorgungskonzept. Dazu gehören u. a. ein Demenzscreening bei der Patientenaufnahme, ein pharmazeutisches Aufnahmegespräch, die direkte Patientenbetreuung, die Mitarbeiterschulung und eine spezifische Demenzvisite.
Die Erfahrungen der Uniklinik Münster sprechen für sich: Die Senkung der Delirrate von 21 auf 6 Prozent! Ein Delirmanagement wirkt!
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Unser Buch hat einen bewusst pragmatischen Ansatz zu therapeutischen und präventiven Maßnahmen bei Delir und Demenz im Krankenhaus.
Insgesamt hat es das Delir in der aktuellen Krankenhauslandschaft schwer, weil es aufgrund der wenig einheitlichen Symptome und den multifaktoriellen pathophysiologischen Gründen keinem einzelnen Fachgebiet und auch keiner Profession klar zuzuordnen ist. Man benötigt sowohl eine ärztliche wie auch eine pflegerische Expertise, zudem eine klinisch-pharmazeutisch und auch eine sozialmedizinische.
Es bedarf eines Sachverstandes in der Neurologie, der Psychiatrie, der Inneren Medizin und der Geriatrie sowie der Pharmakologie und auch der Anästhesie. Das bedingt, dass es keine klassischen »Delir-Experten« im Krankenhaus gibt. Das Delir und auch kognitive Defizite bei Demenz werden deshalb im Krankenhaus auch heute noch regelhaft übersehen, kaum dokumentiert und nicht gut verstanden. Es gibt auch in Krankenhäusern, in denen delirante Symptome aufgrund des älteren Patientenkollektivs häufig vorkommen, selten einheitliche Konzepte oder interdisziplinäre und multiprofessionelle Teams, welche die Patienten entsprechend behandeln. Dabei hat ein Delir für solche Patienten eine erhebliche klinische Relevanz.

In diesem Buch stellen wir deshalb sehr praxisnahe Konzepte zum Delirmanage ment vor, die sich in der klinischen Realität als sehr hilfreich und sinnvoll erwiesen haben.
Diese Konzepte beziehen viele Berufsgruppen ein, sodass es sich um kein reines Fachbuch der Krankenpflege handelt. Es dient vielmehr dazu, über den Tellerrand einer einzelnen Profession im Gesundheitswesen hinauszublicken, weil nur so ein Delirmanagement effektiv gelingen kann.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass Sie das Wissen in Ihren klinischen Alltag integrieren können.
Prof. Dr. med. Thomas Duning
Christoph Göpel
Janina Santos Cid
1 Relevanz des Themas
Janina Santos Cid
Der demografische Wandel ist für niemanden ein unbekannter Begriff. In Deutschland ist er längst angekommen und verschiebt den demografischen Rahmen auf eine bislang unbekannte Art und Weise. Bereits heute ist jede zweite Person in Deutschland älter als 45 Jahre und jede fünfte älter als 65 Jahre.1 Die Ursachen liegen in dem langjährigen Geburtenrückgang sowie der zunehmenden Lebenserwartung. Mit dem Erreichen eines hohen Lebensalters ist aber auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Pflegebedürftigkeit und/oder Demenzerkrankung verbunden.
Definition Demenz
Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, die mit einem schleichenden Verfall kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten einhergeht. Bei einer Demenzerkrankung bestehen alltagsrelevante Einschränkungen.*
* Vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Altern ist multifaktoriell und umfasst mehrere Aspekte, zum einen das biologische Altern in Lebensjahren, zum anderen das psychologische Altern als die subjektive Wahrnehmung des Altseins, das soziale Altern sowie die Umweltbedingungen des Alterns. Nach Eintritt in die Rente verändert sich für den Menschen das soziale Umfeld, der tägliche Gang zur Arbeit fällt weg und es müssen neue Tagesabläufe geschaffen werden. Mit steigendem Alter kommt es zudem häufig zu einem Wegfall des sozialen Umfeldes. Immer mehr Menschen aus dem Umfeld versterben, was zu einer verminderten Interaktion mit der Außenwelt führt. Zusätzlich spielt das subjektive Altersgefühl eine Rolle. Dies kann je nach Lebenseinstellung anders gelebt werden.
Mit dem Altwerden gehen neue Erwartungen der Gesellschaft einher. Durch den Wegfall von sozialen Kontakten kommt es zu Einsamkeit, was den Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit fördert. Zusätzlich leiden Menschen im höheren Lebensalter häufig unter mehreren Erkrankungen gleichzeitig, sind also multimorbid. Diese Erkrankungen wirken wiederum ebenfalls auf die soziale Teilhabe sowie das subjektive Wohlbefinden des Menschen.
Der höchste Risikofaktor für eine Demenz ist das Alter. Lediglich 2 Prozent der Demenzerkrankten sind unter 65 Jahre alt. Unsere Gesellschaft wird durch verschiedene Faktoren wie gesündere Lebensweise, verbesserte Versorgungsstrukturen und medizinische Versorgung immer älter. Entwickelt sich dies so weiter, sind im Jahre 2050 rund 23 Mio. Menschen über 65 Jahre alt.2

Info
Derzeit leben in Deutschland 1,63 Mio. Menschen mit Demenz, davon sind rund zwei Drittel weiblich. Nach aktuellen Schätzungen wird in der heutigen Gesellschaft jede zweite Frau und jeder dritte Mann im Laufe des Lebens an Demenz erkranken.
Die höhere Lebenserwartung von Frauen begründet den erhöhten Anteil an demenzkranken Frauen.3 Menschen in Gesundheitsberufen, aber auch Privatpersonen werden in ihrem Umfeld, Freundes- und Familienkreis mindestens einen Menschen mit Demenz kennen. Besonders der pflegerische Alltag wird von dieser Personengruppe betroffen sein. Prognosen der deutschen Alzheimergesellschaft beschreiben einen Anstieg der Demenzerkrankungen bis 2060 um mehr als das Doppelte. Damit werden mehr als 3 Mio. Menschen in Deutschland an Demenz erkranken.4
Die Gefahr, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden, ist für Menschen mit Demenz deutlich höher als für Menschen ohne Demenz.5 Deutsche Krankenhäuser sind in der Regel auf die akute Behandlung von Krankheiten ausgelegt, nicht auf Demenzerkrankte. Für Menschen mit Demenz stellt ein Krankenhausaufenthalt eine kritische Situation dar.6 Etwa drei Viertel der Menschen mit Demenz leben derzeit im eigenen Zuhause und werden durch Angehörige oder Pflegedienste unterstützt. Im Rahmen einer Auswertung von Daten der AOK Sachsen werden Menschen über 65 Jahre mit einer diagnostizierten Demenzerkrankung zu 33 Prozent häufiger im Krankenhaus behandelt, als Personen dieser Altersklasse ohne Demenz. Zudem müssen sie signifikant länger im Krankenhaus bleiben und verursachen erhöhte Kosten.7

Abb. 1: Prävalenzrate von Demenzerkrankungen in Deutschland nach Alter und Geschlecht (2014).
© Deutsches Zentrum für Altersfragen, Alzheimer Europe, Statista 2017

Derzeit erfolgt die Arbeit in Krankenhäusern im Rahmen fester Strukturen, um akute Erkrankungen und Notfälle bestmöglich zu versorgen. Diese Strukturen, die »unruhige« Umgebung, aber auch der Ortwechsel, sind für Menschen mit Demenz verstörend.
2014 wurde auf das Thema »Demenz« im Rahmen des Projektes »Blickwechsel Demenz« in NRW aufmerksam gemacht. Auch am Universitätsklinikum Münster bestand ein Bedarf von Konzepten zu Delirprävention und -management, weil die zunehmende Anzahl älterer Patienten sowohl auf chirurgischen, aber auch konservativen Stationen für medizinische und ökonomische Komplikationen sorgte. Es bestand ein nicht geringer Handlungsbedarf. Das multiprofessionelle Team des Demenzsensiblen Krankenhauses am UKM hat diesen Aufruf genutzt, um im Universitätsklinikum Münster ein individuelles und pragmatisches Konzept zur Behandlung dieser Patientengruppe zu etablieren. Die Umgebungsfaktoren und Strukturen in Krankenhäusern lassen sich nicht immer ändern, wohl aber die Betreuung und medizinische Versorgung dieser besonderen Patientengruppe. Das Konzept hat sich mittlerweile über Jahre bewährt und wird anhand genormter Standards durchgeführt. 2019 hat das Demenzsensible Krankenhaus als erstes deutsches Krankenhaus sein Delirpräventionskonzept nach der ISO 9001:2015 zertifizieren lassen ( Kap. 10.2).
Kap. 10.2).

Info
Die Demenz im Krankenhaus ohne das Thema Delir zu betrachten, ist beinahe nicht möglich, so häufig tritt ein Delir bei Krankenhausaufenthalten von demenzkranken Menschen auf. Die Rate von Delirien bei Demenzerkrankten liegt bei 89 Prozent. Besonders der Aufenthalt in Notaufnahmen ist für diese Menschen sehr belastend und führt häufig zu Delirien.
Auslöser können der Umgebungswechsel, verschiedene Medikamente, Operationen, aber auch Infektionen oder andere akute Erkrankungen sein.8 Das Delir ist ein Notfall und geht mit einer temporär erhöhten Mortalität einher. Beschrieben ist das Delir bereits seit langer Zeit. Hippokrates sagte bereits 143 vor Chr.: »…und wenn zum Fieber noch ein Delir hinzukommt, dann ist der Patient verloren.«
Besonders auf Intensivstationen und in Notfallaufnahmen sind die Abläufe im Arbeitsalltag nicht auf die Bedürfnisse von alten und demenzerkrankten Patienten ausgelegt. Menschen, die ein Delir erleiden, erleben dieses als traumatische Erfahrung. Häufig einhergehend mit einem Delir sind Zustände der örtlichen Verwirrtheit. Gerade Menschen mit Demenz fehlt das Verständnis für eine Krankheit oder eine anstehende Operation. Komplexe Gedankengänge darüber, dass eine Operation mit Schmerzen und Heilung einhergehen, sind nicht mehr möglich. Pflegekräfte und Ärzte, aber auch Angehörige müssen in der Lage sein, sich in die Situation des Menschen mit Demenz hineinzuversetzen.
Definition Delir
Das Delir ist eine schwerwiegende Komplikation, v. a. bei älteren Menschen, und geht mit einer Störung der Aufmerksamkeit und des Bewusstseins einher.
So schilderte z. B. ein Patient folgende Situation: »Ich wurde wach und wusste nicht, wo ich war. Etwas piepte laut. Ich versuchte, den Kopf zu drehen, da waren überall Kabel und ich hatte Schmerzen. Wo war ich nur? Meine Brille fehlte, daher konnte ich die Menschen um mich herum nur schemenhaft erkennen. Auch die Hörgeräte fehlten, daher konnte ich die Gespräche um mich herum nur als störend und undeutlich empfinden. Ich versuchte mich aufzurichten und wurde von mehreren Händen wieder runtergedrückt. Was war nur passiert? War ich in Gefangenschaft? Ich hatte große Schmerzen am Brustkorb und wollte fühlen, was dort passiert war. Blutete ich? Ich bemerkte, dass meine Hände am Bett gefesselt waren. Nun rief ich laut um Hilfe.«
Literatur
American Psychiatric Association (2013): Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5/ American Psychiatric Association. Washington: American Psychiatric Publ; 2013.
Destatis (2019): Bevölkerung. Ältere Menschen. Die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen ab 65 Jahren. https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografscher-Wandel/Aeltere-Menschen/bevoelkerung-ab-65-j.html
Pinkert C, Holle B (2012): Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2012/08.
Motzek T, Werblow A, Schmitt J, Marquardt G (2019): Administrative Prävalenz und Versorgungssituation der Demenz im Krankenhaus – Eine versorgungsepidemiologische Studie basierend auf GKV-Daten sächsischer Versicherter. In: Gesundheitswesen (Bundesverband der Arzte des Öfentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)) 81 (12), S. 1022–1028. DOI: 10.1055/s-0043-125071.
Statista (2016): Prävalenzrate von Demenzerkrankungen in Deutschland nach Alter und Geschlecht im Jahr 2018. https://de.statista.com/statistik/daten/stu-die/246021/umfrage/praevalenzrate-von-demenzerkrankungen-in-deutsch-land-nach-alter-und-geschlecht/
Statista (2020): Bevölkerung – Zahl der Einwohner in Deutschland nach relevanten Altersgruppen am 31. Dezember 2019. https://de.statista.com/statistik/daten/stu-die/1365/umfrage/bevoelkerung-deutschlands-nach-altersgruppen/
Zieschang T, Bauer JM (2017): Menschen und Demenz: Wie begegnen wir den Bedürfnissen der Betroffenen und denen ihrer Angehörigen? In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 50 (1), S. 1–3. DOI: 10.1007/s00391-016-1167-1.
________________
1 Vgl. Destatis (2019): Bevölkerung. Ältere Menschen. Die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen ab 65 Jahren. https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/Aeltere-Menschen/bevoelkerung-ab-65-j.html
2 Vgl. Statista (2020): Bevölkerung – Zahl der Einwohner in Deutschland nach relevanten Altersgruppen am 31. Dezember 2019. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1365/umfrage/bevoelkerung-deutschlands-nach-altersgruppen/
3 Ebd.
4 Ebd.
5 Vgl. Pinkert C, Holle B (2012): Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2012/08
6 Vgl. Zieschang T, Bauer JM (2017): Menschen und Demenz: Wie begegnen wir den Bedürfnissen der Betroffenen und denen ihrer Angehörigen? In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 50 (1), S. 1–3. DOI: 10.1007/s00391-016-1167-1
7 Vgl. Motzek T et al. (2019): Administrative Prävalenz und Versorgungssituation der Demenz im Krankenhaus – Eine versorgungsepidemiologische Studie basierend auf GKV-Daten sächsischer Versicherter.
In: Gesundheitswesen (Bundesverband der Arzte des Offentlichen Gesundheitsdienstes [Germany]) 81 (12), S. 1022–1028. DOI: 10.1055/s-0043-125071.
8 Vgl. Zieschang & Bauer 2017
2 Kognitive Störungen und Demenzerkrankung
Thomas Duning
»Weg vom Geist« oder »ohne Geist« ist die wörtliche Übersetzung des Begriffs »Demenz« aus dem Lateinischen. In die heutige Zeit und Sprache übersetzt meint man mit einer Demenz eine alltagsrelevante kognitive Beeinträchtigung. Diese Definition macht deutlich, dass spezifische Symptome vielfältig sein können, zudem ist die Sichtweise, wann ein Symptom zu »alltagsrelevanten Einschränkungen« führt, variabel auslegbar.
Auch heute noch wird eine Demenz anhand der klinischen Symptome diagnostiziert. Nach den auch heute noch gültigen ICD-10 Kriterien sind das für den klinischen Alltag zusammenfassend:
1. alltagsrelevante kognitive Defizite (Gedächtnis, Orientierung, Aufmerksamkeit, Sprache, planerisches Handeln, Verhalten, Visuokonstruktion),
2. chronisch oder fortschreitend verlaufend: mindestens sechs Monate anhaltend,
3. ungetrübtes Bewusstsein,
4. Sinne sind im für die Person üblichen Rahmen unbeeinträchtigt.
Im Folgenden werden die vier Punkte der Definition nochmals genauer betrachtet und anhand praktischer Beispiele verdeutlicht, um herauszustellen, was die Anwendung im klinischen Alltag bedeutet.
1. Alltagsrelevante kognitive Defizite
Wichtig hier ist, dass die kognitiven Defizite nicht definiert sind, d. h. es »muss« keine Gedächtnisstörung vorliegen, wie häufig vermutet. Eine Störung der Gedächtnisleistung ist bei vielen Demenzerkrankungen nicht typisch (z. B. bei der Frontotemporalen Demenz oder der Lewy-Körper(chen) Demenz) und tritt z. T. erst später im Verlauf der Erkrankung auf. Wichtig für die Diagnose ist vielmehr die Alltagsrelevanz der vorliegenden kognitiven Defizite. Im praktischen Alltag heißt dies: Kann sich der Patient noch selbstständig versorgen? Falls nein: Warum nicht? Sind die kognitiven Störungen hierfür der Grund? Und wenn ja: Welche konkreten Probleme treten im Alltag durch die kognitiven Defizite auf? So lässt sich durch eine gezielte Eigen- oder Fremdanamnese recht zügig eingrenzen,
1. ob eine Demenz vorliegt und
2. was das führende neurokognitive Symptom der Demenz ist.

Info
Gedächtnisstörungen sind das klassische klinische Symptom einer Demenz vom Typ Alzheimer, definieren aber keine Demenz. Es gibt Demenztypen, die bedingen erhebliche alltagsrelevante Defizite, jedoch ist die Gedächtnisleistung noch recht gut. Der Fokus bei der Demenzdefinition liegt auf der Alltagsrelevanz der Störungen, die auch andere kognitive Domänen betreffen kann.
2. Chronisch oder fortschreitend verlaufend: Mindestens 6 Monate anhaltend
Es gibt viele Gründe für kognitive Einschränkungen, die durch z. B. angeborene anlagebedingte oder traumatische Gehirnveränderungen oder -verletzungen schon in jungen Jahren auftreten. Zudem gibt es sicher per se kognitive Minderbegabungen. Zwar ist der Begriff der Demenz in den letzten Jahren ausgeweitet worden und umfasst auch z. T. reversible Erkrankungen des Gehirns, jedoch sind prinzipiell mit dem Begriff langsam progrediente primäre oder sekundäre neurodegenerative Prozesse gemeint und kein immer schon bestehendes Defizit. Deshalb ist es im Prinzip nicht möglich, bei der Erstvorstellung des Patienten eine Demenz zu diagnostizieren, weil die untersuchten und objektivierten Defizite ja angeboren sein könnten. Jedoch dürfen die Defizite auch rückblickend festgestellt werden, z. B. durch eine gezielte Fremdanamnese, und sollten in den letzten sechs Monaten progredient verlaufen, also langsam schlechter werdend. Wichtig ist aber, eine gezielte Fremdanamnese zu erfassen, die auch die Alltagsrelevanz der Symptome fokussiert.
Beispiel Defizite: Demenz oder nicht?
Ein Patient zeigt in der Untersuchung insbesondere exekutive Funktionsstörungen (schnelles, zielorientiertes Denken und Handeln), im MoCA erreicht er 20 von 30 möglichen Punkten. Die Ehefrau berichtet, dass ihr Mann den Alltag nicht bewältigen konnte, als sie vor kurzem wegen einer Erkrankung in einer Kur war. Zudem berichtet sie jedoch, dass diese Defizite nicht neu seien. Ihr Mann habe nach der Sonderschule wegen einer Lernschwäche eine Ausbildung zum Lagerarbeiter abgeschlossen. Nach Umstellung auf ein elektronisches System an seinem Arbeitsplatz kam es vor etwa 15 Jahren bereits zu Fehlern, weshalb aufgrund der kognitiven Defizite am Arbeitsplatz eine Frühberentung erfolgte.
Sie schlussfolgern in diesem Fall korrekt, dass die von Ihnen objektivierten kognitiven Störungen nicht neu oder progredient sein müssen, sondern wahrscheinlich ein vorbestehendes Minderleistungsprofil darstellen. Zwar kann zusätzlich eine neurodegenerative Erkrankung vorliegen, aber progrediente alltagsrelevante kognitive Defizite lassen sich klinisch nicht objektivieren, sind also klinisch keine Demenzkriterien.
3. Ungetrübtes Bewusstsein
»Bewusstseinsklarheit« ist ebenso ein unscharf definierter Begriff. Für den klinischen Alltag meint dies v. a. der Ausschluss einer akuten, organisch bedingten Verwirrtheit (z. B. durch Medikamente, Fieber bei Infekten oder einfach eine Exsikkose) oder psychiatrischer Grunderkrankungen wie Psychosen. Zudem ist aber auch eine Voraussetzung, dass der Patient wach ist, d. h. nicht vigilanzgemindert. Nur einem wachen Patienten ist es möglich, sich in der neuropsychologischen Untersuchung oder in den durchgeführten Kurztests ausreichend zu fokussieren, um ein valides Test- oder Untersuchungsergebnis zu erhalten. Dies bedeutet insbesondere bei älteren Patienten: Sedierende Medikamente – die in diesem Patientenkollektiv nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind (v. a. eine Schlafmedikation) – schließen ein auswertbares Testergebnis aus!
Beispiel Vigilanzminderung
Ein Patient kommt zu Ihnen mit dem V.a. eine beginnende Demenz. Sie führen um 08:30 Uhr einen Mini Mental Staus Test durch. Schon bei der Instruktion wirkt der Patient müde und leicht ablenkbar. Sie erhalten 17 von 30 möglichen Punkten. Im Medikamentenplan fällt Ihnen auf, dass der Patient wegen Einschlafstörungen seit Längerem abends 6 mg Bromazepam einnimmt, zudem wegen Unruhe morgens und abends Olanzapin 2,5 mg, und bei Bedarf Pipamperon (bei »innerer Unruhe«, die heute wg. der anstehenden Testung vorhanden war).
Ihre richtige Schlussfolgerung: Ein Objektivieren möglicher kognitiver Störungen ist wegen der pharmazeutisch bedingten Vigilanzminderung nicht möglich. Sie machen einen neuen Termin und versuchen, die sedierende Medikation bis dahin langsam zu beenden.

Info
Eine auch nur leichte Vigilanzminderung schließt insbesondere bei älteren Patienten eine valide Objektivierung der kognitiven Störungen aus!
4. Die Sinne sind im für die Person üblichen Rahmen unbeeinträchtigt
Bei Demenzuntersuchungen werden in der Regel ältere Patienten untersucht. Viele haben altersbedingte Seh- oder Hörstörungen. Eine Untersuchung auf alltagsrelevante kognitive Einschränkungen ist nur mit einer ausreichenden Korrektur dieser Beeinträchtigungen möglich. Zwar gibt es inzwischen auch neuropsychologische Tests für Patienten mit starker Seh- oder Hörbehinderung, jedoch sind deren Ergebnisse oft nur durch eine fachspezifische neuropsychologische Expertise beurteilbar. In den sehr etablierten und im klinischen Alltag leicht zu interpretierenden Tests oder auch in den neurologischen Untersuchungen der Kognition »imitieren« v. a. Hörstörungen kognitive Defizite, z. B. eine Alzheimerdemenz.
Beispiel Schwerhörigkeit statt Alzheimer
Ein Patient mit Hörgerät kommt zu Ihnen. Sie beobachten die Durchführung des MMST durch einen Mitarbeiter. Bei der Instruktion einiger Tests fragt der Patient drei Mal: »Wie bitte?« Ihr Mitarbeiter ist sichtlich genervt, erklärt die Instruktion aber lautstark nochmals. Der Patient nickt. In der Auswertung fallen ausgeprägte visuokonstruktive Störungen auf (Fehler im Uhrentest), zudem Fehler bei den Merkfähigkeitstests. Der Patient erreicht 8 von 30 Punkten.
Sie werten das Testergebnis entsprechend: Zwar können kognitive Defizite vorliegen, jedoch kann man nicht abschätzen, welches Ausmaß die Hypakusis am Testergebnis hatte. Insbesondere eine Schwerhörigkeit kann Symptome einer Alzheimererkrankung in den Kurztests imitieren. Es zeigt sich, dass die Batterie der Hörhilfe aufgebraucht war. Der Patient bemerkte die Ungeduld bei der Instruktion durch seine Schwerhörigkeit und verzichtete auf ein erneutes Nachfragen. Nach erneuter Durchführung mit einer Parallelversion, diesmal mit funktionierender Hörhilfe, erreicht der Patient 22/30 Punkte.
2.1 Die Demenz
Die Demenz ist im engeren Sinne keine Krankheit, d. h. keine eigenständige Pathophysiologie oder strukturelle Gehirnveränderung, sondern ein Symptomkomplex, der durch kognitive Einschränkungen zu alltagsrelevanten Beeinträchtigungen führt. Auch die aktuell gültige S3-Leitlinie »Demenzen«9 geht von einem zweistufigen Vorgehen aus:
1. Vorliegen alltagsrelevanter kognitiver Defizite,
2. Klärung der Ätiologie der Symptome,
d. h. zunächst eine Prüfung, ob die geschilderten ICD-10-Kriterien vorliegen (also alltagsrelevante kognitive Einschränkungen). Dann muss aber wenigstens eine Mindestdiagnostik erfolgen, um die zugrundeliegende Erkrankung zu bestimmen. Nur mit der Diagnose der zugrundeliegenden Pathophysiologie ist eine gezielte Therapie möglich.

Demenz ≠ Alzheimer!
Die Alzheimer-Krankheit ist eine Gehirnerkrankung, die jedoch keine Demenz definiert. Die Demenz ist ein Symptomkomplex, deren pathophysiologischer Grund diagnostiziert werden muss. Neben der Alzheimer-Krankheit gibt es unterschiedliche weiter Gehirnerkrankungen, die zu einer Demenz führen, die jedoch anders behandelt werden. Deshalb ist eine weiterführende Diagnostik essenziell.
Tab. 1: NINCDS-ADRDA Kriterien einer Demenz, ohne eine ätiologische Zuordnung
| Generelle Kriterien einer Demenz (ohne Subklassifikation) nach NINCDS-ADRDA |
| Alltagsrelevanz der neurokognitiven Defizite |
| Zunehmende Verschlechterung vorher vorhandener Fähigkeiten und Fertigkeiten (nach ICD 10 für mind. 6 Monate) |
| Kein Vorliegen eines Deliriums, einer Bewusstseinsstörung oder einer anderer psychiatrischen Grunderkrankung |
|
Kognitive Defizite sind untersuch durch eine Kombination aus 1. Eigen- oder Fremdanamnese und 2. Objektive kognitive Testung, entweder durch einen etablierten Kurztest oder eine standardisierte neuropsychologische Testung (neuropsychologische Testung sollte durchgeführt werden, wenn die Anamnese und der Kurztest uneindeutig bleiben). |
|
Defizite in mind. 2 der folgenden kognitiven Bereiche • Gedächtnisfunktion • Sprache • Visuokonstruktion • Auffassung und Urteilsvermögen • Wesen und Verhalten |
2.1.1 Diagnostik einer Demenz
Der Begriff der Demenz wurde in den letzten Jahren ausgeweitet und umfasst nicht nur primär neurodegenerative Erkrankungen (Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Demenz, Frontotemporale Demenz), sondern auch sekundär neurodegenerative Krankheiten (z. B. vaskuläre Demenz), d. h. eine neuronale zentrale Schädigung, die nachfolgend durch andere Erkrankungen entsteht.
Bei der vaskulären Demenz sind das beispielsweise Durchblutungsstörungen des Gehirns, welche sekundär die versorgten Neurone schädigt. Zudem führen auch metabolische oder nutritiv-toxische, internistische Erkrankungen zu alltagsrelevanten kognitiven Einschränkungen und damit zu Demenzsymptomen. Eine Hypo- oder Hyperthyreose, Hypoglykämien, Hypovitaminosen oder Medikamentenintoxikationen können Demenzsymptome hervorrufen. Beim Vorliegen von Demenzsymptomen ist deshalb eine weiterführende Diagnostik durchzuführen. Im Folgenden wird die Minimaldiagnostik der derzeitigen Leitlinien aufgeführt und für den klinischen Alltag pragmatisch zusammengefasst:
1. Ausführliche Blutuntersuchungen,
2. CT oder MRT des Kopfes,
3. Objektivieren der kognitiven Defizite.

Info
Die Demenzerkrankungen sind ein multi-ätiologisches und pathophysiologisch extrem heterogenes Syndrom. Es muss eine weitere Diagnostik zur Klärung der zugrundeliegenden Ätiologie erfolgen!
Ausführliche Blutuntersuchungen
Wie bereits oben erwähnt können internistische Erkrankungen zu kognitiven Defiziten führen. Einige dieser Erkrankungen sind sehr gut behandelbar, weshalb sie nicht übersehen werden dürfen. Als Beispiel seien hier die hepatischen oder renalen Enzephalopathien genannt, aber auch Schilddrüsenüber- und unterfunktionen. Zudem können Elektrolytstörungen (insbesondere Hyponatriämien) kognitive Einschränkungen hervorrufen, genau wie ein lang anhaltender Mangel an v. a. B-Vitaminen. Deshalb empfehlen die aktuellen Leitlinien eine laborchemische Basisdiagnostik, d. h. eine Blutuntersuchung, die zumindest die folgenden Parameter beinhalten sollte: Blutbild, Elektrolyte (Na, K, Ca), Nüchtern-Blutzucker, TSH, Blutsenkung oder CRP, GOT, Gamma-GT, Kreatinin, Harnstoff, Vitamin B12.
Bei unklaren Syndromen, insbesondere bei jungem Erkrankungsalter oder untypischen Verläufen, sollten weitere Blutwerte bestimmt werden, die sich dann aber an den additiven Symptomen ausrichten.

Info
Auch andere Erkrankungen können eine primäre Demenz imitieren, z. B.:
• Schilddrüsenerkrankungen,
• Leber/Nierenerkrankungen,
• Infektionen,
• Medikamente,
• andere Gehirnerkrankungen (Schlaganfall, Gehirnentzündung, Gehirnwasserstau, Tumor, …),
• Vitaminmangel (v. a. Vitamin B1, B6 und B12),
• Elektrolytstörungen.

Abb. 2: Nicht-zerebrale Erkrankungen, die eine primär neurodegenerative Demenz imitieren können und ausgeschlossen werden sollten.
CT oder MRT des Kopfes
Die bildgebende Darstellung des Gehirns hat die neurologische Diagnostik in den letzten Jahrzehnten revolutioniert. Mit einer Magnetresonanztomografie ist es heute problemlos möglich, rasch ein mehrdimensionales Bild des Gehirns mit einer Auflösung von etwa einem Millimeter zu erhalten. Ziele der bildgebenden Diagnostik bei demenziellen Symptomen sind:
• der Ausschluss anderer, z. T. gut behandelbarer Erkrankungen,
• die ätiologische Zuordnung der primär neurodegenerativen Krankheit.
Abb. 3 zeigt beispielhaft CCT- bzw. cMRT-Bilder von Patienten, die sich mit dem V. a. einer Alzheimer-Demenz in unserer Abteilung vorgestellt haben.

Abb. 3: Von links nach rechts: Chronisches Subduralhämatom nach Sturz vor einigen Wochen (CCT), hirneigener Tumor, zerebrale Beteiligung einer Sarkoidose und Normaldruckhydrozephalus (jeweils MRT-Bildgebungen).
Alle Patienten ( Abb. 3) hatten wegen des Verdachts auf eine Alzheimer-Krankheit schon entsprechende Medikamente eingenommen, eine Bildgebung des Kopfes war noch nicht erfolgt. Da entzündliche oder traumatisch-strukturelle Erkrankungen z. T. sehr gut behandelbar sind, sollte bei jedem Patienten bei Erstdiagnose eine zerebrale Bildgebung erfolgen. Da die MRT mittlerweile fast überall verfügbar ist, ist sie der CCT vorzuziehen, v. a. wegen der deutlich besseren Auflösung und Sensitivität.
Abb. 3) hatten wegen des Verdachts auf eine Alzheimer-Krankheit schon entsprechende Medikamente eingenommen, eine Bildgebung des Kopfes war noch nicht erfolgt. Da entzündliche oder traumatisch-strukturelle Erkrankungen z. T. sehr gut behandelbar sind, sollte bei jedem Patienten bei Erstdiagnose eine zerebrale Bildgebung erfolgen. Da die MRT mittlerweile fast überall verfügbar ist, ist sie der CCT vorzuziehen, v. a. wegen der deutlich besseren Auflösung und Sensitivität.
Sowohl bei primär als auch bei sekundär neurodegenerativen Erkrankungen lässt die Bildgebung des Gehirns zudem einen Rückschluss auf die Ätiologie zu. Insbesondere die Lokalisation einer fokussierten Atrophie oder das Ausmaß einer vaskulären Schädigung des Gehirns sind einfach zu erfassen. Abbildung 4 zeigt Beispiele für die Beurteilung der Ätiologie von alltagsrelevanten Defiziten.

Abb. 4: Beide Abb. links: Typisches Bild einer Alzheimer-Krankheit. Es zeigt sich zwar eine generalisierte kortikale Atrophie, jedoch ist diese temporomesial betont. Dieser Bereich um den Hippokampus ist typischerweise bei der Alzheimer-Erkrankung überproportional betroffen (Pfeile). Eine hippokampale Atrophie ist in frühen Krankheitsstadien jedoch nicht immer deutlich sichtbar.
Mitte rechts: Es zeigt sich eine frontal betonte Atrophie. Passend zu den entsprechenden Symptomen finden sich Verhaltensauffälligkeiten und damit das typische Bild einer frontotemporalen Demenz.
Rechts: In den T2-gewichteten MRT-Bildern zeigt sich eine recht ausgeprägte zerebrale Mikroangiopathie, d. h. eine »chronische Durchblutungsstörung« durch eine Vaskulopathie v. a. kleiner und kleinster zerebrale Gefäße, passend zu einer vaskulären Demenz.
Objektivieren der kognitiven Defizite
»Bei jedem Patienten mit Demenz oder Demenzverdacht sollte bereits bei der Erstdiagnose eine Quantifizierung der kognitiven Leistungseinbuße erfolgen«, heißt es in der aktuellen S3-Leitlinie »Demenzen«10. Das ist sinnvoll, um ein Objektivieren der kognitiven Störungen zu ermöglichen, d. h. die Zuordnung eines bestimmten Punktwertes für z. B. Gedächtnisstörungen, Störungen des planerischen Handelns oder der Aufmerksamkeit und schlicht ein Verlassen des »ärztlichen Bauchgefühls« über Ausmaß und Schwere der kognitiven Symptome.
Im klinischen Alltag werden dazu oft zeitökonomische, aber validierte und etablierte Kurztests vorgenommen, z. B. MMST, DemTect, TFDD, MoCA und Uhrentest. Sie sind normiert und als Testverfahren geeignet, um das Vorhandensein und den ungefähren Schweregrad einer Demenz zu bestimmen.

Info
Beginnende Demenzsymptome sind mit solchen Kurztests nicht valide abzubilden. Zudem sind Kurztests nicht geeignet, um verschiedene Demenzen zu differenzieren. Hier wird eine ausführliche neuropsychologische Testung notwendig.
Führt die Minimaldiagnostik (Blutuntersuchungen, CT oder MRT des Kopfes und Objektivieren der kognitiven Defizite) nicht zu einer Klärung für die alltagsrelevanten Symptome, sollte eine weiterführende Diagnostik erfolgen. Hier liegt der Fokus v. a. auf der Differenzierung der primären und sekundären neurodegenerativen Gründe. Dazu zählen weitere laborchemische Untersuchungen von Blut und Liquor sowie eine erweiterte bildgebende Diagnostik (z. B. die Positronenemmissionstomografie).

Abb. 5: Diagnostischer Pfad bei Demenzsymptomen, nach der aktuellen S3-Leitlinie »Demenzen« (vgl. S3-Leitlinie »Demenzen«).*
* Vgl. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-013l_S3-Demenzen-2016-07.pdf
2.1.2 Altern und Demenz
Als häufigste Ursache der Demenz in Industrienationen wird die Alzheimer-Krankheit angenommen. Die Erkrankung ist durch eine charakteristische Ablagerung von Proteinen im Gehirn gekennzeichnet. Bis heute ist nicht ganz klar, ob die Proteinablagerungen (Amyloid- und Tau-Proteine) tatsächlich der toxische Auslöser der Erkrankung sind, oder ob die Ablagerungen zwar bei der Erkrankung schon früh entstehen, aber nicht primär auslösend sind.
Aus den aktuellen Studienergebnissen weiß man jedoch, dass ein Drittel der Menschen mit deutlichen Alzheimerablagerungen keine Gedächtnisstörungen haben – also die klassischen Symptome der Alzheimerdemenz –, obwohl eine sehr hohe zerebrale »Alzheimerlast« vorliegt. Dies zeigten z. B. autoptische Untersuchungen von 130 Nonnen im Alter von 75–102 Jahren, die in der berühmten »Nonnenstudie« in sehr hohem Alter neuropsychologisch getestet und nach ihrem Ableben neuropathologisch untersucht wurden.11 Selbst bei den Nonnen im neuropathologisch schwersten Stadium der Alzheimerkrankheit zeigten sich zu Lebzeiten kurz vor ihrem Tod bei etwa 8 Prozent keine Gedächtniseinschränkungen, also keine Symptome der Alzheimerkrankheit. Das ist bemerkenswert, weil die sichere Diagnose einer Alzheimer-Demenz auch heute noch nur neuropathologisch möglich ist. Zu Lebzeiten ist nur die wahrscheinliche Diagnose eine Alzheimerdemenz möglich, die sichere Diagnose beruht auf den beschriebenen neuropathologischen zerebralen Protein-Ablagerungen. D. h. dass, obwohl die sichere Diagnose eine Alzheimerdemenz neuropathologisch gestellt wurde, zu Lebzeiten keine Symptome der Erkrankung vorlagen.
Diese Befunde verdeutlichen, dass allein eine zerebrale Alzheimerpathologie nicht ausreicht, die Symptome der Erkrankung zu entwickeln. Bei den Nonnen, die in hohem Lebensalter die klassischen Alzheimersymptome zeigten, fanden sich jedoch im Vergleich zu den kognitiv gesunden Nonnen mit hoher Alzheimerlast v. a. zusätzliche vaskuläre Gehirnläsionen. In den meisten Fällen von Demenzen addieren sich mehrere pathophysiologische Veränderungen. Im Fall einer neurodegenerativen Vorschädigung kann beispielsweise ein zusätzlicher Hirninfarkt oder eine zusätzliche Alzheimerpathologie zu einer Dekompensation führen.
Abbildung 6 verdeutlicht das Prinzip der kognitiven Defizite im Alter: Das menschliche Gehirn ist plastisch, d. h. langsam entstehende Pathologien können lange sehr gut kompensiert werden. Besteht »nur« eine Alzheimerpathologie, ist die Kompensationsreserve noch ausreichend. Kommen im Laufe des Lebens weitere strukturelle Gehirnläsionen dazu, lassen sich die durch die strukturellen Defekte ausgelösten funktionellen Defizite nicht mehr kompensieren und es entstehen alltagsrelevante kognitive Störungen. In der Regel ist das in Industrienationen ein Zusammenkommen von Alzheimerpathologie plus zerebralen vaskulären Läsionen. D. h. aber auch, dass die monoätiologische Genese einer Demenzerkrankung im Alter unwahrscheinlich ist.
Bei der Diagnose und Therapie der Demenz sollten deshalb unterschiedliche Ursachen und mögliche kumulative, gehirnschädigende Effekte berücksichtigt werden. Wichtig ist dann, die führende klinische Pathologie zu benennen, um eine effektive Therapie einzuleiten. Besteht z. B. eine ausgeprägte Alzheimerlast, und kommen zudem auch vaskuläre Läsionen dazu, ist die Kompensationsreserve erreicht, und die klassischen Symptome der Alzheimererkrankung treten auf. Dann ist die Therapie der Alzheimererkrankung sicher die wichtigste und richtige Entscheidung.

Abb. 6: Demenz im Alter: Prinzip der Zunahme der strukturellen zerebralen Schädigungen und der Abnahme der vorhandenen Kompensationsreserven. Die häufigsten Gehirnläsionen im Alter in Industrienationen sind neben der Alzheimerpathologie die vaskulären Läsionen, Defekte durch Traumata und Synukleinopathien.

Info
Monoätiologische Gründe für eine Demenz im Alter sind selten. Auch diese Beispiele ( Abb. 6) zeigen, dass die Diagnose von Demenzen im Alter eine klinische ist. Die Diagnose und damit die nachfolgende Therapie fußen auf den führenden klinischen Symptomen; der klinische Blick ist wichtiger als das Laborchemie oder Bildgebung.
Abb. 6) zeigen, dass die Diagnose von Demenzen im Alter eine klinische ist. Die Diagnose und damit die nachfolgende Therapie fußen auf den führenden klinischen Symptomen; der klinische Blick ist wichtiger als das Laborchemie oder Bildgebung.
2.1.3 Demenzformen
Die genaue Klärung der Ätiologie der Demenzsymptome ist zum einen für die therapeutischen Interventionen und zum anderen auch für die prognostischen und damit sozialmedizinischen Entscheidungen essenziell. Unter den klassischen Demenzformen fasst man zunächst die primär neurodegenerativen Erkrankungen zusammen, jedoch werden in den aktuellen Leitlinien auch sekundär degenerative Erkrankungen wie z. B. die vaskuläre Demenz beschrieben. Abbildung 7 gibt einen Überblick über die häufigsten Ätiologien von Demenzen.

Abb. 7: Häufigkeit der Ätiologien von Demenzen in Industrienationen.
Die Alzheimerdemenz ist nach wie vor die häufigste Demenzerkrankung. Bei der Alzheimererkrankung besteht das Paradoxon, dass die Krankheit in der Regel zu spät erkannt wird, aber auch zu häufig diagnostiziert wird. Oft werden demenzielle Symptome mit der Alzheimerdemenz gleich gesetzt. Nach heutigem Wissen muss man jedoch sagen, dass die pathobiologisch »reine« Alzheimerdemenz wahrscheinlich eine Rarität ist und v. a. für die hereditären (also erblichen) Formen mit entsprechendem Gendefekt gilt.
Die zweithäufigste Demenzform in Industrienationen soll die vaskuläre Demenz sein, gefolgt von der Mischdemenz. Die Mischdemenz ist nach heutiger Definition eine Mischform aus Alzheimerpathologie plus vaskulärer Demenz. Mit diesen drei Demenzformen sind bereits etwa drei Viertel der Fälle beschrieben. Es folgen Demenzen bei primär neurodegenerativen Erkrankungen mit Bewegungsstörungen (Lewy-Körper(chen) Demenz, Parkinsondemenz, Kortikobasale Syndrome und die Progressive supranukleäre Blickparese) und Erkrankungen aus dem Formenkreis der Frontotemporalen Lobärdegenerationen. Die Angaben der Inzidenzen und Prävalenzen der letztgenannten Erkrankungen sind in den epidemiologischen Daten sehr variabel, d. h. diese Erkrankungen werden oft fehl- oder gar nicht diagnostiziert.
In der klinischen Untersuchung sollte der Fokus auf den Kernsymptomen der kognitiven Defizite liegen, um eine klinische Zuordnung zu der zugrunde liegenden Erkrankung der demenziellen Symptome zu ermöglichen und dann eine gezielte Diagnostik einzuleiten.

Info
Die Alzheimerdemenz zeigt auch in frühen Stadien ein klassisches kognitives Minderleistungsprofil, was sich von der vaskulären Demenz oder Demenzen bei Bewegungsstörungen klar differenziert.
Pragmatisch ist es im klinischen Alltag hilfreich, die neuropsychologischen Defizite zu dichotomisieren in:
1. Kortikale kognitive Defizite,
2. subkortikale kognitive Defizite.
Beispielhaft ist diese pragmatische neuropsychologische Darstellung an einer Werkbank dargestellt ( Abb. 8): Die Werkbank ist aufgeräumt, alles hat seinen Platz, aber es fehlt die Säge. Nun kommt die Aufgabe: »Bitte sägen Sie einen Holzbalken ab.« Der Patient ist aufmerksam, wach und motiviert, jedoch gelingt kein Sägeschnitt, weil das Werkzeug fehlt. Man könnte eine »Sägestörung« diagnostizieren, oder übertragen: eine kortikale kognitive Störung.
Abb. 8): Die Werkbank ist aufgeräumt, alles hat seinen Platz, aber es fehlt die Säge. Nun kommt die Aufgabe: »Bitte sägen Sie einen Holzbalken ab.« Der Patient ist aufmerksam, wach und motiviert, jedoch gelingt kein Sägeschnitt, weil das Werkzeug fehlt. Man könnte eine »Sägestörung« diagnostizieren, oder übertragen: eine kortikale kognitive Störung.
Übertragen in die Neuropsychologie wäre das z. B. der Fall, wenn nach einem Schlaganfall das kortikale Sprachzentrum (meistens links temporal lokalisiert) verloren wäre. Der Patient ist wach, aufmerksam und motiviert, jedoch gelingen die Sprachaufgaben nicht mehr. Es liegt eine Aphasie, also eine Sprachstörung vor. Dies wäre ein klassisches kortikales Defizit.
Bei subkortikal eingeschränkten Patienten ist dies anders. Übertragen auf das Beispiel Werkbank hieße dies: Die Werkbank ist unordentlich, überall liegt Werkzeug herum, es ist nicht aufgeräumt. Nun kommt erneut die Aufgabe: »Bitte sägen Sie einen Holzbalken ab.« Die Person sucht in dem Chaos herum, es dauert lange, aber sie findet die Säge nicht. Sie verlieren die Geduld und diagnostizieren eine »Sägestörung«. Dann jedoch wird – nach sehr langer Zeit – die Säge gefunden und ein exzellenter Sägeschnitt absolviert. Übertragen in den medizinischen Bereich hieße dies: Sie haben einen psychomotorisch langsamen, leicht ablenkbaren und unfokussierten Patienten. In den subkortikalen Gehirnarealen befinden sich v. a. die Faserbahnen zwischen den Neuronen, also die Verbindungen von Neuronen in den Kortexarealen. Der Kortex besteht aus den Neuronen, welche ein »Werkzeug« bilden (als Sprache, Gedächtnis oder Praxie). Bei subkortikalen Schäden gelingt somit der Zugriff auf die »Werkzeuge« nur noch erschwert oder verzögert.

Abb. 8: Eine vereinfachte, aber im klinischen Alltag hilfreiche Darstellung klassischer kognitiver Minderleistungsprofile: Kortikale kognitive Defizite sind »Werkzeugstörungen«, subkortikale Defizite erlauben einen Zugriff auf das Werkzeug, dieser dauert jedoch sehr lange (psychomotorisch langsame, ablenkbare, umständliche Patienten).
Beispiel Subkortikale kognitive Störungen in der Untersuchung
Sie untersuchen die Kognition eines Patienten und überprüfen die zeitliche Orientierung. Sie fragen nach dem Datum. Der Patient wirkt unaufmerksam und ablenkbar, murmelt zunächst langsam den Monat, dann das korrekte Jahr. Sie warten lange, dann geht die Tür auf, ein Kollege guckt kurz herein. Der Patient schaut sich ebenfalls um, hat danach die Frage vergessen. Sie wiederholen die Frage. Der Patient wiederholt langsam den Monat und das Jahr, dann versucht er, anhand von kognitiven Brücken den Tag herzuleiten (»Letzens hatte meine Enkelin Geburtstag, nein, doch nicht, dann war da noch … mhh«). Sie warten nicht mehr und diagnostizieren eine zeitliche Orientierungsstörung. Danach sagte Ihnen der Patient jedoch das richtige Datum, mit passendem Wochentag und korrekter Uhrzeit. Nachweisbar bei dem Patienten war laborchemisch eine Alzheimerpathologie, zudem jedoch eine ausgeprägte zerebrale Mikroangiopathie. Sie diagnostizieren nun korrekterweise eine Mischdemenz, aktuell mit führenden subkortikalen Symptomen durch die vaskulären Läsionen.

Info
Demenzerkrankungen mit vornehmlich subkortikalen Defiziten sind mit den üblichen Demenz-Kurztests oder deren Kombination (z. B. dem CERAD) nicht gut zu erfassen. Trotz erheblicher alltagsrelevanter Defizite mit demenzieller Ausprägung bleiben Patienten mit subkortikalen Defiziten z. B. in dem weit verbreiteten, jedoch mono-ätiologisch an der Alzheimer-Demenz ausgerichteten Mini-Mental-Status-Test (MMST) unauffällig. Zumeist kann in solchen Fällen auf eine ausführlichere neuropsychologische Testung nicht verzichtet werden. Tabelle 2 gibt einen Überblick über gängige Kurztests und deren Untersuchungsschwerpunkt.
Tab. 2: Welcher Test ist in der Praxis sinnvoll?
| Test | Getestete Domänen | Benötigte Zeit | Welche Demenzformen abgebildet werden |
| MMST | Gedächtnis, Orientierung, Sprache, Visuokonstruktion | 10–15 Minuten | AD im mittleren und fortgeschrittenen Stadium |
| Uhrentest | Visuokonstruktion, Sprache, Gedächtnis, Exekutivfunktionen | 5 Minuten | Unspezifisch, aber sehr sensitiv |
| DemTect | V. a. verschiedene Gedächtnisformen | 8–10 Minuten | MCI, beginnende AD, VD, FTD |
| TEDD | Gedächtnis, Visuokonstruktion, Sprache, Affektive Störungen | 5–10 Minuten | AD, DD zur Pseudodemenz |
| MoCa | Aufmerksamkeit, Exekutivfunktion, konzeptuelles Denken | 10 Minuten | Vaskuläre Demenz, MCI, frühe AD |
| PANDA | Exekutivfunktion, Gedächtnis, Visuokonstruktion | 8–10 Minuten | PD, LKD |
| SKT | Gedächtnis, Aufmerksamkeit | 10–15 Minuten | Frühe AD, MCI, Pat. mit wenig Akzeptanz |
| ACE | MMSE plus subkortikale Symptome | 20 Minuten | AD, FTD, VD |
Alzheimerdemenz
Die Demenz vom Typ Alzheimer (DAT) ist mit etwa 60 Prozent die weltweit häufigste Form der primär neurodegenerativen Erkrankungen mit demenziellen Symptomen und zugleich die klassische Form einer kortikalen Demenz oder (s. o.) einer Demenz mit v. a. »Werkzeugstörungen«, die schon in den frühen Phasen der Erkrankung vorhanden und so von anderen Demenzerkrankungen abgrenzbar sind.
Typisch sind neben den grundsätzlich vorhandenen und zunehmenden anterogradmnestischen Defiziten (Neugedächtnisstörungen) zudem Störungen der Praxie (Koordination der Bewegungen, v. a. der Arme) und eine Störung der räumlichen Orientierung und der Visuokonstruktion ( Abb. 9). Im Gegensatz dazu zeigen sich bei den subkortikalen Demenzen (wie z. B. der vaskulären Demenz durch Mikroangiopathie) v. a. Defizite in den Exekutivfunktionen, im planerischen Handeln oder in der geteilten Aufmerksamkeit, wohingegen die Gedächtnisleistung zunächst unbeeinträchtigt bleibt.
Abb. 9). Im Gegensatz dazu zeigen sich bei den subkortikalen Demenzen (wie z. B. der vaskulären Demenz durch Mikroangiopathie) v. a. Defizite in den Exekutivfunktionen, im planerischen Handeln oder in der geteilten Aufmerksamkeit, wohingegen die Gedächtnisleistung zunächst unbeeinträchtigt bleibt.

Info
Eine Demenz vom Typ Alzheimer ist die klassische Form einer kortikalen Demenz. Die Symptome sind schon früh im Krankheitsverlauf vorhanden. Man sollte in der Untersuchung sowohl in der Eigen- als auch Fremdanamnese und den neuropsychologischen Untersuchungen bei der DAT einen Fokus auf diese kognitiven Domänen haben!

Abb. 9: Visuelle Darstellung der klassischen Symptome einer Demenz von Typ Alzheimer.*
* Apraxiebilder: vgl. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-47813-4_10
Die Alzheimerkrankheit wurde nach Alois Alzheimer12 benannt, der sie im Jahr 1906 erstmals beschrieb, nachdem er im Gehirn einer verstorbenen Patientin charakteristische Veränderungen festgestellt hatte. Über 90 Prozent der DAT-Fälle treten sporadisch auf. Selten finden sich autosomal-dominante Vererbungen von Mutationen im Amyloid-Prekurser-Protein (APP) oder Mutationen des Präsenilin-Gens (PSEN 1 und PSEN 2).
Die genaue Ätiologie der Alzheimererkrankung ist weiterhin unbekannt, jedoch zeigen sich neben den charakteristischen klinischen Merkmalen typische neuropathologische und neurochemische Eigenschaften. Zum einen finden sich intrazelluläre Einschlüsse von phosphorylierten Tau-Proteinen, den sogenannten Neurofibrillen (A), zum anderen bilden sich »senile Plaques« (B). Hierunter versteht man die extrazelluläre Akkumulation von β-Amyloid-Peptiden. Ob der Untergang von Neuronen eine Konsequenz der übermäßigen β-Amyloid-Produktion ist oder ob β-Amyloid als Antioxidans gegen z. B. neu entstandenen oxidativen Stress übermäßig produziert wird, ist bis heute ungeklärt.13

Abb. 10: Histopathologische Veränderungen bei der Alzheimerdemenz: Nachweis von intrazelluläre Einschlüsse von phosphorylierten Tau-Proteinen, so genannten Neurofibrillen (A), und extrazelluläre Ablagerungen von Amyloid-Proteinen, sog. »senile Plaques« (B).
Modifiziert nach: Christopher JF et al. (2005): Nature Reviews Neuroscience 2005; 6, 449–462; Mark PM (2000): Nature Reviews Molecular Cell Biology 2000; 1, 120–130; Blennow K et al. (2006): Alzheimer’s disease. Lancet. 2006; 368(9533): 387–403.
Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer DAT ist das Lebensalter. In der Population der 75–79-Jährigen finden sich etwa 12 Prozent mit alltagsrelevanten demenziellen Symptomen. In der Gruppe der > 90-Jährigen ist bereits mindestens jeder zweite manifest erkrankt, jedoch sind nur etwa 2 Prozent der Alzheimerpatienten < 65 Jahre. Etwa 25 Prozent der Menschen um das 85. Lebensjahr leiden an einer Demenz. Die Inzidenz der DAT blieb dabei in den letzten Jahrzehnten stabil. Als Faustregel kann gesagt werden, dass mit der heutigen Lebenserwartung etwa jeder Dritte an einer manifesten Demenz erkranken wird ( Abb. 11).
Abb. 11).

Abb. 11: Wahrscheinlichkeit, mit der durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland an einer Demenz zu erkranken, vornehmlich an einer DAT.*
* Vgl. destatis (2019): Ergebnisse der Todesursachenstatistik für Deutschland. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/Publikationen/ Downloads-Todesursachen/todesursachenstatistik-5232101197015.html;Stat. Bundesamt; wegweiser-demenz.de 2012
Die Diagnose einer Demenz vom Typ Alzheimer ist nach wie vor eine klinische, jedoch hat sich die Bestimmung von »Biomarkern« der Erkrankung inzwischen etabliert. Die Alzheimerdemenz galt bis vor einigen Jahren noch als Ausschlussdiagnose, bestätigt oder verworfen werden konnte die klinische Verdachtsdiagnose erst post mortem, nach dem neuropathologischen Nachweis der genannten Plaques oder intrazellulären Ablagerungen. Da autoptische Befunde für den Patienten aber zu spät kommen, wurden die Diagnosekriterien einer wahrscheinlichen Alzheimerdemenz weiterentwickelt und angeglichen, auch wegen neuer diagnostischer Verfahren und Methoden.
In die Kriterien der NIA-AA (National Institut on Aging and The Alzheimer’s Association: Clinical Perspectives on Alzheimer’s Disease; American Academy of Neurology) aus 2011 werden neben den klassischen klinischen Symptomen und dem Ausschluss anderer Erkrankungen auch die Alzheimer-Biomarker einbezogen ( Tab. 1).14 Neben dem Nachweis einer spezifischen Neurodegeneration wurde auch ein Nachweis einer Amyloidpathologie notwendig. Der Amyloidnachweis gelingt aktuell in der Liquordiagnostik oder mittels einer aufwändigen bildgebenden Untersuchung (Amyloid-Positronenemmissionstomografie). Der Nachweis einer Neurodegeneration gelingt mit einem spezifischen Atrophiemuster im MRT (temporomesial lokalisierte Hirnatrophie), mit einem Tau-Proteinnachweis in der Liquordiagnostik oder mit einer spezifischen Minderverstoffwechselung von Glukose in der Positronenemmissionstomografie (parietal betont). Damit entstand der Wechsel von einer Ausschluss- zu einer Biomarker-basierten Diagnose einer DAT.
Tab. 1).14 Neben dem Nachweis einer spezifischen Neurodegeneration wurde auch ein Nachweis einer Amyloidpathologie notwendig. Der Amyloidnachweis gelingt aktuell in der Liquordiagnostik oder mittels einer aufwändigen bildgebenden Untersuchung (Amyloid-Positronenemmissionstomografie). Der Nachweis einer Neurodegeneration gelingt mit einem spezifischen Atrophiemuster im MRT (temporomesial lokalisierte Hirnatrophie), mit einem Tau-Proteinnachweis in der Liquordiagnostik oder mit einer spezifischen Minderverstoffwechselung von Glukose in der Positronenemmissionstomografie (parietal betont). Damit entstand der Wechsel von einer Ausschluss- zu einer Biomarker-basierten Diagnose einer DAT.

Abb. 12: Anteil der Biomarker an der Wahrscheinlichkeit der Diagnose einer Demenz vom Typ Alzheimer nach den NIA-AA-Kriterien.
Bei den nachfolgenden Kriterien der IWG (International Working Group) entfiel der Begriff der Alzheimerdemenz und wurde ersetzt durch den Begriff der Alzheimererkrankung.15 Die etablierten Alzheimerbiomarker waren weiterhin Teil der Diagnosekriterien. Inzwischen hatte man erkannt, dass die Alzheimerkrankheit schon lange vor dem Bestehen alltagsrelevanter kognitiver Defizite vorhanden ist.
Der Übergang von den präklinischen Stufen oder den leichten kognitiven Beeinträchtigungen in eine Alzheimerdemenz sind fließend, weshalb man nun von einer Alzheimererkrankung »mit« oder »ohne Alltagsrelevanz« der kognitiven Defizite sprach. Tatsächlich ist inzwischen klar, dass die Biomarker der Alzheimerdemenz schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte vor dem Auftreten alltagsrelevanter kognitiver Defizite nachweisbar waren. Erst bei Erreichen der Kompensationsreserve des Gehirns kommt es zu alltagsrelevanten Einschränkungen. Dann sind jedoch bereits etwa 80 Prozent der hippokampalen Neurone degeneriert ( Abb. 12).
Abb. 12).
Wichtig Zusammengefasste IWG-Kriterien der Alzheimerkrankheit
• Begriff der Demenz entfällt,
• Einteilung in typische und atypische Alzheimerkrankheit.
Typische (Alzheimerkrankheit):
• episodische Gedächtnisstörung, dokumentiert durch Defizite in einem Test zur Hippokampusfunktion, mind. 6 Monate fortschreitend
plus
• Hinweise auf Alzheimerpathologie in Biomarkern (oder Genetik),
• Ausschluss anderen Ursachen.
Insbesondere mit Blick auf zukünftige krankheitsmodifizierende Therapiestrategien erscheint es heute sehr sinnvoll, die frühe Diagnose einer Alzheimerpathologie stellen zu können, auch wenn noch keine alltagsrelevanten Defizite vorhanden sind. Neueste therapeutische Strategien behandeln schon vor Auftreten solcher klinischen Symptome.
Die neuesten Kriterien der NIA-AA aus 2018 werden noch als »Forschungsrahmen« bezeichnet. Es wird jedoch angenommen, dass die Einteilung der Alzheimerkrankheit als Kontinuum in den klinischen Alltag Einzug erhält und die Patienten mit den klassischen Alzheimer-Biomarkern und (noch) ohne Symptome als »präklinische Alzheimerkranke« eingestuft werden. Deshalb basieren diese Kriterien zunächst nur auf den Biomarkern ( Abb. 13):
Abb. 13):
1. Amyloid (A),
2. Phosphoryliertes-Tauprotein (T) und
3. Neurodegeneration (N).

Abb. 13: Verlauf der Alzheimererkrankung und Einsetzen alltagsrelevanter kognitiver Einschränkungen. Differenzierung zwischen Alzheimererkrankung und -demenz.
Wichtig ist also: Man unterscheidet wieder nach Amyloid und Neurodegeneration, jedoch nun auch nach einer Alzheimerspezifischen (T) und generalisierten (N) Neurodegeneration. Sind diese Biomarker vorhanden, ist die Krankheit vorhanden. Die klinischen Symptome entscheiden dann nur noch über das Stadion oder die Stufe der Erkrankung.
Ein Vorteil der Sichtweise eines Alzheimerkontinuums wäre, dass schon sehr früh medikamentöse Therapien eingesetzt werden könnten, und nicht auf das Auftreten von klinischen Symptomen gewartet werden muss, insbesondere um ein Fortschreiten der Degeneration rasch, effektiv und früh aufzuhalten. Hierzu werden aktuell Studien mit v. a. Immuntherapien gegen die Amyloidpathologie durchgeführt.
Eine Übersicht über die aktuell zugelassenen medikamentösen Therapien bei der Alzheimerdemenz findet sich in Abbildung 14.

Info
Patienten mit einer Alzheimerdemenz haben in den frühen Krankheitsphasen keine Anosognosie für ihre Defizite, d. h. sie erkennen und bemerken diese sehr wohl. Auch ein Bagatellisieren oder ein fassadäres Verhalten, um die Symptome zu verdecken, sind nicht typisch in frühen Stadien der Erkrankung!
Vielmehr werden die Defizite zwar bemerkt, oft aber als »normales Altern« abgetan.
Beispiel Sprachstörungen oder mehr?
Ein Patient berichtet über Sprachstörungen. In der Untersuchung fällt Ihnen auf, dass er häufig Sätze beginnt, dann aber den Faden verliert. Benennstörungen sind nicht vorhanden, zudem unauffällige Objekterkennung. Beim Nachsprechen mehrsilbiger Wörter vergisst er fast immer die letzte Silbe. Beim Uhrentest offenbaren sich deutlich visuokonstruktive Defizite, zudem bestehen Defizite beim Nachmachen von Gesten mit den Händen. Sie diagnostizieren keine Aphasie, sondern stellen die Verdachtsdiagnose einer beginnenden Alzheimerdemenz mit den typischen kortikalen Symptomen einer verbalen Merkfähigkeitsstörung, Störungen der Gliedmaßenpraxie und visuokonstruktiven Defiziten.
Sie veranlassen ein MRT des Kopfes und eine Liquordiagnostik. In der MRT werden andere Ursachen ausgeschlossen, es gelingt der Nachweis einer Amyloid- und Tau-Proteinpathologie. Unter der wahrscheinlichen Diagnose einer Alzheimerdemenz wird eine medikamentöse Therapie eingeleitet und der Patient darüber aufgeklärt, dass das Therapieziel eine Verzögerung des Voranschreitens der kognitiven Defizite ist.
Vaskuläre Demenz
Die vaskuläre Demenz ist die zweithäufigste Demenzform nach der Alzheimerdemenz und macht etwa 30 Prozent der Demenzfälle aus. Zugrunde liegen der vaskulären Demenz alle zerebrovaskulär bedingten Schädigungen, die zu alltagsrelevanten neurokognitiven Schädigungen führen.
Das sind neben seltenen genetischen Erkrankungen (CADASIL, MELAS) im Wesentlichen mikroangiopathische Läsionen und Makroinfarkte. Damit besteht eine unscharfe ätiologische Zuordnung. Auch fehlen im Gegensatz zur Alzheimerdemenz neuropathologische Kriterien. Somit ist die vaskuläre Demenz eine klinische Diagnose, jedoch existieren insgesamt vier gebräuchliche, unabhängige Diagnosekriterien (DSM-IV, ADDTC, NINDS-AIREN, ICD-10). Die etabliertesten Diagnosekriterien sind die NINDS-AIREN Kriterien. Im klinischen Alltag sind diese Kriterien jedoch aufgrund ihrer Fülle von Parametern und Verknüpfungen schwierig zu nutzen.16
Tab. 3: NINDS-AIREN-Kriterien der vaskulären Demenz

Vereinfacht muss eine Verknüpfung zwischen der kognitiven Funktionsverschlechterung und einer relevanten zerebrovaskulären Erkrankung bestehen, insbesondere ein zeitlicher Zusammenhang. Zudem zeigen sich im Vergleich zur Alzheimerdemenz häufiger fokal-neurologische Defizite und »fleckförmig« ausgestanzte neuropsychologische Defizite, die abhängig von der Lokalisation der Defekte sind ( Tab. 3). Die häufige mikroangiopathisch bedingte vaskuläre Demenz geht typischerweise einher mit früh auftretenden Gangstörungen, Blasenstörungen und subkortikalen kognitiven Defiziten bei erhaltener Gedächtnisleistung.
Tab. 3). Die häufige mikroangiopathisch bedingte vaskuläre Demenz geht typischerweise einher mit früh auftretenden Gangstörungen, Blasenstörungen und subkortikalen kognitiven Defiziten bei erhaltener Gedächtnisleistung.
Die Ätiologie der vaskulären Läsionen bei der vaskulären Demenz ist bunt.17 Sie wird zum einen verursacht durch makroangiopathische Läsionen, z. B. Territorialinfarkte (sogenannte »Post-stroke-Demenz«) oder multiple, strategische Infarkte (Multiinfarktdemenz). Besonders vulnerabel sind der Thalamus und Basalganglien, Gyrus angularis sowie der cholinerge Nucleus basalis Meynert (mediofrontal). Zum anderen sind jedoch mikroangiopathische Läsionen (chronische subkortikale Ischämien) der häufigste Grund für eine vaskuläre Demenz (früher Morbus Binswanger oder SAE = subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie, heute als Begriffe obsolet).
Entsprechend den vielen zugrundeliegenden Ätiologien und deren Lokalisation sind die klinischen Symptome bunt gemischt. Makroangiopathischen Läsionen ist gemein, dass sie zumeist eine prompte Verschlechterung zeigen und zusätzliche fokal-neurologische Symptome, abhängig von der Lokalisation. Die klassische vaskuläre Demenz mit subkortikalen mikrovaskulären Schädigungen entsteht schleichend. Klassisch sind subkortikale Symptome mit exekutiven Funktionsstörungen, Defiziten der Aufmerksamkeit und Handlungsplanung, Antriebsschwäche, Wesensund Verhaltensstörungen. Kortikale Symptome wie mnestische Defizite, eine Aphasie oder Apraxie finden sich nicht. Häufig findet sich begleitend eine Gangstörung (sogenannte »Lower-Body-Parkinsonism« oder ein vaskuläres Parkinsonsyndrom).

Info
Zwar finden sich in vielen zerebralen MRT älterer Patienten mikroangiopathische Läsionen, jedoch erklären diese nicht die kortikalen neuropsychologischen Symptome der Patienten! Aufgrund der steigenden Nutzung der MRT-Bildgebung finden sich mikroangiopathische Läsionen bei > 80 Prozent der Patienten, die älter als 65 Jahre sind. Meist sind sie ohne Krankheitswert, können jedoch bei hoher Läsionslast zu subkortikalen kognitiven Defiziten führen.
Dennoch sollte die Läsionslast im MRT nicht dazu verleiten, eine vaskuläre Demenz zu diagnostizieren. Hier ist eine weiterführende Diagnostik notwendig, und insbesondere passende klinische (also subkortikale kognitive) Symptome ( Abb. 15).
Abb. 15).

Abb. 15: Die in den MRT-Bildern gezeigten vaskulären zerebralen Läsionen sind bei älteren Patienten häufig und verleiten zur Diagnose einer vaskulären Demenz. Alle Patienten, deren MRT hier abgebildet werden, hatten normale kognitive Leistungen.
Zusammenfassend ist die vaskuläre Demenz ein unscharf definierter Begriff, dem viele Ätiologien zugrunde liegen können. DGN-Definition: Defektsyndrom nach größeren, einzelnen oder multiplen, ischämischen oder hämorrhagischen Insulten18.

Info
Die häufigste Ätiologie ist wahrscheinlich eine zerebrale Mikroangiopathie. Auch hierbei bestehen meistens subkortikale Defizite (zumeist ein dysexekutives Syndrom, mit umständlichen, unfokussierten und ablenkbaren Patienten mit v. a. Aufmerksamkeitsstörungen), weniger kortikale Symptome (z. B. Aphasie, Apraxie oder mnestische Defizite).
An Bewegungsstörungen findet sich bei einigen Patienten ein sogenannter »LowerBody Parkinsonism«, d. h. v. a. ein kleinschrittiger, schlurfender Gang, also eine Hypokinesie isoliert der Beine, nicht der Arme.
Gemischte Demenz
Die gemischte Demenz wird als das gleichzeitige Vorliegen einer Alzheimerdemenz und einer vaskulären Demenz betrachtet. Detaillierte Kriterien für die Diagnose »gemischte Demenz« existieren nicht.

Info
In post mortem-Studien konnte gezeigt werden, dass die gemischte Demenz keine seltene Erkrankung ist, sondern eher unterdiagnostiziert.
Inzwischen wird von vielen Autoren behauptet, dass die gemischte Demenz im Alter die Regel ist und die mit Abstand häufigste Demenzform darstellt.19 Tatsächlich fand sich in 40–50 Prozent der verstorbenen Patienten mit Alzheimerdemenz eine relevante vaskuläre zerebrale Schädigung. Auf der anderen Seite zeigten Patienten mit vaskulärer Demenz zu 34 Prozent klassische Alzheimerpathologien. Wie bereits oben beschrieben muss also davon ausgegangen werden, dass eine reine Alzheimerpathologie oder eine reine vaskuläre Demenz bei älteren Patienten eine Ausnahme und nicht die Regel ist.
Zudem gibt es Hinweise auf gemeinsame ätiologische und pathomechanistische Zusammenhänge. Beispielsweise sind die Risikofaktoren beider Erkrankungen sehr ähnlich. In Studien konnte gezeigt werden, dass eine vaskuläre Gehirnschädigung zu einer Akkumulation der Amyloid- Proteine führt (verminderte »Amyloid-Clearance«) und umgekehrt die Amyloid-Proteine zu einer Vaskulopathie führen, die wiederum das Gehirn schädigen.20 Es gibt also ein Zusammenhang zwischen vaskulären und Amyloid-toxischen Schädigungen des Gehirns. In weiteren Studien wie z. B. der o. g. »Nonnenstudie« konnte gezeigt werden, dass eine alleinige zerebrale Alzheimerpathologie offenbar zu Lebzeiten nicht immer zu einer Demenz führt. Erst wenn weitere Gehirnläsionen anderer Ätiologie – in den meisten Fällen vaskuläre Läsionen – hinzukommt, dekompensiert die funktionelle Reserve. Es entstehen die klinischen Symptome einer Demenz.
In mehreren Plazebo-kontrollierten Studien konnte wahrscheinlich deshalb eine Wirksamkeit der Alzheimermedikamente (Cholinesterasehemmer und auch Memantin) in der Behandlung der gemischten Demenz nachgewiesen werden.21 Die Evidenzgrade sind zwar geringer, aufgrund der gleichzeitig vorliegenden Alzheimerpathologie ist es jedoch gerechtfertigt, die gemischte Demenz entsprechend der Alzheimerdemenz zu behandelt. Entsprechend bestehen die Zulassungen analog zur Alzheimerdemenz22 ( Abb. 14).
Abb. 14).
Lewy-Körper(chen) Demenz
Die Lewy-Körper(chen)-Demenz (LKD) ist eine primär neurodegenerative Erkrankung, die nach den eosinophilen Einschlüssen im Zytoplasma von Neuronen benannt ist (sogenannte »Lewy-Körperchen«; eine α-Synukleopathie). Da diese neuropathologischen Veränderungen auch bei Morbus Parkinson typischerweise vorkommen, wurde die LKD von einigen Autoren lange als »Unterform« des M. Parkinson angesehen. Inzwischen und in den aktuellen Leitlinien ist das nicht mehr so, weil sich insbesondere die Prognose und auch das therapeutische Vorgehen unterscheiden.23

Mit klinisch pragmatischem Blick gilt die »Ein-Jahres«-Regel, d. h. das Auftreten eines Parkinsonsyndroms plus weiterer Symptome innerhalb eines Jahres = LKD.
Hierbei ist nicht wichtig, welche Symptome zuerst vorhanden sind. Neben dem Parkinsonsyndrom sind folgende klinische Symptome typisch:
• Progredientes demenzielles Syndrom,
• v. a. visuelle Halluzinationen, meist szenisch-detailreich,
• starke Schwankungen der Symptome (»Tagesform« der Patienten, v. a. Fluktuation kognitiver Defizite),
• »Neuroleptikasensitivität«: verstärkte Reaktion auf typische Neuroleptika, insbesondere Sedierung/Vigilanzminderung,
• wenig/kein Ansprechen auf L-Dopa in üblichen Dosen (200–300 mg),
• REM-Schlaf-Verhaltensstörungen.
Neben der Alzheimerdemenz und den vaskulären- sowie Mischdemenzen gilt die LKD als eine der häufigsten und häufig übersehene primäre Demenzform, weshalb ein Kennen der klinischen Symptome wichtig erscheint.

Info
Patienten mit einer Lewy-Körper(chen) Demenz begegnen Ihnen klinisch als subkortikal kognitiv eingeschränkte Patienten mit einem Parkinsonsyndrom. In der Anamnese werden v. a. Dingen szenische, visuelle Halluzinationen berichtet und eine starke Fluktuation der kognitiven Einschränkungen (fremdanamnestische »Tagesformabhängigkeit«).
Zudem berichten die Patienten und v. a. die Bettnachbarn über lebhafte Alpträume. Die Patienten schreien und boxen nachts (sogenannte »REM-Schlaf-Verhaltensstörungen«).
Zusammenfassend kann als klinische Faustregel gelten, dass bei Demenzen mit Bewegungsstörungen überwiegend subkortikale kognitive Defizite dominieren. Die Demenz vom Typ Alzheimer ist die klassische Form einer kortikalen Demenz. Typisch sind neben den zunehmenden mnestischen Defiziten (Neugedächtnisstörungen) zudem Störungen der Bewegungskoordination (sogenannte Dys- oder Apraxie) und eine Aphasie mit v. a. semantischen Defiziten, die sich schon früh manifestieren. Auch Störungen der räumlichen Orientierung und der Visuokonstruktion finden sich früh im Verlauf.
Im Gegensatz dazu zeigen sich bei den subkortikalen Demenzen v. a. Defizite in den Exekutivfunktionen, im planerischen Handeln oder in der Aufmerksamkeit, wohingegen die Gedächtnisleistung zunächst wenig beeinträchtigt bleibt. Dies betrifft fast alle primär neurodegenerativen Erkrankungen, die früh mit Bewegungsstörungen einhergehen, wie z. B.
• Lewy-Körper Demenz,
• Idiopathisches Parkinsonsyndrom (im späteren Verlauf),
• Chorea Huntington,
• Normaldruckhydrozephalus,
• auch die häufigste Form der vaskulären Demenz mit mikroangiopathischen zerebralen Läsionen,
• Kortikobasale Degeneration,
• Progressive supranukleäre Blickparese (Steele-Richardson-Olzewski-Syndrom),
• Multisystematrophie (spät im Verlauf).
Frontotemporale Demenzen
Die frontotemporale Demenz (FTD) ist eine primär neurodegenerative Erkrankung, die in erster Linie den frontalen und temporalen Kortex betrifft. Neuropathologisch finden sich charakteristische Einschlusskörper (sogenannte »Pick-Körper«) im den Neuronen des Lobus frontalis und temporalis. Im Gegensatz zur Alzheimerdemenz sind die Leitsymptome der FTD deshalb nicht das mnestische Defizit (Gedächtnisstörungen), sondern Veränderungen der Persönlichkeit, des Sozialverhaltens mit Enthemmungsphänomenen (Hyperoralität mit Essattacken, Witzelsucht, Hypersexualität) und der sprachlichen Fähigkeiten.

Info
Patienten mit FTD sind bei Erkrankungsbeginn jünger als Alzheimerpatienten (im Durchschnitt 58 Jahre), zudem finden sich bei der FTD häufiger hereditäre, also erbliche Fälle (um 15 Prozent). Bei Patienten < 65 Jahre ist die FTD die zweithäufigste Demenzerkrankung nach der präsenilen Alzheimerdemenz.
Unter der Bezeichnung »Frontotemporale Lobärdegeneration« (FTLD) werden drei Varianten unterschieden, deren Gemeinsamkeit der makroskopische neuropathologische Befund ist: Eine recht scharfe Begrenzung der Atrophie von frontalem und/ oder temporalem Kortex ( Abb. 16).
Abb. 16).
Neben der klassischen frontotemporalen Demenz (oder auch behaviorale oder Verhaltensvariante der FTD), bei der die Wesensveränderungen im Vordergrund stehen, unterscheidet man eine Variante mit zunächst nicht-flüssiger Aphasie (sogenannte primär progredienter Aphasie) und eine Variante mit v. a. semantischer Aphasie (sogenannte semantische Demenz). Klinisch lassen sich die Verlaufsformen oft nur zu Beginn scharf abgrenzen, zudem gehen die Prägnanztypen mit zunehmender Progression der Erkrankung ineinander über.
Inzwischen gilt eine Verbindung zwischen der FTD und Motoneuronerkrankungen als etabliert, obwohl deren gemeinsame Pathomechanismen bisher noch nicht verstanden sind. Einige Autoren sprechen vom »ALS-Demenz-Komplex« und berichten von 15–30 Prozent der ALS-Patienten, welche im Verlauf zudem die Kriterien einer FTD erfüllen.

Abb. 16: Subtypen der Frontotemporalen Lobärdegenerationen und deren klinisches Erscheinungsbild.
© LP: https://www.dr-gumpert.de/html/liquordiagnostik.html
Amyloid-PET: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hbm.24782

Abb. 17: Links ein T2-gewichtetes MRT eines Patienten mit frontal-kortikaler Atrophie bei einer Verhaltensvariante der FTLD. Rechts das MRT Bild (T1-gewichtet) eines Patienten mit einer Sprachvariante der FTLD (sog. Primär progredienter Aphasie) mit fokussierter Atrophie links temporal (Pfeil).

Info
1. Jüngere (< 60 Jahre) Patienten mit kognitiven Einschränkungen, bei denen Defizite im planerischen Handeln oder der Aufmerksamkeit dominieren (frontale kortikale Leistungen oder auch Störungen der »Exekutivfunktionen«), zusammen mit sozial unangepasstem Verhalten und fehlender Empathie sowie Veränderungen des Essverhaltens lassen an eine Verhaltensvariante der Frontotemporalen Lobärdegeneration oder eine klassische Frontotemporale Demenz denken.
2. Jüngere (< 60 Jahre) Patienten mit Sprachstörungen, die v. a. die Bedeutung von Wörtern betrifft (Semantik), lassen an eine semantische Demenz als Subform der Frontotemporalen Lobärdegenerationen denken. Hierbei sind v. a. das Benennen von Gegenständen oder die Objekterkennung defizitär. Die Sprache der Patienten ist flüssig, jedoch inhaltsarm, weil viele Begriffe umständlich umschrieben werden. Deshalb nennt man diese Subform auch flüssige oder semantische primär progrediente Aphasie.
3. Jüngere (< 60 Jahre) Patienten mit Sprachstörungen, die v. a. die Grammatik betreffen, zudem auch das Aussprechen der Wörter (wegen einer bukkofazialen oder Sprechapraxie), lassen an eine nicht-flüssige primär progrediente Aphasie als Subform der Frontotemporalen Lobärdegenerationen denken. Die Patienten sprechen stockend, insbesondere Zischlaute werden falsch gesetzt und machen grammatikalische Fehler, aber das Benennen oder die Bedeutung von begriffen ist ungestört.
2.2 Das Delir
Die wörtliche Übersetzung des Begriffs »Delir« aus dem Lateinischen bedeutet »aus der Furche geraten« oder »von der geraden Linie abweichend«. Letztendlich ist diese blumige Umschreibung recht passend, denn ein Delir meint in der Sprache der heutigen Zeit eine akute Verwirrtheit. Dieser Begriff ist recht unspezifisch, was dazu führte, dass man viele medizinische Begriffe verwendet hat und auch heute noch verwendet, die zudem z. T. noch synonym genutzt werden. Abbildung 18 gibt einen Überblick über Termini, die allesamt eine akute Verwirrtheit meinen.
Wichtig Ein Delir richtig benennen
Wichtig ist, dass man das Delir heute einheitlich als solches bezeichnet. Begriffe wie «hirnorganisches Psychosyndrom« (HOPS) oder auch «Durchgangssyndrom« sind letztendlich obsolet und suggerieren zudem einen falschen pathophysiologischen Zusammenhang oder auch eine nicht richtige Prognose.
Beispielsweise suggeriert der Begriff »Durchgangssyndrom«, dass der Zustand der akuten Verwirrtheit schicksalhaft aufritt (z. B. nach operativen Eingriffen) und nur vorübergehend ist, ohne Nachteile zu verursachen. Heute weiß man, dass dies nicht der Fall ist.24

Abb. 18: Viele Begriffe meinen das Gleiche: Eine akute Verwirrtheit oder ein Delir. Die blass dargestellten Begriffe sind obsolet, es sollte der einheitliche Begriff des Delirs Verwendung finden.
Zusammengefasst ist ein Delir eine akute funktionelle Störung kognitiver Prozesse. Die Ätiologie des Delirs ist multifaktoriell, deren zugrundeliegende Pathophysiologie bis heute nicht vollständig verstanden. Unterschiedliche physiologische Auslösefaktoren führen zur gleichen Symptomatik. Die gemeinsame Endstrecke aller diskutierten Hypothesen ist eine akute Neurotransmitterdysbalance. Konkret bedeutet dies, dass es zu einem akuten dopaminergen Überschuss im präfrontalen Kortex kommt, zudem zu einer akut verminderten cholinergen Transmission.25

Info
Verglichen mit einer Demenz ist auch bei einem Delir die kognitive Kompensationsreserve nicht mehr ausreichend, um die akute Dysfunktion zu kompensieren ( Abb. 19).
Abb. 19).
Unterstützt wird diese Hypothese durch die epidemiologischen Daten, die vom Delir bekannt sind. Das Risiko für ein Delir ist von den dispositionellen und expositionellen Risikofaktoren eines Patienten abhängig. Der größte Risikofaktor für ein Delir ist neben dem Alter eine vorbestehende kognitive Beeinträchtigung.26
Bei vielen älteren Patienten, die sich zu einer Behandlung ins Krankenhaus begeben, ist eine beginnende neurodegenerative Erkrankung oder eine Demenz nicht vordiagnostiziert. Oft bestehen nur geringe alltagsrelevante Einschränkungen in gewohnter Umgebung. Ergänzende Risikofaktoren sind eine zunehmende Multimorbidität des älteren Patienten und die daraus resultierende Polymedikation. Insbesondere eine Reduktion des Neurotransmitters Acetylcholin scheint bei primär neurodegenerativen Erkrankungen und Demenzen eine tragende Rolle zu spielen.27 Ein plötzlich eintretendes Ereignis wie beispielweise eine notfallmäßige Operation, akute Erkrankungen wie Frakturen oder Infektionen reichen aus, um bei diesem vulnerablen Patientenkollektiv ein Delir auszulösen. Zudem weisen viele Arzneimittel ein anticholinerges Nebenwirkungsprofil auf und begünstigen eine dem Delir zugrundeliegende Neurotransmitter-Dysbalance, (prodelirogene Arzneimittel).

Info
Das Delir ist keine »Alte-Leute-Krankheit« oder eine primär neurodegenerative Erkrankung. Abhängig von der Schwere der primären Grunderkrankung und der medizinisch notwendigen Interventionen können auch junge, zuvor gesunde Erwachsene oder Kinder ein Delir erleiden, jedoch mit einer geringeren Inzidenz.

Abb. 19: Beispielhafte Skizze der multifaktoriellen Genese eines Delirs. Neben einer Prädisposition kommt es wegen eines organischen Grundes zu einer akuten Neurotransmitter-Dysbalance, die eine akute zerebrale Funktionsstörung bedingt. Diese sind im Krankenhaus häufig vorhanden und abhängig von der Schwere der Intervention oder Grunderkrankung.
2.2.1 Ein Fall aus der Praxis
Die Patientin stellt sich um 01:50 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann nachts in der Notaufnahme vor: Sie berichtet von einer Halbseitenlähmung, die etwa eine Stunde angehalten hätte. Die Patientin ist 82 Jahre, ihr Ehemann 85 Jahre. Beide leben selbstversorgend allein zuhause. Bei der Patientin fielen in letzter Zeit Gedächtnisstörungen auf, sodass bereits die Diagnose einer beginnenden Alzheimerdemenz gestellt wurde. Sie benötigt geringe Hilfe, die Haushaltsführung in gewohnter Umgebung gelingt jedoch noch.
Aktuell ist keine Lähmung mehr vorhanden. Unter dem V.a. eines flüchtigen Schlaganfalls will der diensthabende Neurologe ein MRT des Kopfes durchführen. Die Patientin wartet in der Notaufnahme auf die Bildgebung. Ihr Ehemann geht gegen 02:30 nach Hause.
Die Patientin fragt kurz danach die diensthabende Pflegekraft, ob sie nach Hause könne. Zudem möchte sie den venösen Zugang nicht mehr haben. Die Pflegekraft erklärt das Vorgehen und den V.a. eines Schlaganfalls. Die Patientin hört aufmerksam zu und begibt sich zurück in den Wartebereich der Notaufnahme. Nach etwa 15 Minuten stellt sie die gleichen Fragen noch einmal. Die Patientin wirkt reflektiert, jedoch mit der Situation überfordert. Nach erneuter Erklärung sieht sie jedoch ein, dass ein weiteres Warten sinnvoll ist. Die Patientin wirkt nach der Erklärung ruhig und versteht das geplante Vorgehen.
Nach weiteren 15 Minuten erscheint die Patientin erneut bei der Pflegekraft und fragt, wann sie nach Hause könne. Auch der venöse Zugang störe sie sehr und solle entfernt werden. Die Pflegekraft erklärt erneut das Vorgehen, die Patientin wirkt danach zunächst einsichtig.
Jetzt kontaktiert die Pflegekraft jedoch den diensthabenden Neurologen. Die Notaufnahme ist voll, die Patientin ist unruhig und könne so schlecht versorgt werden. Der Neurologe vermutet ein Durchgangssyndrom bei einer Patientin mit vorbekannter Demenz und ordnet Haloperidol 5 mg p. o. an. Hiernach ist die Patientin sehr viel ruhiger und sediert. Das anschließende MRT ist problemlos durchführbar.
Das MRT zeigt keinen Hirninfarkt, im EKG fällt jedoch ein Vorhofflimmern auf, das nicht bekannt war. Mit der Diagnose eines flüchtigen Schlaganfalls erfolgt gegen 03:40 Uhr die Aufnahme der Patientin auf der Stroke-Unit. Die Patientin wirkt auf der Stroke-Unit sehr müde, aber einsichtig und zugänglich. Kurz nach der Aufnahme auf der Station fragt sie die Pflegekräfte, wann sie nach Hause könne und wünscht zu gehen. Die Pflegekräfte erklären den Aufnahmegrund, die Patientin wirkt einsichtig und reflektiert und sucht ihr Zimmer wieder auf.
Nach 15 Minuten erscheint sie jedoch erneut, wünscht nach Hause zu gehen und hat vergessen, warum sie sich auf der Station befindet. Die Pflegekräfte der Stroke-Unit kontaktieren erneut den diensthabenden Neurologen und schildern eine unruhige Patientin, welche die Erklärungen und Aufforderungen nicht verstehe. Um 05:10 Uhr wird der Patientin deshalb Diazepam 3 mg i. v. appliziert. Danach schläft die Patientin ruhig und fest. Die Pflegekräfte bestehen aber auf einer Bedarfsmedikation. Der Neurologe wählt wegen der zuvor guten Wirksamkeit Haloperidol 5 mg.
Am nächsten Tag und auch im weiteren Verlauf ist die Patientin deutlich ruhiger, jedoch auch zurückgezogen, nicht motiviert und sehr müde. Eine Teilnahme an der Physiotherapie ist kaum möglich. Die Patientin verläuft sich mehrfach auf der Station Auch nach drei Tagen ist der Antrieb sehr reduziert. Am vierten Tag ist bereits die Entlassung geplant. Der 85-jährige Ehemann sagt aber, er könne seine Frau so nicht mit nach Hause nehmen. Sie erkenne ihn häufig nicht und benötige sehr viel Hilfe; er selbst sei körperlich bereits recht beeinträchtigt. Es wird deshalb eine Entlassung in die Kurzzeitpflege geplant.
Am nächsten Tag erfolgt die Verlegung in die Kurzzeitpflege, mit den angeordneten Medikamenten. In der erneut ungewohnten Umgebung wirkt die Patientin nicht orientiert. Sie nimmt kaum Anteil an der Ergotherapie, wirkt sehr müde und wenig motiviert, verlässt kaum das Bett.
Die Entlassung nach Hause ist nicht mehr möglich. Der Ehemann erklärt nach zwei Wochen Kurzzeitpflege, er »erkenne seine Ehefrau kaum wieder«. Sie sei immer müde, antriebsarm und verlasse kaum Stuhl oder Bett, obwohl keine Lähmungen nach Schlaganfall vorhanden sind. Eine Versorgung zuhause scheint schwer möglich, weshalb eine Versorgung in einer Dauerpflegeeinrichtung erfolgt.
• Dieser Fall ist recht typisch und lässt die Frage zu: Vergleichen Sie den Zustand bei Aufnahme – Haben wir der Patientin mit der Krankenhausversorgung geholfen? Aus Sicht der Neurologen muss die Antwort lauten: Ja! Es lag ein flüchtiger Schlaganfall vor, dessen Symptome schon bei Aufnahme nicht mehr vorhanden waren. Im EKG zeigte sich ein Vorhofflimmern, sodass der Grund für den Schlaganfall Thromboembolien aus dem Herzen waren. Es wurde daraufhin eine Blutverdünnung (orale Antikoagulation) begonnen. Wäre das nicht erfolgt, hätte eine sehr große Wahrscheinlichkeit bestanden, dass erneute, manifeste Schlaganfälle stattgefunden hätten. Durch die prophylaktische Blutverdünnung konnte das verhindert werden ( Abb. 20).
Abb. 20).

Abb. 20: Die Behandlung im Krankenhaus war hilfreich für die Patientin, weil ein weiterer, großer Gefäßverschluss einer hirnversorgenden Arterie verhindert werden konnte. Es wurde eine blutverdünnende Therapie bei entdecktem Vorhofflimmern begonnen, welche das hier gezeigte Ereignis effektiv verhindert.
Links: CT-Angiographie mit Nachweis eines Verschlusses der A. cerebri media rechts.
Mitte: Das dadurch hervorgerufene Perfusionsdefizit in der rechten Hemisphäre.
Rechts: Nachfolgendes CCT mit Nachweis einer Demarkation eines großen Teils der rechten Gehirnhälfte mit einsprechenden, schweren und bleibenden Symptomen (Hemiparese links, Neglect nach links).
Trotz der sicher richtigen Argumentation des Neurologen stellt sich die Frage:
• Hätten wir etwas besser machen können?
• Hätten wir die dauerhafte Unterbringung in einer Altenpflegeeinrichtung verhindern können?
Der Fall ist plakativ und lehrreich, weshalb im Folgenden einige Punkte diskutiert werden, an denen eine Verbesserung der Versorgung möglich gewesen wäre:
1. Die Diagnose eines »Durchgangssyndroms« (gemeint ist ein Delir) ist nicht korrekt. Die Patientin hat eine bekannte Alzheimererkrankung. Das klassische Symptom einer Alzheimererkrankung ist eine anterograde Amnesie, also eine Kurzzeitgedächtnisstörung. Die Patientin wirkt in der Notaufnahme und auch später auf der Stroke-Unit nicht aufmerksamkeitsgestört, zudem bestanden keine inhaltlichen Denkstörungen wie Verkennung der Situation. Es bestand lediglich eine Vergesslichkeit, weshalb die Patientin immer wieder fragte, warum sie sich auf der Station befindet, weil sie in Aufnahmegrund vergessen hat. Nach Erklärung der Pflegekräfte wirkte sie reflektiert und befolgte die Anweisungen, vergaß jedoch nach kurzer Zeit erneut den Aufnahmegrund.
Dies sind die klassischen Symptome einer Alzheimerdemenz und keine Symptome eines Delirs. Die anschließende neuroleptische Therapie war deshalb nicht indiziert.
2. Haloperidol ist ein hochpotentes Neuroleptikum, was zum »Gedanken ordnen« indiziert ist. Bei der Patientin bestanden keine inhaltlichen Denkstörungen, lediglich eine Vergesslichkeit durch die Alzheimererkrankung. Haloperidol sollte bei älteren Patienten – wenn überhaupt – niedrigdosiert und dauerhaft eingesetzt werden. Hohe Dosen Haloperidol haben jedoch eine sedierende Wirkung. Diese sedierende Wirkung wird als Erfolg des Haloperidols angesehen, ist jedoch nicht die Indikation für die Anwendung. Benötigt man sedierende Medikamente, sollte man dringend auf Medikamente mit günstigerem Nebenwirkungsprofil zurückgreifen. Insbesondere Haloperidol macht ausgeprägte und zum Teil nicht reversible extrapyramidale motorische Störungen (z. B. Schlundkrämpfe oder ein Parkinson-Syndrom), welche dosisabhängig einsetzen. Eine einmalige Applikation Haloperidol mit 5 mg war hier nicht indiziert.
3. Aufgrund der geschilderten Wirkung ist eine Bedarfsmedikation mit Haloperidol nicht sinnvoll. Für die »Gedanken-Ordnung« ist ein dauerhaft niedriger Serumspiegel die sinnvollste Therapie, keine hochdosierte Bedarfsmedikation.
4. Diazepam hat insbesondere bei älteren Leuten eine ausgeprägte lange Halbwertszeit, die in diesem Fall sicher bei > 20 Stunden liegt. Eine Applikation von Benzodiazepinen zur Sedierung bei älteren Patienten muss kritisch gesehen werden und ist meist nicht indiziert. Benzodiazepine führen zu etwa 30 Prozent zu paradoxen Wirkungen, zudem zu einer erheblichen Sturzneigung und haben ein nicht unerhebliches Abhängigkeitspotenzial. Insbesondere das Diazepam ist aufgrund seiner Lipophilie und der damit verbundenen sehr langen Halbwertszeit bei älteren Patienten nicht indiziert. Das zeigt sich im Verlauf, weil die Patientin über längere Zeit sediert wirkt und an einer sinnvollen Therapie nicht teilnehmen kann. Zusammen mit der Haloperidol-Bedarfsmedikation, die wahrscheinlich im Verlauf immer wieder appliziert wird, führt die Vigilanzminderung bei vorbestehender Alzheimerdemenz zu einer deutlichen kognitiven Verschlechterung. Ein Delir lag noch nicht vor.
Die bessere Alternative zur Behandlung diesem Fall wäre wahrscheinlich gewesen:
1. Erkennen der klassischen Symptome einer Alzheimerdemenz und zunächst eine nicht pharmazeutische Intervention, insbesondere mit einem der Angehörigen, und einfache und geduldige Gespräche ohne Überkorrektur.
2. Weil noch keine antidementive Therapie initiiert wurde, wäre aufgrund des sicher vorhandenen cholinergen Defizits eine Therapie mit einem Cholinesterase-Hemmer indiziert gewesen, z. B. Rivastigmin, Donepezil oder Galantamin.
3. Inhaltliche Denkstörungen lagen nicht vor. Dennoch war die Patientin z. T. psychomotorisch unruhig und ängstlich. Dies führt häufig zu einer Tag-Nacht-Umkehr, da dies oft in den Nachmittagsstunden gehäuft vorkommt (sog. »Sundowning«). Hier wäre eine Bedarfsmedikation mit einem niedrig potenten Neuroleptikum gegebenenfalls indiziert, jedoch nicht fest eingesetzt, sondern nur bei Bedarf und Unruhe (z. B. Melperon oder Pipamperon).
2.2.2 Definition des Delirs
Aufgrund der multifaktoriellen Genese gibt es viele Definitionen des Delirs, die z. T. unscharf sind und für den klinischen Alltag wenig praktikabel erscheinen.

Am sinnvollsten und praktikabelsten erscheint die aktuell noch gültige DSM-IV Definition des Delirs ( Abb. 21). Für den klinischen Alltag entscheidend sind hierbei:
Abb. 21). Für den klinischen Alltag entscheidend sind hierbei:
1. Fluktuation der Symptome: Die Patienten wirken in der vormittäglichen Visite strukturiert, geordnet und ruhig. In den Nachmittagsstunden oder abends kommt es dann zu einer zunehmenden psychomotorischen Unruhe: Die Patienten verkennen Situationen und fühlen sich bedroht. Später oder am nächsten Morgen sind die Patienten wieder sehr geordnet, reflektiert und haben oft eine Amnesie für die Episode mit der ausgeprägten Unruhe.
2. Aufmerksamkeitsstörungen: Die klassischen kognitiven Defizite bei einem Delir sind eine Störung der Aufmerksamkeit. Die Patienten können sich sehr schlecht fokussieren, auch ein kurzzeitiger Fokus auf einfache Aufgaben oder Aufforderung gelingt nicht. Die Symptome differenzieren das Delir leicht von kortikalen Demenzen wie der Alzheimererkrankung, bei dem die Aufmerksamkeit nicht gestört ist.
3. Organische Ursache: Das Delir ist keine psychiatrische Grunderkrankung. Hinter dem Delir verbirgt sich eine akute Neurotransmitter-Dysbalance, die z. B. bei Elektrolytstörungen, Fieber, Exsikkose oder anderen organischen Ursachen vorkommt und zu einer vorübergehenden Funktionsstörung des Gehirns führt. Deshalb ist eine dauerhafte Psychopharmaka-Therapie nicht indiziert.
Die ebenfalls beschriebene globale kognitive Funktionsstörung hilft im klinischen Alltag nicht weiter, da globale Funktionsstörungen nicht von anderen Erkrankungen wie z. B. primär neurodegenerativen Erkrankungen differenzieren. Der Fokus bei der klinischen Untersuchung sollte deshalb auf den o. g. drei Punkten liegen.

Abb. 21: Die Definition des Delirs nach DSM IV, die im klinischen Alltag praktisch gut umsetzbar scheint.
2.3 Differenzialdiagnosen kognitiver Einschränkungen – Unterschiede zwischen Demenz und Delir
Wie bereits beschrieben ist die Demenz eigentlich keine Erkrankung, sondern ein Symptomenkomplex, der unterschiedliche Ursachen haben kann. Der häufigste Grund eine Demenz ist eine Alzheimererkrankung oder eine Demenz vom Mischtyp, also eine Alzheimerpathologie plus vaskulären zerebralen Läsionen. Die Symptome der Alzheimererkrankung sind leicht von einem Delir zu unterscheiden.
Insbesondere gehen beginnende Alzheimererkrankungen nicht mit Aufmerksamkeitsstörung einher, während sie beim Delir sicher vorhanden sind und zudem die dominanten kognitiven Symptome darstellen. Zu Differenzierung von Aufmerksamkeitsstörung und kognitiven Defiziten, die bei der Alzheimererkrankung typisch sind, ist ein Blick auf $. 33 ff sinnvoll, wo die klassischen kortikalen kognitiven Symptome der Alzheimererkrankung beschrieben sind.

Info
Eine Alzheimererkrankung hat nicht fluktuierende, kortikale kognitive Symptome (Gedächtnis, Praxie, Visuokonstruktion).
Ein Delir zeigt eine ausgeprägte Fluktuation der Symptome, zudem sind Aufmerksamkeitsstörungen das dominante kognitive Symptom!
Von den primär oder sekundär neurodegenerativen Demenzerkrankungen geht praktisch nur die Lewy-Körperchen-Demenz mit einer Fluktuation der Symptome einher. Die anderen, insbesondere primär neurodegenerativen Erkrankungen zeigen keine oder wenig fluktuierende Symptome. Hier zeigt sich typischerweise eine langsam progrediente kognitive Störung, die über Monate oder sogar Jahre besteht und fortschreitet. Dennoch ist eine Lewy-Körperchen-Demenz klinisch leicht von einem Delir zu unterscheiden, da hier andere, zusätzliche Symptome auftreten, die für die Erkrankung typisch sind:
• Szenische, optische Halluzinationen,
• zudem klassische REM-Schlaf-Verhaltensstörungen,
• ausgeprägte visuokonstruktive Defizite und
• zusätzliches Parkinson-Syndrom.
Die Kombination dieser Symptome macht eine Lewy-Körperchen-Erkrankung sehr wahrscheinlich, eine ausgeprägte Fluktuation der kognitiven Defizite mit dominanten Aufmerksamkeitsstörungen spricht für ein Delir.
Tab. 4: Unterschiede zwischen einem Delir und einer Demenz
| Demenz | Delir | |
| Klinisches Bild | Oft initial schlecht voneinander zu unterscheiden | |
| Entstehung | Monate/Jahre | Stunden, fluktuierende Symptome |
| Verlauf | Chronisch progredient | Reversibel |
| Pathophysiologie | Chronischer Neurotransmittermangel | Akute Neurotransmitterdysbalance |
| Charakter | Erst zuverlässige Diagnostik, dann Therapie | Notfall, Sofortmaßnahmen |
Ein Differenzieren zwischen einer bestehenden Demenzerkrankung oder einem Delir ist insbesondere auch aufgrund der Akuität der durchzuführenden Diagnostik und Therapie entscheidend. Bei einer Demenzerkrankung ist zunächst eine ausführliche Diagnostik indiziert, um dann eine spezifische Therapie zu beginnen. Eine übereilte oder nicht-indizierte Therapie ist bei Demenzerkrankungen ein häufiger Fehler. Hierbei ist die Klärung der Ätiologie der Demenz entscheidend. So sind z. B. Alzheimer-Medikamente nur bei der Alzheimerdemenzen hilfreich und sinnvoll, bei der frontotemporalen Demenz sind sie nicht hilfreich oder sogar schädlich.
Beim Delir ist eine sehr zügige und rasche therapeutische Intervention notwendig, da jeder zusätzliche Tag mit einem Delir bei älteren Patienten zusätzliche kognitive Defizite bedingt, die oft nicht reversibel sind. Deshalb ist es beim Delir notwendig, neben einer gezielten Diagnostik gleichzeitig parallel eine symptomatische Therapie zu beginnen, die aus nicht-pharmazeutischen und einer spezifischen pharmakologischen Therapie besteht.
Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Differenzierung von Demenz und Delir.

Info
Bei erstmaliger Vorstellung eines Patienten mit kognitiven Defiziten ist ein Differenzieren zwischen einem akutem Delir und einer Demenz nicht einfach. Es lässt sich jedoch anhand einer gezielten Anamnese und auch einer Untersuchung der dominanten kognitiven Defizite oft eine Verdachtsdiagnose stellen.
Die Fluktuation der Verwirrtheit ist sehr typisch für das Delir und bei Demenzerkrankungen sehr selten. Alleine die Lewy-Körperchen-Demenz zeigt fluktuierende Symptome, jedoch in Kombination mit anderen typischen Beschwerden, sodass ein Abgrenzen zu einem Delir gelingen sollte.
Literatur
Aisen PS, Cummings J, Jack CR Jr, Morris JC, Sperling R, Frölich L, Jones RW, Dowsett SA, Matthews BR, Raskin J, Scheltens P, Dubois B (2017): On the path to 2025: understanding the Alzheimer’s disease continuum. Alzheimers Res Ther. 2017 Aug 9; 9 (1):60. doi: 10.1186/s13195-017-0283-5.PMID: 28793924
Alzheimer A (1907): Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie Band 64 (1907), S. 146–148
Cummings J (2012): Alzheimer’s disease diagnostic criteria: practical applications. Alzheimers Res Ther. 2012 Sep 5; 4 (5):35. doi: 10.1186/alzrt138. eCollection 2012. PMID: 22947665
Destatis (2015): Umfrage zur Überforderung durch eine Pflegetätigkeit in Deutschland nach Altersgruppen im Jahr 2015. https://de.statista.com/statistik/daten/stu-die/481570/umfrage/ueberforderung-durch-eine-pfegetaetigkeit-in-deutsch-land-nach-altersgruppen/
DGPPN und DGN (2016): S3-Leitlinie »Demenzen«. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-013.html
Farooq MU, Min J, Goshgarian C, Gorelick PB (2017): Pharmacotherapy for Vascular Cognitive Impairment. CNS Drugs. 2017 Sep; 31(9):759-776. doi: 10.1007/s40263-017-0459-3.PMID: 28786085
Frisoni GB, Winblad B, O’Brien (2011): Revised NIA-AA criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease: a step forward but not yet ready for widespread clinical use. JT. Int. Psychogeriatr. 2011 Oct; 23(8):1191-6. doi: 10.1017/S1041610211001220.
Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, Carrillo MC, Dunn B, Haeberlein SB, Holtzman DM, Jagust W, Jessen F, Karlawish J, Liu E, Molinuevo JL, Montine T, Phelps C, Rankin KP, Rowe CC, Scheltens P, Siemers E, Snyder HM, Sperling R (2018): NIA-AA Research Framework: Toward a biological deflnition of Alzheimer’s disease. Contributors. Alzheimers Dement. 2018 Apr; 14(4):535-562. doi: 10.1016/j. jalz.2018.02.018.PMID: 29653606
Hamilton GM, Wheeler K, Di Michele J, Lalu MM, McIsaac DI (2017): A Systematic Review and Meta-analysis Examining the Impact of Incident Postoperative Delirium on Mortality. Anesthesiology. 2017 Jul; 127(1):78-88. doi: 10.1097/ALN.0000000000001660.PMID: 28459734
Love S, Miners JS (2016): Cerebrovascular disease in ageing and Alzheimer’s disease. Acta Neuropathol. 2016 May; 131(5):645-58. doi: 10.1007/s00401-015-1522-0. Epub 2015 Dec 28.PMID: 26711459
Maldonado JR (2017): Delirium pathophysiology: An updated hypothesis of the etiology of acute brain failure. Int J Geriatr Psychiatry. 2018 Nov; 33(11):1428-1457. doi: 10.1002/gps.4823. Epub 2017 Dec 26.PMID: 29278283
McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW et al. (2017): Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology. 2017 Jul 4; 89(1):88-100. doi: 10.1212/WNL.0000000000004058. Epub 2017 Jun 7.PMID: 28592453
O’Brien JT, Lancet, TA (2015): Vascular dementia. 2015 Oct 24; 386(10004):1698-706. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00463-8.PMID: 26595643
Pohjasvaara T, Mäntylä R, Ylikoski R, Kaste M, Erkinjuntti T Stroke (2000): Comparison of different clinical criteria (DSM-III, ADDTC, ICD-10, NINDS-AIREN, DSM-IV) for the diagnosis of vascular dementia. National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences.2000 Dec; 31(12):2952-7. doi: 10.1161/01.str.31.12.2952. PMID: 11108755
Schor JD, Levkoff SE, La Lipsitz, Reilly CH, Cleary PD, Rowe JW et al. (1992): Risk Factors for Delirium in Hospitalized Elderly. JAMA 1992; 267(6):827–31.
Snowdon DA (2003): Healthy aging and dementia: findings from the Nun Study. Ann Intern Med. 2003 Sep 2; 139(5 Pt 2):450-4. doi: 10.7326/0003-4819-139-5_part_2-200309021-00014.PMID: 12965975
Thomas T, Miners S, Love S (2016): Post-mortem assessment of hypoperfusion of cerebral cortex in Alzheimer’s disease and vascular dementia. Brain. 2015 Apr; 138(Pt 4):1059-69. doi: 10.1093/brain/awv025. Epub 2015 Feb 16.PMID: 25688080
Trzepacz PT (2000): Is there a fnal common neural pathway in delirium? Focus on acetylcholine and dopamine. Semin Clin Neuropsychiatry. 2000 Apr; 5(2):132-48. doi: 10.153/SCNP00500132.PMID: 10837102
________________
9 DGPPN und DGN (2016): S3-Leitlinie »Demenzen«. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-013.html
10 DGPPN & DGN (2016): S3-Leitlinie »Demenzen«, S. 32. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-013.html
11 Snowdon DA (2003): Healthy aging and dementia: findings from the Nun Study. Ann Intern Med. 2003 Sep 2;139(5 Pt 2):450-4. doi: 10.7326/0003-4819-139-5_part_2-200309021-00014.PMID: 12965975
12 Alzheimer A (1907): Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie Band 64 (1907), S. 146–148
13 Aisen PS et al. (2017): On the path to 2025: understanding the Alzheimer’s disease continuum. Alzheimers Res Ther. 2017 Aug 9;9(1):60. doi: 10.1186/s13195-017-0283-5.PMID: 28793924
14 Frisoni GB et al. (2011): Revised NIA-AA criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease: a step forward but not yet ready for widespread clinical use.
JT.Int Psychogeriatr. 2011 Oct; 23(8):1191-6. doi: 10.1017/S1041610211001220.
15 Cummings J (2012): Alzheimer’s disease diagnostic criteria: practical applications.
Alzheimers Res Ther. 2012 Sep 5; 4(5):35. doi: 10.1186/alzrt138. eCollection 2012.PMID: 22947665
16 Pohjasvaara T et al. (2000): Comparison of different clinical criteria (DSM-III, ADDTC, ICD-10, NINDS-AIREN, DSM-IV) for the diagnosis of vascular dementia. National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences. 2000 Dec;31(12):2952-7. doi: 10.1161/01.str.31.12.2952.PMID: 11108755
17 O’Brien JT, Lancet, TA (2015): Vascular dementia. 2015 Oct 24;386(10004):1698-706. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00463-8.PMID: 26595643
18 Vgl. http://www.dgn.org/
19 Love S, Miners JS (2016): Cerebrovascular disease in ageing and Alzheimer’s disease. Acta Neuropathol. 2016 May; 131(5):645-58. doi: 10.1007/s00401-015-1522-0. Epub 2015 Dec 28.PMID: 26711459
20 Thomas T et al. (2016): Post-mortem assessment of hypoperfusion of cerebral cortex in Alzheimer’s disease and vascular dementia. Brain. 2015 Apr; 138(Pt 4):1059-69. doi: 10.1093/brain/awv025. Epub 2015 Feb 16.PMID: 25688080
21 Farooq MU et al. (2017): Pharmacotherapy for Vascular Cognitive Impairment. CNS Drugs. 2017 Sep;31(9):759-776. doi: 10.1007/s40263-017-0459-3.PMID: 28786085
22 DGPPN und DGN (2016): S3-Leitlinie »Demenzen«. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-013.html
23 McKeith IG et al. (2017): Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology. 2017 Jul 4; 89(1):88-100. doi: 10.1212/WNL.0000000000004058. Epub 2017 Jun 7.PMID: 28592453
24 Hamilton GM et al. (2017): A Systematic Review and Meta-analysis Examining the Impact of Incident Postoperative Delirium on Mortality. Anesthesiology. 2017 Jul;127(1):78-88. doi: 10.1097/ALN.0000000000001660. PMID: 28459734
25 Maldonado JR (2017): Delirium pathophysiology: An updated hypothesis of the etiology of acute brain failure. Int J Geriatr Psychiatry. 2018 Nov; 33(11):1428-1457. doi: 10.1002/gps.4823. Epub 2017 Dec 26.PMID: 29278283
26 Schor JD et al. (1992): Risk Factors for Delirium in Hospitalized Elderly. JAMA 1992; 267(6):827–31.
27 Trzepacz PT (2000): Is there a final common neural pathway in delirium? Focus on acetylcholine and dopamine. Semin Clin Neuropsychiatry. 2000 Apr;5(2):132-48. doi: 10.153/SCNP00500132.PMID: 10837102
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783842690837
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Mai)
- Schlagworte
- Delirprävention Demenz Altenpflege kognitive Störungen Angehörigenberatung multiprofessionell Pharmakotherapie